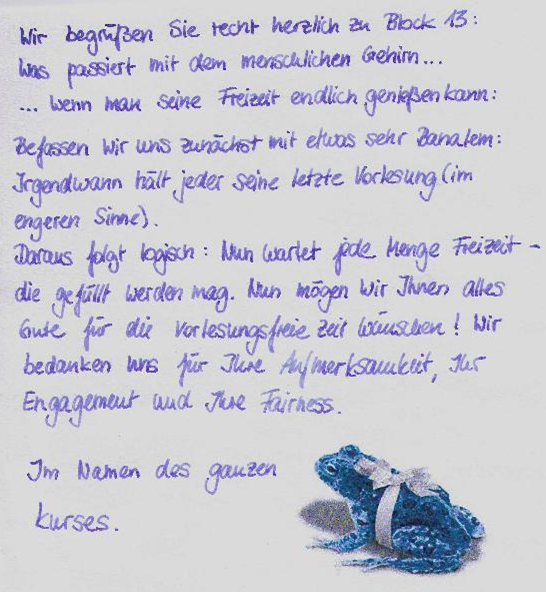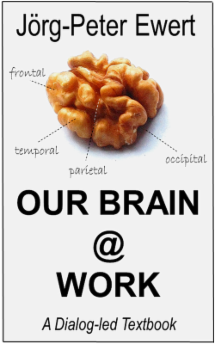
http://www.amazon.com/Our-Brain-Work-Dialog-led-Textbook-ebook/dp/B01DYC1KM2/
________________________________________________
J.-P. Ewert
Einführung in die Neurobiologie
.Originaltext einer online-Vorlesung von Tonbandaufzeichnungen
vgl. hierzu die Abbildungen Block 1-12
vgl. auch Neurobiologie im Dialog Kursabschnitte Teil I-V
Themen
Block1: ZNS und Neurone Nervensysteme; Neurone, Organelle; Gliazellen; Entwicklung ZNS, PNS; Neuron/Glia-Interaktionen, Blut/Hirn-Schranke; Aufklärung von Neuronen-Schaltungen
Block2: Bioelektrizität Historisches; Ruhepotential (Henderson, Nernst, Goldmann); Fließgleichgewichte; Carrier-Systeme; Membranzustände; Ionenkanäle; Aktionspotential
Block3: Erregungsleitung Myelogenese ZNS, PNS; Dekrement; Kreisströmchen; Saltatorische Ausbreitung;Frequenz/Amplituden-Modulation, Regeneration; Querschnittslähmung, Therapie-Aussichten
Block4: Synaptische Übertragungen Schnelle/Langsame(2nd-Messenger)Synapsen; Vesikel-Prozesse; Gedächtnis, Signaltransduktionen, cAMP, IP3; Rechenoperationen; NO-gesteuerte Prozesse
Block5: Lernprozesse Aplysia, Synaptische Sensitisierung, Lang- und Kurzzeitgedächtnis, CREB1/2; Konditionierung, Langzeit-Potenzierung(LTP) und Langzeit-Depression(LTD)
Block6: Neurochemie der Emotionen (I) Belohnungs -und Bestrafungssysteme; Limbisches System; N. accumbens, N. amygdalae; Dopamin; Cocain, Amphetamin, Ecstasy; Canabis; Nicotin, Coffein
Block7: Neurochemie der Emotionen (II) Opiat-Sucht, Methadon;Schizophrenie; Depressionen; Angst, Tranquilizer; Ethanol; "Cheeseburger-Phänomen", Melatonin/Serotonin, Winterdepression
Block8: Sinnesphysiologie(I), Chemorezeption Geruchssinn (Insekten, Säuger), Geschmackssinn (Mensch); Rezeptor-Spezialisten/ Generalisten, Reiz/Erregungs-Transduktionen, Signalkaskaden
Block9: Sinne(II), Photorezeption Linsenauge Säuger, Bau, Entwicklung; Reiz/Erregungs-Transduktion; Kodierung von Reizparametern, ON/OFF Antworten, Laterale Inhibition; Optik
Block10: Sinne(III) Haut, Seitenlinie, Innenohr Mechanorezeptoren,Thermorezeptoren, Nozizeptoren, Mediatoren, Anästhetika; Haarzellen, Seitenlinie, Labyrinth, Utriculus, Corti-Organ, Anpassungen
Block11: Muskelphysiologie Querstreifung, Aktin/Myosin-Interaktion; IP3, Ca2+ -Starter, ATP; Typ I/II-Myosine; Motorische Endplatte; Tetanus; Reflexbögen (vegetative/somatische)
Block12: Verhaltensphysiologie (Neuroethologie) Neuronenschaltungen, Programmsteuerung (Tritonia); Signal-Erkennung, Auslösemechanismen (Kröte); Motorische Systeme (Mensch), Parkinsonismus; Neuroplastizität in medizinisch-therapeutischen Rehabilitationsprozessen
Basis-Lehrbücher
- Bolhuis J.J., Giraldeau L.-A. (Eds.): The Behavior of Animals: Mechanisms, Function, and Evolution, Blackwell Malden
- Carew T.J.: Behavioral Neurobiology, Sinauer Ass. Inc. Sunderland
- Delcomyn F.: Foundations of Neurobiology, W.H. Freeman and Comp. New York
- Dudel J., Menzel R., Schmidt R.F. (Eds.): Neurowissenschaft, Springer Berlin
- Ewert J.-P.: Neurobiologie des Verhaltens, Huber Bern; --- Neuroethology, Springer Berlin
- Kandel E.R., Schwartz J.H. (Eds.): Principles of Neuroscience, Edward Arnold London
- Zupanc G.K.H.: Behavioral Neurobiology, Oxford Univ.Press Oxford
Wissenschaftlicher Film
Ewert J.-P. & IWF: Bildverarbeitung im Sehsystem der Erdkröte: Verhalten, Hirnfunktion, Künstliches Neuronales Netz. C 1805, DVD, VHS, Inst. f. d. Wiss. Film, IWF Wissen und Medien gGmbH Göttingen
.
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie sehr herzlich zur „Einführung in die Neurobiologie“. Diese Vorlesung gliedert sich in verschiedene Blöcke; lassen Sie uns zunächst sehen, womit wir es zu tun haben. Wir werden uns mit der Nervenphysiologie beschäftigen, sowie mit Aspekten der Neuropharmakologie, der Sinnesphysiologie, der Muskelphysiologie und mit der Neuroethologie, das heißt der Verhaltensphysiologie. Stoffwechselphysiologie, soweit sie Tiere und Pflanzen betreffen, wird von Herrn Professor Dr. Kutschera und speziell die Stoffwechselphysiologie der Tiere von Herrn Priv. Doz. Dr. Finkenstädt angeboten. Weiterhin wird Herr Dr. Schwippert im Rahmen der Ringvorlesung „Einführung in die Humanbiologie“ ausgewählte Kapitel aus der Hirnphysiologie des Menschen näher beleuchten. Herr Schwippert wird darüber hinaus im Rahmen der Ringvorlesung „Einführung in das Arbeiten mit Radioisotopen in der Biologie und Chemie“ eine Vorlesung halten über die natürliche Strahlenbelastung und ihre biologische Wirkung.
Der Stoff der Vorlesung, mit dem wir uns in den nächsten 12 Wochen beschäftigen werden, bildet die Voraussetzung für den „Physiologischen Kurs für Diplomstudierende“ und die „Übungen zur Physiologie für Lehramtsstudierende“. Wie üblich, werden wir zu jenen Kursen eine Aufnahmeklausur schreiben lassen über Themen, die in der Vorlesung behandelt werden. Woher sie den Stoff beziehen und sich aneignen, bleibt Ihnen überlassen. Das einfachste ist wohl, ihn durch Besuch dieser Vorlesung zu konsumieren. Wir werden die Klausur am Ende dieser Vorlesungsreihe schreiben, und zwar in diesem Raum. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Sie werden während der Klausur genügend Zeit haben, sich mit den Fragen auseinander zu setzen. Ich darf jetzt schon darauf hinweisen, dass diese Klausur nicht schwer sein wird. Es geht für Sie und uns lediglich darum, festzustellen, dass sie die Grundlagen der Tierphysiologie kennen. Niemand von uns ist daran interessiert, anhand dieser Aufnahmeklausur zu selektieren, sondern, im Gegenteil, Ihnen ein Erfolgserlebnis zu vermitteln. Die Durchfallquote ist erfahrungsgemäß sehr gering. Und wer dann die Nachklausur ebenfalls nicht schafft, sollte ernsthaft darüber nachdenken, ob dessen Stärken wirklich im Bereich der Biologie liegen.
Wir kommen jetzt zur Gliederung der Vorlesung. Ich habe das Skript so gestaltet, dass der „rote Faden“ klar erkennbar ist. Zu jedem Vorlesungs-Block sind Fragen aufgelistet, anhand derer Sie Ihr gewonnenes Wissen überprüfen können. Wie gesagt, haben wir es mit insgesamt mit 12 Blöcken zu tun. Block1, Thematik der heutigen Vorlesung, beschäftigt sich mit dem Zentralnervensystem ZNS und den Neuronen, aus denen es aufgebaut ist. Wir werden unterschiedliche Nervensysteme beleuchten, die Funktion von Neuronen und ihrer Organelle kennen lernen, auf die vielfältigen Funktionen der Gliazellen eingehen und ihre Beziehungen zu Nervenzellen – z.B. bei der Erregungsleitung, der Entwicklung des Nervensystems, aber auch im Zusammenhang mit der Blut/Hirnschranke – klären. Wir werden uns weiterhin mit Methoden beschäftigen, die es gestatten, neuronale Aktivität im Gehirn zu messen, und werden kennen lernen, wie Neuroanatomen Neuronenschaltungen im Gehirn experimentell aufklären können, so dass man heutzutage eine relativ gute Vorstellung darüber hat, wie einzelne Neuronen im Gehirn miteinander vernetzt sind, um Informationen zu verarbeiten.
In Block2 und Block3 werden wir uns mit Bioelektrizität und Erregungsleitung beschäftigen. Wir werden herausfinden, wie Ruhepotenziale zustande kommen, wie jene unter Energieaufwand aufrecht erhalten werden, wie Aktionspotenziale entstehen, und wir werden verschiedene Möglichkeiten der Erregungsleitung kennen lernen, wobei Zusammenhänge zwischen Kodierung und Dekodierung von Interesse sind. Weiterhin werden wir uns mit dem wichtigen Gebiet der Regeneration beschäftigen und uns hier zum Beispiel die Frage stellen, ob bzw. inwieweit es möglich sein wird, dass Rückenmarkquerschnittsgelähmte eines Tages nach Behandlung mit bestimmten Therapien den Rollstuhl verlassen können. Die Neurobiologie ist in ihrer Forschung auf diesem Gebiet heutzutage bereits relativ weit fortgeschritten, und man darf daher auf neue Entwicklungen gespannt sein.
Wir kommen dann in Block4 auf synaptische Übertragungsprozesse zu sprechen und fragen, wie Neuronen miteinander verschaltet sind. In diesem Zusammenhang gilt es, vor allem die Aufgaben chemischer Synapsen zu klären, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gedächtnisprozessen. Auch hinsichtlich der Grundlagen des Gedächtnisses ist die Forschung heute relativ weit fortgeschritten. Wir wissen inzwischen recht gut, was sich hinter dem Langzeitgedächtnis strukturell verbirgt. Diese Erkenntnisse sind im Jahre 2000 mit dem Nobelpreis für Medizin an Eric Kandel ausgezeichnet worden. Erst, wenn man die Grundlagen des Gedächtnisses kennt, kann man sich natürlich auch Gedanken über die Entwicklung von Medikamenten machen, die es erlauben, Gedächtnisleistungen zu verbessern, bzw. deren Abnahme zu verhindern. Auch darauf werden wir zu sprechen kommen.
In Block5 werden wir neurobiologische und biochemische Grundlagen verschiedener Lernprozesse weiter vertiefen. Zweifellos ist dies keine biochemische Vorlesung. Wir wollen uns daher nur soweit mit Chemie beschäftigen, sofern chemische Moleküle als Boten, Mediatoren, Katalysatoren usw. bei intra- und interzellulären Signal-Transduktionen von Interesse sind.
Teilweise an Block5 anknüpfend werden wir uns in den Blöcken 6 und 7 mit der Neurochemie der Psyche, der Stimmungen, also der Emotionen, beschäftigen. Was ist Glück? Gibt es ein Glückszentrum im Gehirn? Wie wird es angesprochen? In diesem Zusammenhang werden wir auch Drogen, Drogenwirkung aber auch Drogentherapie und Drogenproblematik unter verschiedenen Aspekten behandeln. Ferner werden wir auf Krankheiten des Gehirns eingehen wie Schizophrenie, Endogene Depressionen, Angstneurosen, – alles Krankheiten oder Syndrome, die mit Störungen der Chemie des Gehirns verbunden sind. Wir wollen in diesem Zusammenhang auch die chemischen Grundlagen und Therapiemöglichkeiten der Winterdepression beleuchten und uns fragen, welche Form der Ernährung glücklich macht.
Die Blöcke 8 bis 10 konzentrieren sich auf verschiedene Fragen der Sinnesphysiologie, u.a. Chemorezeption, Fotorezeption, Mechanorezeption, Nozizeption.
Wir beschäftigen uns dann in Block11 mit Muskelphysiologie, d.h. den verschiedenen Funktionsstrukturen der Muskulatur und den verschiedenen Muskeltypen. Wir werden Prozesse kennen lernen, die der Muskelkontraktion zugrunde liegen, aber auch solche, die dem Muskelaufbau im Fitness-Studio dienen, und wir werden hier die Problematik des Doping tangieren.
Der abschließende Block12 der Vorlesung befasst sich sozusagen mit der Krönung der Neurobiologie, der Neuroethologie. Hier werden wir Prozesse studieren, die der Auslösung und Koordination von verschiedenen Verhaltensweisen – von der Schnecke bis zum Menschen – zugrunde liegen.
Wir kommen nun zu den Lehrbüchern, die ich für diese Vorlesung ausgewählt und im Skript angegeben habe. Alle diese Lehrbücher empfehle ich ausdrücklich. Die Vorlesung basiert hauptsächlich auf dem Buch Ewert: Neurobiologie des Verhaltens, das Sie im Rahmen einer Sammelbestellung verbilligt erwerben können.
Last but not least möchte ich meine große Anerkennung aussprechen an Herrn Dr. Wolfgang Schwippert, dem die Umsetzung der von mir erstellten Abbildungs-Vorlagen der Vorlesung in eine PowerPoint-Präsentation zu verdanken ist, wobei vor allem die sehr aufwendigen, didaktisch instruktiven Animationen hervorzuheben sind. Die Grafiken der meisten PowerPoint-Folien finden sie im Skript, bis auf jene, die mehr allgemeiner Natur sind.
Ferner wird diese Vorlesung durch Video-Clips, d.h. durch kurze, von mir zusammengestellte TV-Ausschnitte begleitet und aufgelockert. Wir haben bei den Sendern, die im Skript namentlich aufgeführt sind, um Genehmigung gebeten. Alle diese Sender empfanden es als sehr positiv, dass interessante Video-Clips, die aus längeren TV-Produktionen stammen, in dieser Vorlesung sozusagen eine Art re-birth finden. Genehmigungen für die Verwendung von TV-Mitschnitten für diese Vorlesung wurden erteilt von: ARD, SWR, BR, Phönix; ZDF; BTV 4U; BBC.
__________________________________________
Block1: ZNS und Neurone
Nervensysteme; Neurone, Organelle; Gliazellen; Entwicklung ZNS, PNS; Neuron/Glia-Interaktionen, Blut/Hirn-Schranke; Aufklärung von Neuronen-Schaltungen
__________________________________________
vgl. Abbildungen Block 1
Fragen zu Block 1
• Worin unterscheiden sich Nervensysteme?
• Ist das Nervensystem von Vertebraten gegliedert?
• Sind Gehirne von Vertebraten vergleichbar?
• Was leistet das Nervensystem?
• Lassen auch Sie sich von Daten des Nervensystems beeindrucken?
• Wie ist ein Neuron aufgebaut?
• Wie und in welche Richtung erfolgt der Vesikeltransport?
• Wodurch können Axone elektrisch isoliert sein?
• Woraus entwickeln sich die Vorstufen von Gehirn und Rückenmark?
• Welche zellulären Strukturen entwickeln sich aus dem Neuralrohr?
• Welche Zellen entwickeln sich aus der Neuralleiste?
• Welche Zellen besitzen immunologische Eigenschaften?
• Wie finden Axone ihre Ziele?
• Wie werden neuronale Verknüpfungen im Rückenmark festgelegt?
• Neuroarchitektur - Wie sind Neurone verschaltet?
• Wie lassen sich Zielregionen für Informationen im Gehirn auffinden?
• Wie lassen sich Senderegionen für Informationen im Gehirn auffinden?
• Wie lassen sich kollateral angesteuerte Zielregionen im Gehirn auffinden?
• Wie lassen sich regionale Hirnaktivitäten im Menschen non-invasiv messen?
• Wie lassen sich Hirnaktivitäten direkt über den Energieverbrauch messen?
.
Wir starten mit Block1. Vieles wird Ihnen noch aus der Schule bekannt sein; dort darf ich mich kurz fassen. Wir gehen auf Neurone ein, deren Organelle, die Funktion der Glia, Neuron-Gliazell-Interaktionen z.B. die Blut/Hirn-Schranke, und schließlich auf Neuronenschaltungen, ihre Funktion und ihre Aufklärung. Zunächst die simple Frage: wie und wodurch unterscheiden sich die Nervensysteme verschiedener Tiergruppen, – von der Qualle bis zum Menschen?
Nervensysteme können sehr unterschiedlich organisiert und strukturiert sein. Alle Nervensysteme haben jedoch eine gemeinsame Eigenschaft: sie bestehen aus Neuronen, die miteinander verschaltet sind. Diese Schaltung erlaubt es, Signale aus der Umwelt mit Hilfe von Rezeptoren aufzunehmen, zu verarbeiten und, gegebenenfalls, an Effektoren, z.B. die Muskulatur, weiterzugeben, woraus dann eine Verhaltensreaktion, auf das Signal bezogen, resultiert. Relativ einfache diffuse Nervennetze treffen wir schon bei den Polypen unter den Hydrozoen an. Im Zusammenhang mit ihrer sessilen Lebensweise sind bei diesen Formen noch keine Zentralisierungen von Nervenzellen vorhanden. Eine höher entwickelte Form stellt die bewegliche Meduse dar. In ihrem Schirm, der Umbrella, befinden sich bereits Licht- und Schweresinnesorgane, die Signale in einen Ringnerven des Schirms einspeisen. Entsprechend kann sich die Muskulatur der Umbrella kontrahieren und Reiz bezogene Bewegungen durchführen.
Betrachten wir jetzt die Schnecken unter den Mollusken; hier grob schematisch das Nervensystem einer Weinbergschnecke. Dort hat die Evolution zwecks neuraler Zentralisierung einen pfiffigen Versuchsballon losgelassen. Also, sagte sich der Schöpfer, der intelligente Designer oder die Evolution – wer dies auch immer war, muss hier nicht diskutiert werden – „ich konzentriere Neuronen in Form von Ganglien einfach überall dort, wo sie gebraucht werden: d. h. zum Beispiel im Kopf als Zerebralganglion, im Fuß als Pedalganglion, im Eingeweidesack als Viszeralganglion, usw“. Das wäre so ähnlich, als ob wir ein Ganglion im Kopf, eins im Arm, eins im Bein, und eins im Bauch hätten. Die langsamen friedlichen Schnecken kommen mit dieser Art Zentralisierung ihres Nervensystems offenbar ganz gut zurecht. Zwar ist das Fußganglion mit dem Bauchganglion durch Nervenstränge, genannt Konnektive, verbunden; somit weiß der Kopf was der Fuß gerade denkt – und vice versa – , aber was kümmert es den Bauch, was der Fuß gerade macht. Für die am höchsten entwickelte Form unter den Mollusken, die schnelle kämpferische Krake, war diese verteilte neurale Zentralisierung wohl nicht effektiv genug. Bei ihr sind die betreffenden Ganglien im Kopfbereich zu einer Art Gehirn zusammengerückt. Solche Cephalisation ermöglicht – durch kürzere Wege – eine schnellere Kommunikation unter den Neuronen. Kraken, auch Tintenschnecken oder Cephalopoden genannt, sind sehr hoch organisierte Wirbellose Tiere und wesentlich intelligenter als etwa Wegschnecken.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die große Tiergruppe der Articulaten, d. h. der Gliedertiere. Als Repräsentant wählen wir den Regenwurm. Dieser besitzet ein völlig anders organisiertes ZNS. Der Urform nach leitet es sich vom Strickleiter-Nervensystem ab, bestehend aus einem Ober -und einem und Unterschlundganglion – Gehirn – sowie einer Bauchmark-Ganglienkette. Pro Körpersegment gibt es ein Ganglienpaar, das innerhalb des Segments durch paarige Kommissuren kommuniziert, während Ganglienpaare aufeinander folgender Segmente durch Konnektive miteinander verbunden sind, daher der Name Strickleiternervensystem. Die Fliege, die als Arthropode ebenfalls zu den Articulaten gehört, stellt eine wesentlich höher entwickelte Form dar. Bei ihr hat eine weitere Zentralisierung stattgefunden: Konzentration der Kopfganglien zum Gehirn und Konzentration des Bauchmarks zu dem aus drei Brustganglienpaaren bestehenden Brustmark. Die drei Brustganglienpaare koordinieren hauptsächlich die drei Beinpaare jener Hexapoden.
Schließlich kommen wir zu den Vertebraten. Als Beispiele wählen wir die Erdkröte Bufo bufo und den Menschen Homo sapiens. So unterschiedlich beide Gehirne sind, ihrem Grundbauplan nach bestehen beide aus fünf Abschnitten: Telencephalon, Diencephalon, Mesencephalon, Cerebellum, Medulla oblongata. Es schließt sich das Rückenmark an. Ein Hauptunterschied zwischen Kröte und Mensch besteht u.a. in der Differenzierung des Telencephalon, das bei der Kröte relativ primitiv, beim Menschen jedoch zur hoch differenzierten Großhirnrinde ausgebildet ist und uns Menschen erlaubt, Dinge zu tun, die Kröten nicht können, aber – um zu überleben – auch nicht können müssen. Wir wollen uns in der nächsten Folie noch einmal die Vielfalt der Nervensysteme verschiedener Vertreter der Wirbeltiergruppen vor Augen führen. Trotz einheitlicher Fünfgliederung sind die Gehirne unterschiedlich groß und sie sehen unterschiedlich aus. Dieses unterschiedliche Aussehen verdanken sie im wesentlichen der unterschiedlichen Ausprägung und Differenzierung der Großhirnrinde, deren Entwicklung bei niederen Säugetieren beginnt, aber schon bei Reptilien und Vögeln, also den Sauropsiden, ihren Anfang nimmt. Hoch komplex ist die Großhirnrinde unter den Säugern jedoch nicht nur bei Primaten, sondern z.B. auch bei Delphinen. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass auch stammesgeschichtlich niedere Wirbeltiere, wie Vögel, sehr komplexe Hirnstrukturen aufweisen. Es ist denkbar, dass in der Phylogenese der Großhirnrinde – von einem gemeinsamen Urahn ausgehend – zwei verschiedene Wege eingeschlagen worden sind: der eine führte zu den Säugern, der andere zu den Sauropsiden.
Damit tangieren wir einen wichtigen Punkt: gibt es überhaupt höher bzw. nieder organisierte Gehirne, oder wäre es nicht zutreffender, dass die Gehirne der Tiere – Menschen eingeschlossen – den unterschiedlichen Bedürfnissen und Zwängen der jeweiligen Art angepasst sind? Beides kann simpel oder komplex sein, wobei sich die Neurobiologen durchaus streiten, was genau man unter "komplex" zu verstehen hat, denn „intelligente Problem-Lösungen“ seitens der Natur erweisen sich häufig als geradezu erschüttend simpel, – "man" muss eben nur darauf kommen, und damit sind wir wieder bei der Frage nach dem Schöpfer oder dem Intelligenten Designer oder der Evolution.
Zurück zum Prinzip der Gliederung des ZNS. Gegliedert ist bei Vertebraten nicht nur das Gehirn, sondern auch das Rückenmark. Diese Gliederung koinzidiert mit den Körpersegmenten. So gibt es Halssegmente (Zervikalsegmente), Brustsegmente (Thorakalsegmente), Lendensegmente (Lumbalsegmente) und Kreuzbeinsegmente (Sakralsegmente). Eine Bemerkung am Rande: Wenn es um Prinzipen ging, war „Mutter Natur“ nie sehr vielseitig, sondern eher einfältig. Erwies sich ein Prinzip als erfolgreich, so wurde es für verschiedene Zwecke bei den unterschiedlichsten Lebewesen eingesetzt. Somit verdankt z.B. das Insekten-ZNS seine Gliederung einem ähnlichen morphogenetischen Prinzip – gesteuert durch sogenannte Homeobox Gene – wie das Wirbeltier-ZNS. Übrigens wussten Sie schon, dass die Genome von Fliege und Mensch bis zu 12% übereinstimmen?
Kommen wir jetzt zu den Grundfunktionen des Nervensystems. Wie schon erwähnt, bestehen sie darin, Informationen aus der Umwelt aufzunehmen, zu verarbeiten und zu verrechnen. Information kann ignoriert werden, sie kann aber auch verändert werden, sie kann bzw. muss eventuell gespeichert werden, sie kann aber auch geleitet werden, z.B. zur Muskulatur zwecks koordinierter Kontraktionen für eine Verhaltensreaktionen.
Ein kurzer Blick auf das ZNS in Zahlen. Diese habe ich für Sie aus verschiedenen Quellen ausgewählt und im Skript zusammengestellt. Lassen Sie uns ein paar Zahlen herausgreifen. Gehirne verschiedener Tierarten bestehen aus unterschiedlich vielen Neuronen. Das Gehirn des Menschen besitzt etwa 1011 Neurone, das sind wesentlich mehr Neuronen als Menschen auf dieser Welt. Das Krötenhirn besitzt vergleichsweise nur ca. 107 und das Fliegenhirn 105 Neurone. Betrachten wir jetzt die Verbindungen zwischen Neuronen. Wenn wir alle diese – in mühevoller Kleinarbeit – aneinanderknüpfen könnten, so würde sich eine Länge ergeben, die der einfachen Entfernung von der Erde bis zum Mond entspricht, nämlich 350.000 km. Dieses neuronale Verkehrsnetz ist in unserem Gehirn Raum sparend verpackt. Wir können damit erahnen, welche verschlungenen Wege Informationen teilweise das Gehirn durchlaufen müssen, um etwa eine Entscheidung zu fällen. Die Blut-Kapillaren des Blutgefäßsystems haben vergleichsweise eine Gesamtlänge von nur 560 km. Hierbei muss noch ergänzend vermerkt werden, dass wir bei der Kalkulation der neuronalen Gesamtfaserlänge nur das Gehirn und nicht das gesamte zentrale und periphere Nervengeflecht betrachtet haben. Verweilen wir noch etwas beim Vergleich zwischen Hirn und Herz, den Zentralorganen des Nervensystems bzw. Blutgefäßsystems. Historisch – auf Gedankengänge von Aristoteles zurückgreifend – hat man früher dem Herzen neben seiner Pumpfunktion eine zusätzliche Funktion zugeschrieben, die etwas mit dem Gefühl und damit letztlich auch mit unserer Seele zu tun hat. Diesen Irrglauben finden wir sprichwörtlich auch heute noch: man fühlt mit dem Herzen, ein warmherziger, herzensguter Mensch, ein Herz für Tiere, usw. „Warmhirnige“ und „hirngute“ Menschen scheint es nach diesem Konzept dagegen nicht zu geben. Das kühle Gehirn lag bezüglich seiner gefühlsmäßigen Bewertung also immer irgendwie auf Eis. Manche Menschen scheinen manchmal sogar lieber mit ihrem Bauch als mit ihrem Gehirn zu denken bzw. Entscheidungen zu treffen, obwohl jene „Bauchmenschen“ nicht einmal – wie Weinbergschnecken – ein hierfür zuständiges Bauchganglion besitzen, ... (;-) kleiner Scherz am Rande.
Hat denn unser Gehirn wirklich nur kalte berechnende und keine gefühlvollen, emotionalen Funktionen? Nein, ganz sicher nicht, das werden wir im Verlauf der Vorlesung belegen. Allein, wenn Sie in der Tabelle verfolgen, wie unterschiedlich Hirn und Herz am Genpool partizipieren, dann zeigt sich der genetische Aufwand des betreffenden Organs: zweifellos dominiert das Gehirn. Ohne Hirn – trotz funktionierendem Herzen – wären wir tot, hirntot. Allein die Großhirnrinde ist in der Fläche relativ groß, nämlich 1400 bis 1600 cm2, dies entspricht etwa zwei DinA4-Seiten. Das sieht man unserer Großhirnrinde äußerlich nicht an, denn sie ist durch Furchen und Erhebungen, sog. Sulci und Gyri, quasi zusammengeknüllt Raum sparend in unseren Schädel eingepasst.
So, jetzt widmen wir uns endlich der Neurophysiologie und beginnen mit dem wohl wichtigsten Baustein des Nervensystems, dem Neuron. Wir fragen, wie ist ein Neuron aufgebaut, aus welchen Organellen – Funktionseinheiten – besteht es? Das könnte übrigens die erste Prüfungsfrage in einer Lehramts-Zwischenprüfung oder im Vordiplom sein. Antwort: das Neuron besteht aus einem Soma, das den Zellkern als essentielles Organell umgibt. Am Soma befinden sich ein oder mehrere bäumchenartig verzweigte Dendriten; das sind faserige Strukturen, die Signale von vorgeschalteten Neuronen aufnehmen: Dendron lt. = der Baum. Weiterhin befindet sich am Soma ein Neurit; das ist der entwicklungsgeschichtlich jüngste Faserabschnitt. Der Neurit heißt Axon, sofern er Aktionspotenziale leiten kann. Das Axon liegt immer in der Einzahl vor, es beginnt am Axonhügel und kann sich in Axonkollaterale verzweigen. Neurone sind über Synapsen miteinander verschaltet. Die Synapse besteht aus der prä- und der postsynaptischen Membran; beide bilden den synaptischen Spalt. Meistens wird die präsynaptische Membran von einer Axonendigung, dem Axonendknoten, und die postsynaptische Membran von einem Dendriten gebildet: man spricht dann von einer axo-dendritischen Synapse. Es gibt aber auch axo-axonische, dendrito-dendritische und axo-somatische Synapsen. Was bedeutet das? Über die verschiedenen Dendriten gehen von vorgeschalteten Neuronen Signale in Form von elektrischen Potentialen ein. Jene werden im Soma-Bereich verarbeitet und das resultierende Ergebnis wird via Axon weitergeleitet zu nachgeschalteten Neuronen. Über Axonkollaterale kann das Signal entweder demselben Neuron wieder zugeführt werden, dann wird das Signal zum Beispiel verstärkt; es kann aber auch an andere Neurone weitergegeben werden.
Wir wollen uns jetzt mit wichtigen Funktionsstrukturen näher befassen. Das Endoplasmatische Retikulum und der in Zellkernnähe befindliche Golgi-Apparat sind Ihnen aus der Zellbiologie bereits bestens bekannt. Vor allem der Golgi-Apparat ist an der Synthese der Neurotransmitter, also jener Botenstoffe beteiligt, die die Signalübertragung an der chemischen Synapse vermitteln. Der Neurotransmitter wird in abgeschnürte Vesikel verpackt und dann im Axon in Richtung Synapse transportiert. An diesem axoplasmatischen Transport nehmen insgesamt drei Organell-Typen teil: Vesikel, Neurotubuli (auch Mikrotubuli genannt) und die Motorproteine Kinesin bzw. Dynein. Wie der Transport funktioniert, werden wir gleich in einer Animation sehen.
Sie werden jetzt sagen, solche Schema-Zeichnungen sind zwar informativ, aber sie bilden nicht die Wirklichkeit ab. Es sind vielmehr Karikaturen, an denen man viele Dinge ganz gut hervorheben und verdeutlichen kann. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie Neurone tatsächlich aussehen können. Hier sehen wir ein sog. Pyramidenneuron, das im histologischen Schnittpräparat angefärbt ist. Wie sich Neuronen anfärben lassen, werde ich Ihnen später erzählen. Wir sehen hier ein Axon, und dies hier sind jeweils Dendriten. Verglichen mit dem Schema kann man die Grundbestandteile deutlich identifizieren. Neuronen können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Hier noch ein letztes Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie reich verästelt Dendriten sein können. Wir sehen hier das Axon, das sich aufspalten kann, um seine Signale verschiedenen nachgeschalteten Neuronen zu übermitteln. Lassen Sie uns jetzt in elektronenmikroskopischen Aufnahmen die Bereiche der Synapse betrachten, die die Vesikel enthalten. Wir sehen den synaptischen Spalt, die präsynaptische Membran des vorgeschalteten Neurons, dessen Axonendknoten. Im Endknoten des Axon erkennen wir Vesikel. Ein Vesikel fusioniert gerade mit der präsynaptischen Membran, bei einem anderen kommt es nach Fusionierung zur Exozytose, also zum Ausschütten des Neurotransmitters in den synaptischen Spalt. Neurotransmitter, in dieser Darstellung nicht sichtbar, geht dann mit Rezeptoren der postsynasptischen Membran eine Bindung ein, woraufhin weitere Prozesse ausgelöst werden, die uns erst später näher interessieren sollen.
Kommen wir jetzt auf den axoplasmatischen Transports zu sprechen. Die Vesikel werden im Golgi-Apparat mit Neurotransmitter gefüllt und gelangen dann zur Synapse. Wie kommen die Vesikel von A nach B, das heißt vom Golgi-Apparat via Neurotubuli zum Axonendknoten? Das wusste man lange Zeit nicht genau. Mit Hilfe der Nano-Strukturforschung – also der Untersuchung kleinster Funktionselemente – hat man festgestellt, dass es an den Neurotubuli Motorproteine namens Kinesin gibt. Das sind kleinste bewegliche Motoren, deren Füßchen sich am Tubulin der Neurotubuli festheften, und deren Ärmchen die Vesikel greifen und diese jeweils an die Ärmchen benachbarter Kinesine weiter reichen: „Kinesin-Förderkette“. Das ganze wollen wir uns jetzt in einer Animation anschauen. Hier ist ein Neurotubulus dargestellt. Hier: Richtung Golgi-Apparat, wo die Vesikel abgeschnürt werden, und dort: Richtung Synapse. Der langsame Transport erfolgt, wie bereits beschrieben, durch Zureichen und der schnelle, in dem andere Kinesin-Typen den Vesikel umgebend mit ihren Beinchen längs des Neurotubulus kugelig rollend entlanglaufen: „Kinesin-Laufbahn“. In dieser Animation sehen Sie, wie das etwa funktioniert.
Es gibt im wesentlichen zwei Transport-Richtungen: den anterograden, zur Synapse gerichteten und den rückläufigen, retrograden, zum Golgi-Apparat gerichtet. Wenn die Vesikel an der Synapse angekommen sind und ihre Aufgabe verrichtet haben, das heißt ihre Neurotransmittermoleküle in den Spalt geschüttet haben, dann müssen sie entsorgt werden. Sie werden recycelt. Der Rücktransport erfolgt durch andere Motorproteine, namens Dynein, also mittels einer „Dynein-Förderkette“. Diese Moleküle greifen sich ganze Kompartimente von leeren Vesikeln (wie „gelbe Säcke“) und befördern sie längs der Neurotubuli zurück zum Golgi-Apparat, wo die Vesikel wieder mit Neurotransmitter gefüllt werden, und der ganze Prozess beginnt von neuem in der „Kinesin-Förderkette“ bzw. „Kinesin-Laufbahn“. Es ist aber auch durchaus möglich, dass der Recycel-Prozess bereits im Axonendknoten stattfindet. Einzelheiten dazu später in Block4.
In dieser axoplasmatischen Weise werden nicht nur Vesikel transportiert, sondern auch andere Organelle. Innerhalb der Neurotubuli können sogar gelöste Moleküle durch peristaltische Bewegungen befördert werden. Solche Transporte sind Energie-, d.h. ATP-abhängig. Wir halten an dieser Stelle fest, dass der axoplasmatische Transport jedoch nichts mit der elektrischen Erregungsleitung längs des Axon zu tun hat.
Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, wie ein Kinesin-Molekül im Verhältnis zum Vesikel tatsächlich ausschauen kann. Die natürlichen Verhältnisse sind schon ein wenig anders als in meiner grobschematischen Darstellung. Hier sehen Sie ein Kinsesin-Molekül auf der Nanoskala; es sind Moleküle, die jeweils den Vesikel, etwa in der von uns animierten Weise in Richtung Synapse, befördern.
Wir wagen jetzt folgende Schlussfolgerung: Falls tatsächlich ein Bestreben besteht, dass Neurotubuli mit Motorproteinen in Interaktion treten, so dass Bewegungen resultieren, dann müsste doch folgendes möglich sein: man isoliert Kinesin, beschichtet damit eine Glasplatte und legt isolierte Neurotubuli darauf, – und, schaut was passiert. Das haben Forscher gemacht und, siehe da, es funktioniert, wenn auch genau umgekehrt: da die Kinesine selbst keine Ortsveränderung durchführen können, werden über ihnen die Neurotubuli fortbewegt. Das Experiment, das ich hier beschreibe, klingt natürlich sehr einfach, es ist jedoch in Wirklichkeit extrem kompliziert, durchzuführen. Jenes Experiment wollen wir uns jetzt in einem kurzen Filmausschnitt ansehen.
An dieses Experiment schließen sich Fragen an, die durchaus noch nicht vollständig beantwortet werden können. Zum Beispiel, warum führen die Neurotubuli im Experiment eine gerichtete Bewegung aus, und woher wissen die Kinesin-Moleküle in dieselbe Richtung zu greifen, so dass es zu einer koordinierten Bewegung kommt? Gibt es etwa eine Art Verständigung oder Absprache unter den Kinesin-Molekülen. Im Grunde genommen ist dies eine Frage, die sich auch auf ganz anderer Ebene stellt. Sie kennen die Pantoffeltierchen, einzellige Tiere, die sich durch koordinierten Wimpernschlag fortbewegen. Auch hier stellt sich die Frage, wie verständigen sich die immens vielen Wimpern innerhalb ein und derselben Zelle untereinander, so dass es zu den wohl koordinierten Wimpernbewegungen kommt. Auch diese Frage ist noch nicht in allen Einzelheiten beantwortet.
Wir wechseln jetzt das Thema und wenden uns vom Inneren des Axon zum Äußeren, also zu dessen Zellmembran, die für die Erregungsleitung zuständig ist. Die "blanke" Membran ist dazu imstande. Schneller geht es jedoch, wenn sie in bestimmten Abständen elektrisch isoliert ist. Dazu gibt es bestimmte Gliazellen, die um das Axon herum eine Markscheide bilden. Sie sehen dies hier in schematischer Darstellung. Auf die Markscheiden-Entwicklung gehen wir später näher ein. Im peripheren Nervensystem stammt jedes Markscheidensegment jeweils von einer Gliazelle ab, die sich um das Axon herumwickelt und eine isolierende aus Lipiden bestehende Myelinschicht absondert. Sie werden sich nun fragen, wozu das ganz gut ist. Die Markscheidensegmente fördern die Erregungsleitung, genauer, sie steigern deren Geschwindigkeit. Gäbe es die Myelinschichten nicht, wäre die Erregungsausbreitung längs des Axon relativ langsam. Erst durch das Myelin, genauer die Myelinsegmente, kommt es zu einer schnellen sprunghaften Erregungsausbreitung, nämlich von Ranvierschem Schnürring zu Schnürring, also den Zwischenräumen zwischen den Segmenten. Die Erregung springt buchstäblich außen am Axon von Schnürring zu Schnürring. Durch die sprungweise, saltatorische, Ausbreitung kommt die schnelle Erregungsleitung zustande. Patienten mit Multipler Sklerose leiden an einer autoimmun-bedingten degenerativen Abnahme der Markscheiden.
Wie wichtig das Myelin ist, mögen Sie zum Beispiel den durchaus unterschiedlich schnellen Denkprozessen von jungen Leuten im Vergleich zu älteren Herrschaften entnehmen. Einfache Frage: warum haben die Alten oft eine lange Leitung, und warum sind die Jungen im Denken häufig schneller? Das hängt unter anderem mit dem Myelin zusammen. Während des Alters schrumpfen die Neurone und es kommt zu Beeinträchtigungen der Markscheide; sie wird schlicht und einfach dünner und damit die Erregungsleitung langsamer. Wenn die Markscheide nicht mehr optimal ausgebildet ist, wird die Erregungsleitung innerhalb des Nervensystems langsamer.
Dass ältere Menschen langsamer und vergesslicher werden, hängt jedoch nicht damit zusammen – was heute fälschlicherweise zum Teil noch in Lehrbüchern steht – dass sozusagen von der Wiege bis zur Bahre ein massives Absterben von Neuronen stattfindet. Die Anzahl der Neurone nimmt altersbedingt zwar ab, aber bei weitem nicht so stark, wie früher angenommen. Das altersbedingte Absterben von Neuronen birgt aber durchaus einen Vorteil. Warum? Mit dem Sammeln von Erfahrungen werden stets neue axonale Verknüpfungen zwischen den Neuronen hergestellt: Keine neue Erfahrung – und damit Wissen – ohne neue synaptische Verknüpfungen. Mit dem Alter vernetzen sich die Neurone zunehmend, und Vernetzung heißt Bildung von Langzeitinformationen. Da nun in unserem Großhirn ständiger Raummangel herrscht, machen die sterbenden Neuronen neuen Verknüpfungen buchstäblich den Weg frei.
Die Chinesen haben durchaus Recht, wenn sie die Weisheit der Alten ehren, denn alte Gehirne sind von der Struktur und der Funktion her kostbar vernetzt. Ein altes Gehirn mag zwar relativ langsam sein, aber es ist erfahrener, da es hochgradig vernetzt ist. Ich sage einmal: es ist besser ein Gehirn zu besitzen, das wenige hochgradig vernetzte Neurone besitzt, als ein Hirn mit sehr vielen Neuronen, die nur schwach vernetzt sind. Sie, meine sehr verehrten jungen Damen und Herren mit neuronenreichen Gehirnen haben die Chance, Ihre Gehirne durch Erfahrungen, die Sie z.B. während Ihres Studiums machen – etwa in dieser Vorlesung – so stark wie nötig zu vernetzen, und es dadurch zu Spitzenleistungen zu bringen, die entweder mit einer guten Berufsaussicht oder gar mit dem Nobelpreis belohnt werden.
Übrigens, ich werde mich auch weiterhin bemühen, den teilweise vielleicht etwas trocken anmutenden Stoff der Vorlesung durch Praxis-relevante Hinweise zu beleben.
Zurück zur Markscheide. Jetzt wollen wir schauen, wie sie wirklich aussieht. Hier ein histologisches Bild. Wir sehen dort einen Ranvierschen Schnürring, angrenzend das Myelin der Markscheide, und dies hier ist das Axon. Das hier sind elektronenmikroskopische Aufnahmen; dort kann man die Details natürlich besser erkennen. Wir sehen hier den Bereich des Schürrings, also jene Stelle, an der das Axon via Erregungsleitung jeweils erregt wird, und dort die Markscheide. Dies hier wäre das blanke Axon. Wir halten fest: ein myelinisiertes Axon verdankt seinen Aufbau zwei verschiedenen Komponenten, zum einen des Neurons und zum anderen eines bestimmten Typs von Gliazellen. Es handelt sich dabei nur um ein Beispiel für Interaktionen zwischen Neuroglia und Neuronen. Auf die Myelinisierung und die Erregungsleitung kommen wir in einem späteren Vorlesungsblock noch genauer zu sprechen.
Wenden wir uns jetzt der Frage zu: wie entsteht das Nervensystem der Wirbeltiere in der Ontogenese? In diesem Zusammenhang darf ich auf die Spezial-Vorlesung über Entwicklungsbiologie hinweisen. Jener möchte ich keineswegs vorgreifen, sondern lediglich auf das, was unseren Stoff betrifft, eingehen. Sie wissen aus der Zoologie-Vorlesung, dass das Leben gewissermaßen mit einer Blastula beginnt, bestehend aus Ektoderm und Entoderm. Hier ist ein ektodermaler Ausschnitt dargestellt, und wir wollen jetzt sehen, wie durch Induktion die so genannte Neuralplatte, als Produkt des Ektoderm, entsteht. Wir müssen uns nun vorstellen, dass im nächsten Schritt, im Neurula-Stadium, sich die Neuralplatte anfängt einzustülpen, man spricht auch von Invagination. Lassen Sie uns diesen Prozess in einer Animation schematisch verfolgen. Jetzt beginnt sich, das Neuralrohr zu bilden. Sie sehen hier das seitliche Ektoderm, das ganze wird umschlossen, und sie sehen hier die Neuralfalten. Wir fokussieren jetzt unser Augenmerk auf das Neuralrohr als Vorstufe des ZNS bestehend aus Gehirn und Rückenmark, und hier auf die Neuralleisten. Wir sehen hier ein weiteres Stadium, dort ist die Neuralplatte bereits zum Neuralrohr geschlossen, und sie erkennen jetzt hier die Neuralleisten. Aus dem Neuralrohr und den Neuralleisten entstehen dann bestimmte Zellen.
Bevor wir jedoch darauf näher eingehen, wollen wir uns zunächst im Zeitraffer anschauen, wie beim natürlichen Objekt, einem Axolotl, das Neuralrohr entsteht. Sie sehen hier das Stadium der Invagination, hier die Neuralfalten, dort entsteht das spätere Gehirn und dort das Rückenmark. Hier ein weiteres Stadium, späteres Gehirn und Rückenmark bereits weiter fortgeschritten; hier noch ein weiters Stadium; das Neuralrohr hat sich bereits geschlossen.
Jetzt haben wir endlich die Grundlagen gelegt, um uns der Frage zuzuwenden, welche Zelltypen während der Neurogenese in der Ontogenese zum einen aus dem Neuralrohr und welche zum anderen aus der Neuralleiste entstehen. Zur ersten Frage: Aus dem Neuralrohr entstehen neuronale Stammzellen, die sich durch Teilung vermehren. Aus einem Teil dieser neuen Zellgeneration entstehen Vorläuferzellen, sog. Blasten: das eine sind die Neuroblasten und das andere die Glioblasten. Die Neuroblasten differenzieren sich zu Neuronen bestehend aus Soma, Dendriten und Neurit. Zuerst bildet sich am Soma der Neurit, danach der/die Dendrit(en). Die Glioblasten differenzieren sich zu Gliazellen, und zwar zu verschiedene Typen. Mit diesen Zellen konnte man im 19. Jh. relativ wenig anfangen. Man stellte lediglich fest, dass Neurone kittartig eingebettet sind in Nachbarschaft eines anderen Zelltyps, daher der Name Glia = Kitt. Inzwischen weiß man, dass Glia alles andere als nur Kitt ist, sondern, dass Gliazellen immens wichtige, und zwar ganz unterschiedliche Funktionen für die Neuronen und damit auch für das Funktionieren des Nervensystems erfüllen.
So gibt es zum Beispiel Hortega-Zellen mit Ernährungsfunktion. Das sind gewissermaßen Gouvernantenzellen, die sich stets in der Nähe von Neuronen aufhalten und jene versorgen, ja sie am Leben erhalten. Denn – wie Sie wissen – Neurone sind sterblich! Ganz wichtig ist, dass diese Hortegazellen Neurone mit Kationen und Anionen ausstatten, also dafür sorgen, dass der für die Bioelektrizität und die Erregungsleitung der Neurone erforderliche Ionenhaushalt aufrecht erhalten wird.
Weiterhin gibt es radiale Gliazellen. Diese, müssen Sie sich vorstellen, haben zur Aufgabe, im jungen sich entwickelnden Nervensystem Leitstrukturen für die sich amöboid bewegenden Neuroblasten zu bilden. Sie stellen eine Art Gerüst für die spätere Anordnung der Neuronen zur Verfügung, also für deren Neuroarchitektur. Dieses Gerüst ist radial angeordnet; daher der Name radiale Gliazellen. Bei diesen Leitstrukturen handelt es sich natürlich nicht um Axone; Gliazellen haben keine Axone. Sobald sich die Neuronen an der Leitstruktur orientiert und ihren endgültigen Ort gefunden haben, werden die radialen Gliazellen nicht mehr gebraucht und abgebaut. Dies geschieht durch Apoptose, also programmierten Zelltod; der Rest vom Gerüst wird durch Mikrogliazellen entsorgt.
Es gibt einen weiteren wichtigen Typ von Gliazellen, das sind die Astrocyten. Sie bilden die Blut/Hirn-Schranke. Astrocyten, vermitteln hierbei filternd zwischen Blutkapillare, also Gefäßsystem, und Neuronen des Nervensystems. Wozu das Ganze? Nun, es handelt sich hierbei um eine Schutzfunktion, denn viele Stoffe, die im Blut kursieren, können für das Nervensystem durchaus schädlich sein. Die Aufgabe der Blut/Hirn-Schranke besteht in einem selektiven Filtersystem. Die Schranke lässt nur das passieren, was für Neuronen dienlich und im allgemeinen nicht schädlich ist.
Weiterhin gibt es Oligodendrogliozyten. Dieses Wort ist wirklich ein echter Zungenbrecher. Der Name bedeutet nichts anderes als, dass diese Dendron-Gliazellen aufgrund ihrer bestimmten bäumchenartigen Gestalt eine bestimmte Funktion haben. Sie besitzen nämlich Ärmchen, mit denen sie die Neuriten packen und dort pro Arm ein Markscheidensegment bilden. Es gibt also unterschiedliche Typen der Markscheidenbildung: im peripheren Nervensystem durch die Zellkörper von Gliazellen selbst, den Schwann-Zellen, und im Zentralnervensystem durch die Ärmchen der Oligodendroglia-Zellen. Darauf werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch näher zu sprechen kommen.
Soweit zu den zellulären Produkten des Neuralrohrs, die das Zentralnervensystem ZNS bilden. Welche Zelltypen liefert aber die Neuralleiste? Aus der Neuralleiste entwickeln sich alle Zellen des peripheren Nervensystems PNS und des vegetativen Nervensystems VNS. Das vegetative Nervensystem wiederum hat zwei Äste: das sympatische Nervensystem und das parasympatische Nervensystem. Aus Stammzellen der Neuralleiste entstehen Vorläuferzellen von Neuroblasten: diese entwickeln sich sich zum Beispiel zu sensorischen Spinalganglienzellen (Sinnesnervenzellen). Glioblasten dagegen entwickeln sich zu Schwann-Zellen, die die Markscheide der peripheren Axone der Spinalganglienzellen bilden.
Es gibt noch einen anderen „Gliazelltyp“. Dieser entstammt nicht der Neuralleiste, auch nicht dem Neuralrohr, sondern dem Knochenmark. Diese Zellen heißen Mikrogliazellen. Mikro-Glia ist insofern irreführend, da diese Zellen ihrer Genese nach keine Gliazellen sind; sie heißen einfach so, weil sie sich in das Gesamtkonzept der Glia als „Helfer der Neurone“ gut einfügen. Mikrogliazellen haben als Dienstleister gewissermaßen Polizei- und Müllabfuhrfunktion. Was bedeutet das? Sie zerstören schädliche Eindringlinge, sie transportieren und recyceln abgestorbene Gewebereste, und erfüllen somit auch bei der Apoptose, dem programmierten Zelltod, eine wichtige Funktion. Wenn es also zum Beispiel darum geht, das Leitgerüst der radialen Gliazellen wieder abzubauen und wegzutransportieren – nachdem es den Neuronen ihren Weg gezeigt hat -, dann greift die Mikroglia ein. Mikrogliazellen mit immunologischen Funktionen entstammen also den Monocyten des Knochenmarks; aus ihnen bilden sich Mikrogliazellen im Zentralnervensystem. Wir wollen uns hier noch einmal kurz anschauen, wie solche Monocyten aussehen, hier der Zellkörper mit dem charakteristisch geformten Zellkern.
Wir haben etwas über Zelltypen und Nervensysteme – vorwiegend von Wirbeltieren – erfahren und wissen jetzt, woher sie entwicklungsgeschichtlich stammen. Nun wollen wir uns die Frage stellen, wie sich Neurone bei der Entstehung des Nervensystems orientieren? Wer erlaubt ihnen und ihren Axonen, entlang bestimmter Wege zu wachsen und Plätze einzunehmen, die gewissermaßen „evolutionsmäßig“ für die Ontogenese vorgezeichnet sind? Alle sich entwickelnden und differenzierenden Neurone folgen einem bestimmten Plan. Das hat man zwar lange Zeit vermutet, aber nicht gewusst wie es funktioniert. Heute weiß man relativ viel darüber.
Ich möchte das an einem Entwicklungs-Schema, dass ich für Sie hier aufgezeichnet habe, näher erläutern. Wir gehen davon aus, dass wir hier zwei Neuronen haben, deren Axone ein Ziel ansteuern wollen und zwar als Bündel. Das Ziel möge dort sein. Das geschieht auf vielfältige wohl koordinierte Weise, nämlich aufgrund von Molekülen, die sie lenken, abstoßen, und ziehen, deren Aktivität genetisch nacheinander angeschaltet wird und die dann die auswachsenden Axone entsprechend leiten und zwar speziell den Axonkegel, der wie eine Spürnase versucht, sich aufgrund der verschiedenen chemischen Signale zu orientieren. So gibt es zunächst einmal hier Moleküle, die eine Axon-abweisende Wirkung haben, eine fernabweisende Wirkung sozusagen, die durch jene Minus-Zeichen symbolisiert ist. Das bringt die Neurone dazu, ihre Axone nicht in Richtung der abweisenden Moleküle wachsen zu lassen, sondern in Gegenrichtung. Dann gibt es flankierende fernabweisende Moleküle; sie signalisieren den Axonen: wachst zusammen am besten als Bündel in diese Richtung, aber nicht in jene, sonst stoßen wir euch ab. Die Axone ihrerseits sondern attraktive Moleküle ab, die das axonale Wachstum gemeinsam als Bündel fördern.
Nach diesem groben Schema wollen wir jetzt schauen, wie sich das axonische bzw. dentritische Wachstum tatsächlich vollzieht. Hier sehen wir verschiedene, in Zellkultur sich orientierende Axone und zwar mit ihrer Spürnase, denn der eigentliche Axonendknoten ist nicht fertig ausgebildet, zumal er sein nachfolgendes Neuron noch nicht gefunden hat; folglich tastet sich die Spürnase weiter. Hier sehen wir auswachsende Dendriten mit ihren Filopodien und Lamellipodien.
Ich möchte es nicht versäumen, Sie um Fragen zu bitten, sofern Sie gewisse Dinge nicht verstanden haben. Sollte mein Redefluss zu „flüssig“ sein, bitte ich Sie, keine Gelegenheit auszulassen, um diesen mit Fragen zu unterbrechen. Alles was ich beantworten kann, beantworte ich selbstverständlich gern. Keine Fragen? Soweit so gut.
Wählen wir jetzt für das neuronale Wachstum ein konkretes Beispiel: „wie werden neuronale Verknüpfungen im Rückenmark festgelegt“? Auch darüber weiß man inzwischen einiges. Dies sei der Querschnitt durch ein Rückenmark. Als Physiologe darf ich mir die Einfachheit dieser Skizze erlauben; bei einem Neuroanatomen würde im Detail sicherlich alles bizarrer und schöner, d.h. wirklichkeitsnaher aussehen. Für uns reicht der symbolische Umriss, um darauf zu sprechen zu kommen, worum es hier funktionell geht. Seitlich des Rückenmarks liegen die Spinalganglien. In den Spinalganglien befinden sich die Zellkörper von Neuronen, die Somata. Diese gehören zu Spinalganglien-Neuronen, Sinnesnervenfasern, deren sensible Endigungen zum Beispiel die Hautrezeptoren bilden. Somit gibt es Schmerzfasern, Berührungsfasern, Temperaturfasern, und es gibt auch Muskelspindelfasern, die die Dehnung des Muskels messen. Auf die Funktionen gehen wir in einem späteren Vorlesungsblock ein. Wir halten hier zunächst nur fest, dass es solche Fasern gibt. Jetzt verfolgen wir, wie der zum Rückenmark ziehende Ast eines Muskelspindelfaser-Neurons während der Entwicklung sein Motorneuron findet, das den zugeordneten Muskel innerviert. Im Rückenmark wird eine diffundierende chemische Substanz Semaphorin-III angeschaltet. Die Spürnase des Axons wird jetzt durch Chemotropismus dem chemischen Gradienten der Substanz folgen. Je stärker die Semaphorin-III-Konzentration, desto attraktiver wird für die axonale Spürnase die Umgebung des Motorneurons, um mit dessen Dendrit eine Synapse zu bilden. Sodann sind die Muskelspindelfasern mit dem Motorneuron zu einer funktionellen Einheit verbunden.
Jetzt wollen wir fragen, wie Kommissuren zustande kommen, also axonale Verbindungen der Neuronen, die von der einen Seite des Rückenmarks zur gegenüberliegenden Seite wachsen. Das ist schon etwas komplizierter; dafür sind bereits zwei verschiedene chemische Leit-Substanzen erforderlich, die nacheinander aktiv werden. Als Beispiel wählen wir ein Schmerzneuron des Rückenmarks, das von einer Schmerzfaser aktiviert wird. Dieses Schmerzneuron hat die Eigenschaft, sein Axon zur gegenüberliegenden Seite des Rückenmarks zu entsenden und dort mit einem Neuron eine Synapse zu bilden. Das Axon jenes Neurons wiederum führt zum Gehirn und signalisiert Schmerz. Wie wird das Axon des Schmerzneurons geleitet? Zunächst wird die Substanz Nephrin-2 angeschaltet. Es lockt die axonale Spürnase zu sich. Dort angekommen, wird Nephrin-2 ausgeschaltet und Nephrin-1 an der Basis des gegenüberliegenden Rückenmarks angeschaltet. Das sagt dem Axon: hier ist die Reise noch nicht zu Ende, ich muss weiter wachsen bis zur gegenüberliegenden Seite des Rückenmarks.
Wir halten abschließend zu diesem Kapitel fest. Mit der Neurogenese ist die Produktion der Neurone auch in unserem Gehirn noch keineswegs abgeschlossen:
- Im erwachsenen Gehirn entstehen ständig in bestimmten Bereichen des Telencephalon (Riechhirn) neue neuronale Vorläuferzellen, die in die Riechkolben einwandern und in Schaltkreise einbezogen werden, die möglicherweise dem Erlernen neuer Düfte dienen.
- Auch im Hippokampus, einer für Lernprozesse wichtigen Struktur des Telencephalon, entstehen täglich neuronale Vorläuferzellen und wachsen zu Neuronen heran, die einerseits für die Plastizität, Lernfähigkeit und Kreativität des Gehirns (mit-)verantwortlich sind, aber auch das Gehirn in begrenztem Maße mit "Frischzellen" versorgen können, an Orten, an denen sie gebraucht werden, weil sie absterben, z.B. nach einem Schlaganfall. Anlässlich eines Schlaganfalls soll die Zellteilungsrate im Hippokampus sogar erhöht sein. Eine gestörte Neuronenproduktion im Hippokampus, etwa unter dem Einfluss von Dauerstress, wird heute mit verschiedenen Krankheitsbildern in Zusammenhang gebracht, z.B. den endogenen Depressionen. -- Im täglichen Leben ist der Neuronennachschub positiv korreliert mit geistigem und körperlichem Training; sobald diese Aktivitäten fehlen, versiegt auch diese Neurogenese.
- Neuronale Vorläuferzellen finden sich vermutlich in fast allen Teilen des Gehirns; rätselhafterweise scheinen diese Zellen jedoch in einer Art Dornröschenschlaf zu verharren. Kein Hirnforscher weiß zur Zeit, ob, wozu und unter welchen Umständen sie aus diesem Stadium geweckt werden können. Sollte es der Medizin einmal gelingen, sie zu wecken, -- mit welchem Ziel und um welchen Preis?
Ja, nun haben wir einiges gelernt über Neuronen und gesehen, wie sich Neurone miteinander verschalten können. Wir wollen uns jetzt einmal eine Neuronenschaltung ansehen, die auch von der Ästhetik her betrachtet interessant ist: hier trifft die Bezeichnung Neuroarchitektur in ganz besonderem Maße zu. In der hier gewählten Farb-Nomenklatur sind die Somata der Neuronen hellblau, Dendriten violett und Axone grün. Hier haben wir ein Neuron dargestellt: Dendriten am Soma, der Neurit spaltet sich auf in Axonkollaterale, und das, was sich hier so schnell ausbreitet, sind Aktionspotentiale also elektrische Entladungen. Das hat nichts mit dem relativ langsamen axoplasmatischem Transport zu tun, der ja dazu da ist, Neurotransmitter für die Signalübertragung auf das nachgeschaltete Neuron bereitzustellen. Längs der Axonmembran werden elektrische Impulse geleitet.
In der hier betrachteten Neuronenschaltung aus der Kleinhinrrinde gibt es sehr unterschiedlich gestaltete Neurone. Das Axon dieses Neurons spaltet sich auf in zwei Axonkollaterale. Sie sehen alle gleichartig aus, verlaufen zueinander parallel und tragen in ihrer Gesamtheit als sog. Parallelfasern zur Architektur bei. Wir sehen dort einen ganz anderen Neuronen-Typ, dessen Dendriten bäumchenartig mit den Parallelfasern in synaptischem Kontakt stehen. Wozu das Ganze funktionell wichtig ist, werden wir in einem späteren Vorlesungsblock sehen. Ganz kurz zur Aufgabe: diese Neurone hier sind spontan aktiv. Aus dem Netzwerk werden unter bestimmten Lernbedingungen längs der Parallelfasern Signale eingespeist, die über hemmende Synapsen diese Spontanaktivität zum schweigen bringen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass ein bestimmter Lernprozess ablaufen kann. Das ganze schauen wir uns jetzt in einer Animation an: zunächst spontanaktives Neuron, hier erregende Eingänge, dort hemmendes Neuron, und abklingende Spontanaktivität.
Schließlich stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten es für die Neuroanatomen gibt, heraus zu finden, wie Neuronen miteinander verschaltet sind. Angenommen, dies hier sei das Gehirn eines Tiers, jenes dort das Rückenmark oder Bauchmark, je nach dem ob es sich um einen Tetrapoden bzw. Arthropoden handelt. Hier sei ein Neuronenareal A, dort ein Neuronenareal B, und ich möchte wissen, ob Neuronen aus A ihr Axon nach B entsenden. Das kann für einen Neurobiologen eminent wichtig sein. Zur Beantwortung der Frage gibt es verschiedene Techniken: Ich möchte Ihnen eine Technik schematisch erläutern, die Sie danach sehr illustrativ in einer Animation verfolgen können. Also, man nehme eine hauchdünne Mikropipette und fülle sie mit einem bestimmten Farbstoff, z.B. Procion-Yellow. Die Mikropipette lässt sich mit Hilfe eines Elektrodenziehgeräts so dünn ausziehen, dass man den Farbstoff in den Zellkörper eines Neurons aus A, das nur wenige µm dick ist, injizieren kann. Diese Prozedur wird mit Hilfe eines Mikromanipulators durchgeführt. Wenn ich jetzt nach Injektion dieses Markers in Neurone des Areal A anschließend in Areal B angefärbte Axonendknoten finde, später in einem histologischen Schnittpräparat, so kann daraus geschlossen werden, das Neurone aus A ihre Axone nach B entsenden; der Marker selbst wird mit dem anterograden axoplasmatischen Transport befördert.
Eine andere Frage erfordert die Anwendung einer anderen Technik: Gesetzt den Fall, wir wollen unbedingt wissen, aus welchem Bereich des Gehirns das Areal B innerviert wird. Das bedeutet, wir haben hier unsere hypothetische Neuronenschaltung und werden jetzt in die vermeintliche Zielregion einen Marker injizieren, z.B. Meerrettichperoxidase. Trifft die Hypothese zu, dann wird der Marker von den Axonendknoten der Ursprungsregion aufgenommen und mit dem retrograden axoplasmatischen Transport in die jeweiligen Zellkörpern transportiert. Wenn ich also nach Injektion eines Markers im Areal B Somata in Areal A finde, die als Folge dieser Prozedur markiert sind, dann ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.
Sie sehen, wie hier verschiedene Aspekte der Grundlagenforschung ineinandergreifen. Einerseits erforschen wir den axoplasmatischen Transport, anterograd vermittelt durch Kinesin bzw. retrograd vermittelt durch Dynein; andererseits machen wir uns beide Transportwege zu Nutze zwecks Aufklärung von Neuronenschaltungen.
Wir steigern jetzt den Schwierigkeitsgrad unserer Fragen, quasi fast ins Unermessliche, und wollen untersuchen, ob Neurone eines Areals A bzw. B ihre Axone nach D oder F entsenden und, ob Axonkollaterale von Neuronen eines Areals C nach D und F ziehen. Klärung ergibt die retrograde Doppelfärbe-Technik. Wir verwenden zwei Markierungsstoffe, die in verschiedenen Wellenbereichen des Farbspektrums fluoreszieren. Substanz Evan’s-Blue applizieren wir in Areal D und DAPI-Primulin in F. Wenn bei entsprechender Filterwahl Evan’s-Blue in A und DAPI-Primulin in B nachweisbar ist, dann entsenden jene Neurone aus dem betreffenden Areal ihr Axon nach D bzw. F. Wenn wir jedoch bei entsprechender Filterwahl Zellkörper in Areal C finden, in denen beide Markierungsstoffe nachweisbar sind, dann kann daraus geschlossen werden, dass jene ihre Axonkollaterale nach D und F entsenden.
Abschließend fragen wir, wie man Aktivität im Gehirn des Menschen untersuchen kann, ohne ihn dabei zu beeinträchtigen. Solch eine non-invasive Methode bietet die Positronen Emissions Tomographie, abgekürzt PET. Nun, wir kennen jene Röhren, in die man zwecks Aufnahme eines Computer-Tomogramms CT hineingeschoben wird, so dass im Grunde genommen die Strukturen des ganzen menschlichen Körpers schichtförmig in verschiedenen Ebenen sichtbar gemacht werden können. Was die Darstellung der Hirnaktivität betrifft, bedient man sich der Blutzirkulation. Der Blutfluss ist immer dort im Gehirn am stärksten, wo die neuronale Aktivität am höchsten ist. Das hängt mit dem lokalen Bedarf an Glukose und Sauerstoff zusammen. Glukose in Kombination mit O2 sorgt gewissermaßen für den Treibstoff der Nervenzellen. Wenn ich 15O in die Blutbahn bringe, also Sauerstoff mit radioaktivem Sauerstoff gemischt wird, dann werden Positronen ausgesandt, die in Rekombination mit Elektronen des Hirngewebes Energie in Form von Gammastrahlen aussenden. Die Gammastrahlung wird dort besonders stark sein, wo Neuronen besonders aktiv sind. Gammastrahlen lassen sich mit Hilfe von Detektoren erfassen und auswerten, so dass man Aktivitätsbilder des Gehirns erhält. Wir wollen uns an einigen Beispielen ansehen, wie das aussieht. Die Aktivität wird in Graustufen erfasst und diese wiederum werden in sog. Falschfarben wiedergegeben, so dass man über die Aktivitätsverteilung einen besseren Eindruck gewinnt. Das ganze lässt sich natürlich zusätzlich quantitativ auswerten.
Betrachten wir als Beispiel die Gehirne von Patienten, die unter verschiedenen Formen der Demenz leiden, hier in einem frühen AIDS-Stadium, dort in einem fortgeschrittenen Stadium bzw. im Endstadium: die Aktivität wird zunehmend schwächer, wobei gleichzeitig Hirnsubstanz stark reduziert wird. Bei einem anderen Patienten mit Alzheimerscher Krankheit sehen wir entsprechendes. Hier ist ein relativ frühes Stadium, in dem die Demenz kaum ausgebrochen ist, sich langsam anbahnt, und wir sehen dort bei dem selben Patienten ein schweres fortgeschrittenes Stadium.
Es gibt eine weitere Möglichkeit, regionale cerebrale Aktivität zu untersuchen, die anhand des Glucosebedarfs den Energie-Metabolismus abbildet. Mittels Glucose wird ATP gewonnen, übrig bleiben CO2 und H2O. Diese invasive Methode ist vor allem für Tiere mit kleinen Gehirnen geeignet, z.B. Erdkröten. Es ist eine ganz interessante Technik, diese Traubenzuckertechnik. Man verwendet hier eine der Glukose analoge Substanz 14C-2-Desoxiglukose, abgekürzt 14C-2DG. Sie gelangt zu den Neuronen – über dieselben Carrier-Mechanismen wie Glukose – vermittelt durch die Blut-Hirnschranke, also via Astrozyten. Neuronen verwechseln 14C-2DG mit Glukose; 14C-2DG wird metabolisiert bis zum 14C-2DG-6-Phosphat; spätestens an dieser Stelle wird der Irrtum erkannt und der Abbau gestoppt. Damit reichert sich 14C-2DG-6-Phosphat im Neuron an; folglich steigt im Neuron die Radioaktivität mit dessen elektrophysiologischer Aktivität. Jene lässt sich autoradiografisch darstellen in histologischen Hirnschnitten.
Hier ist ein Beispiel, in dem einer Kröte eine Weile lang eine Beuteattrappe wiederholt gezeigt worden ist, nach der sie fortwährend schnappte. Im Querschnitt durch das Mittelhirndach zeigt dieses Farb-codierte autoradiographische Bild ein spezifisches Aktivitätsmuster. Das beweist, dass bestimmte Bereiche des Mittelhirndachs während des Schnappens besonders stark aktiv sind.
Das war’s für Block1, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Block2: Bioelektrizität
Historisches; Ruhepotential (Henderson, Nernst, Goldmann); Fließgleichgewichte; Carrier-Systeme; Membranzustände; Ionenkanäle; Aktionspotenzial
_______________________________________
vgl. Abbildungen Block 2
Fragen zu Block 2
• Wer hat zur Entdeckung bioelektrischer Vorgänge an Nervenzellmembranen entscheidend beigetragen?
• Wie läßt sich das Ruhepotenzial der Membran eines Neurons direkt messen?
• Diffusionspotenzial: Wie entsteht ein Potenzialunterschied aufgrund verschiedener Ionen-Wanderungsgeschwindigkeiten?
• Wie kann man das Membran-Ruhepotenzial von einem Diffusionspotenzial mathematisch ableiten?
• Welche Ionenströme sind am Zustandekommen des Ruhepotenzials hauptsächlich beteiligt?
• Welche Ladungszustände lassen sich an der Zellmembran unterscheiden?
• Wie unterscheiden sich die verschiedenen Membranabschnitte hinsichtlich Ionenpermeabilität und Potenzialbildung?
• Worin unterscheiden sich Ionenkanäle?
• Wie hält ein Neuron Ionengradienten aufrecht?
• Über welche Kausalkette induziert ein Thrombus einen Schlaganfall?
• Welche Ionenströme bestimmen den Verlauf des Aktionspotenzials AP?
• Wie ändern sich die Na+/K+ Membran-Durchlässigkeiten im Verlauf eines AP?
• Welchen Prozess beschreibt der Hodgkin-Zyklus?
• Warum "lohnt sich" ein Besuch in einem Fugu-Restaurant?
• Ethanol und K+ Kanal: Warum werden wir betrunken?
• Aktivitätszustände des Na+ Kanals: Warum hält die durch Na+ Einstrom ausgelöste Depolarisation während des AP nicht an?
• Was sollte man über das Aktionspotenzial wissen?
.
Meine Damen und Herren,
zunächst ein paar Worte in eigener Sache. Wie Sie bemerkt haben, verteile ich zu Beginn jeder Vorlesung ein Skript, das die wesentlichen Schemata der projizierten Folien enthält. Anmerkungen und Notizen, die Ihnen wichtig erscheinen, werden Sie selber hinzufügen, und wenn Sie Buntstifte zur Hand nehmen und einiges farblich kennzeichnen, dann erhalten Sie ein individuelles, recht informatives Kompendium, das kein Lehrbuch ersetzen kann. Sie werden ferner feststellen, dass im Skript Fragen aufgelistet sind, die sich am Inhalt des jeweiligen Vorlesungsblocks orientieren. Es sind Fragen, die auch in Prüfungen auftauchen können. Auf die Internetadresse:
http://www.joerg-peter-ewert.de
unter der Sie auch die wichtigsten Original-Folien nebst Original-Text dieser Vorlesung finden, hatte ich ja bereits hingewiesen.
Wir kommen jetzt zu Block2 „Bioelektrizität“. Wie der Name sagt hat Bioelektrizität etwas mit Strom zu tun. „Bio“ bedeutet Natur/Leben, es geht also um natürlichen Strom, der lebensnotwendig ist. Bioelektrische Prozesse finden in unterschiedlicher Ausprägung längs aller Membranen lebender Zellen statt, ob Einzeller, Pflanzenzelle, Sinneszelle, Nervenzelle, Muskelzelle, oder Elektrozyte eines Hochspannungsfisches, um ein paar Beispiele zu nennen. Die hier auftretenden Spannungen liegen etwa zwischen 60 mV bis 1000 Volt. Zweifellos nutzt das Nervensystem Strom für ganz besondere Zwecke, nämlich für die Kommunikation mit der Umwelt, also zur Informationsaufnahme, -leitung, -verarbeitung und -speicherung, aber auch für die Bewegung, z.B. die Lokomotion. Stromerzeugung in Neuronen beruht auf physiko-chemischen Prozessen, und diesen wollen wir uns heute speziell zuwenden.
Wir werden zunächst etwas Historisches über die Entdeckung der Bioelektrizität erfahren und dann fragen, wie ein Ruhepotenzial entsteht, denn die verschiedenen neuronalen Prozesse gehen alle mit unterschiedlichen Veränderungen des Ruhepotenzials einher. Wichtige Persönlichkeiten haben sich im Laufe der Jahrhunderte Gedanken gemacht, wie Potenzialunterschiede zwischen dem inneren und äußeren Elektrolyten der Nervenzellmembran zustande kommen: hierzu gehören Henderson, Nernst und Goldmann. Wir werden sehen, wie Ionen-Gleichgewichte unter Energie-Aufwand durch Carrier-Systeme aufrecht gehalten werden, damit Ruhepotenziale nicht zusammenbrechen. Wir werden verschiedene Ionenkanäle und Membranzustände kennen lernen. Eine besondere Form von Membranpotenzial ist das Aktionspotenzial. Es dient der schnellen Informationsleitung über weite Strecken, und zwar ohne Informationsverlust; bei einer Giraffe können es mehrere Meter, bei einem Dinosaurier konnten es wohl bis zu 27 m sein.
Zunächst wollen wir Konzepte derjenigen Funktionen beleuchten, die wir heute dem Gehirn zuschreiben. Wie in der vorigen Vorlesung schon erwähnt, war dies nicht immer so. In bestimmten Epochen diskutierte man, ob hierfür das Herz oder der Kopf verantwortlich ist, wobei man mit dem Kopf dem Ort des Geschehens schon recht nahe war. Die „Herzlehre“ wurde von Aristoteles 384-322 v. Chr. begründet, und sie dominierte die von seinem Zeitgenossen Herophilos favorisierte „Hirnlehre“. Tatsächlich hat sich die Herzlehre bis ins Mittelalter und zum Teil bis in unsere heutige Zeit hinein gehalten. Eigentlich sollten wir es heute besser wissen: Das Herz hält zwar – über das Kreislaufsystem – das Gehirn am Leben. Es hat jedoch herzlich wenig mit dem Denken, Entscheiden, Fühlen und überhaupt nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ein defektes Herz lässt sich durch eine Kunststoffpumpe austauschen, ohne dass die Persönlichkeit des Betroffenen verloren geht; jener kann mit dem Kunstherz – nach wie vor – ein herzensguter Mensch sein. Dennoch grüßen wir herzlich und nicht hirnlich, – also was soll’s.
Das Gehirn wird häufig mit einem Computer verglichen, sozusagen mit einem Super-Elektronengehirn. Beide verarbeiten Information und beide brauchen hierfür Strom, jedoch in sehr unterschiedlicher Weise. Das Funktionieren der Komponenten eines Computers hängt von einer zentralen Stromversorgung ab, – aus der Steckdose. Ist der Stromkreis unterbrochen, oder ein Element defekt, kommt es meist zum Absturz bzw. Totalausfall des Computers. Das Nervensystem verhält sich hierin ganz anders, denn jedes Funktions-Element – genannt Neuron – stellt den für seine Funktion erforderlichen Strom selber her. Im ZNS gibt es keinen Stromkreis. Wenn ein paar Neuronen sterben, bricht das Gehirn nicht zusammen, sondern in der Regel können dann andere Neuronen deren Funktion übernehmen. Damit ist das Gehirn wesentlich robuster gegen äußere und innere Einflüsse als der Computer.
Man muss mit dem Gehirn schon einiges anstellen, um es abstürzen zu lassen, etwa beim Boxkampf durch K(nock) O(ut). Es gibt allerdings eine – auf den ersten Blick relativ kleine – Störung, die das Gehirn jedoch überhaupt nicht verträgt: nämlich ein Thrombus, also ein Verschluss in einem Hirngefäß. Das führt zum Schlaganfall und damit zu einem sich ausbreitenden Absterben des betroffenen Hirnbereichs. Wir kommen darauf noch später näher zu sprechen.
Wie entsteht Strom im Neuron? Zur Entdeckung der Bioelektrizität gibt es eine nette Geschichte, die sich wohl folgendermaßen zugetragen haben muss, denn viele Lehrbücher bringen sie ähnlich. Für den italienischen Mediziner Luigi Galvani aus Bologna (1737-1798) waren Froschschenkel eine Delikatesse. Am 6. November 1789 hing er an seinem Metallbalkon frische Schenkel zum Trocknen auf. Plötzlich stellte er erstaunt fest, dass die Schenkel zuckten, sobald sie das Metallgitter berührten. Galvani sagte sich: aha, die Muskeln stellen Elektrizität her, die durch den Metallzaun abgeleitet wird und die Muskeln zur Kontraktion veranlasst. Alessandro Graf von Volta, ein Zeitgenosse, der Galvani nicht so recht mochte, sagte etwa: „Luigi, il mio vecchio amicio", was soviel heißt wie, ‚Lui alter Sportsfreund’ – Du magst zwar eine interessante Entdeckung gemacht haben, leider ist jedoch Deine Interpretation falsch: denn nicht der Froschschenkel bildet Strom, sondern Dein aus Kupfer und Eisen bestehender Balkonzaun bildet ein Batterie-Element – ich taufe es nach Dir ‚Galvanisches Element’; der Muskel wird sozusagen ‚galvanisch’ stimuliert, und dies löst seine Kontraktion aus.“ „Stupido correre“ – was etwa soviel heißt wie ‚dumm gelaufen’ – sagte sich Galvani, trat dann jedoch in anderen Experimenten den Beweis an, dass Muskelzellen und Nervenzellen sehr wohl Elektrizität erzeugen. Damit hatte er, eigentlich ungewollt, gleich zwei wichtige Entdeckungen gemacht: Erregung und Erregbarkeit von Nerven -und Muskelzellen, und die Geburtsstunde der Bioelektrizität hatte geschlagen. Aber auch Alessandro Graf von Volta kam nicht zu kurz, denn elektrische Spannung wurde in der Folge nach ihm in ‚Volt’ gemessen.
Wir machen jetzt historisch einen etwas größeren Sprung zu drei Zeitgenossen des 19. Jh.: dem Neurophysiologen Du Bois Reimond (1848), der erstmals Potenzialmessungen am Nervenpräparat vornahm, dem Sinnesphysiologen v.Helmholtz (1867), der die Leitungsgeschwindigkeit am Nerven messen konnte, und dem Neuroanatom Ramon y Cajal, der die Neuronenlehre aufstellte, die besagt, dass die Nervenzelle nebst ihren Fortsätzen einen Einheit, das Neuron, bildet und, dass Neurone nicht direkt miteinander als Kontinuum ineinander übergehen, sondern indirekt über Synapsen als Kontiguum in Kontakt stehen. Übrigens fand ich in meiner Encyclopaedia Britannica von 1852 – die ich 1973 in Boston auf dem Flohmarkt gekauft hatte – tatsächlich noch Zeichnungen des Nervensystems, in denen die Fasern benachbarter Nervenzellen nahtlos in einander übergehen.
Wie lässt sich das Ruhepotenzial an der Membran eines Neurons messen? Ganz einfach: man nehme eine Mikroelektrode, steche sie in das Neuron ein und messe – mit einem Oszolloskop – gegen die geerdete Außenseite des Neurons: es besteht eine Potenzialdifferenz von ca. -70 mV, d.h. die Membran ist innen negativ und außen positiv geladen. Die theoretischen Betrachtungen und Berechnungen des Ruhepotenzials verdanken wir vor allem den Forschern Henderson, Nernst und Goldmann, und hiermit werden wir uns jetzt beschäftigen.
Wie kommt Strom im Neuron zustande? Völlig anders als in einer Batterie bzw. einem Akku. An der Grenzfläche der Zellmembran bestehen Ladungsunterschiede. Verantwortlich hierfür sind Ladungsträger. Als Ladungsträger fungieren verschiedene Kationen und Anionen. Diese liegen im äußeren und inneren Elektrolyten der Membran in unterschiedlicher Verteilung und Konzentration vor.
Um generell zu verstehen, wie durch Kationen und Anionen – wir nennen sie allgemein X+ bzw. A- – in unterschiedlicher Konzentration ein Potenzialunterschied zustande kommen kann, wollen wir ein Experiment betrachten, das Henderson durchgeführt und sogar mathematisch beschrieben hat. Es geht hierbei um Diffusion; das dabei entstehende Potenzial heißt folglich Diffusionspotenzial. Wir wollen jetzt schön langsam Schritt für Schritt das Diffusionspotenzial an der Tafel ableiten. Zum Experiment: man nehme eine Küvette, fülle sie mit Wasser und teile den Wasserbereich durch eine omnipermeable Membran in zwei Kammern-I und -II. Omnipermeabel bedeutet hier nichts anderes, als dass Kationen und Anionen diese Membran in beiden Richtungen ungehindert durchqueren können. In jede Kammer wird eine Elektrode getaucht; beide Elektroden sind über ein Spannungsmessgerät – Oszilloskop – verbunden. Jetzt wird der Kammer-I Salzlösung X+A- zugesetzt; dann ist zunächst die Konzentration [X+ A-] in Kammer-I größer als in Kammer-II: wir messen zwischen beiden Kammern einen Potenzialunterschied. Wie kommt der Potenzialunterschied zustande? Durch Diffusion der X+ und A- Ionen, daher der Name Diffusionspotenzial. Und zwar beruht der Potenzialunterschied auf unterschiedlichen Wanderungsgeschwindigkeiten (Beweglichkeiten) der Kationen und Anionen; in unserem Beispiel möge X+ schneller sein als A-: vX+ > vA-. Dadurch, dass während der Diffusion die Kationen den Anionen vorauseilen, die Anionen also hinterherhinken, prägen die Kationen der Kammer-II eine positive Ladung auf. Da sich aber im Laufe der Zeit die Konzentrationsunterschiede zwischen beiden Kammern ausgleichen, kommt die Diffusion zum Stillstand und die Potenzialdifferenz geht gegen Null. Das Diffusionspotenzial ist also zeitabhängig. Na schön, werden Sie sagen, – und? Das eigentlich Faszinierende an diesem simplen Experiment ist die Möglichkeit, den Wert eines Diffusionspotenzials mathematisch formulieren zu können und das Ruhepotenzial
– als Potenzial einer lebenden Zellmembran – von dieser Formel ableiten zu können; wie einfach das geht, werden Sie gleich sehen. Zunächst zur Formel: das Diffusionspotential ED [Volt] ist abhängig von
- Konstanten: Gaskonstante R, absolute Temperatur T, Faradaykonstante F und Ionenwertigkeit z
- der Differenz der Wanderungsgeschwindigkeit v der Kationen und Anionen:
- (vX+ – vA-) , zwecks Normierung dividiert durch deren Summe (vX+ + vA-)
- der Differenz der natürlichen Logarithmen der Kationen-Konzentrationen in Kammer-I und –II, umgeformt: ln ([X+]I)/([X+]II)
Wie gesagt, das Difussionspotenzial ist zeitabhängig und kleiner als der Bruchteil eines mV gegenüber dem Ruhepotential von etwa -70 mV. Woran liegt das? Nun, die Zellmembran ist nicht omnipermeabel, sondern semipermeabel, und damit ändert sich die Henderson-Gleichung schlagartig, wie Sie gleich sehen werden.
Von der Henderson-Gleichung für das Diffusionspotenzial lässt sich nämlich sehr schön die Nernst-Gleichung für das Gleichgewichtspotenzial ableiten, das dem Membran-Ruhepotenzial im Prinzip schon recht nahe kommt.
Wir wandeln unser Kammer-Experiment jetzt insofern ab, dass wir die omnipermeable durch eine semipermeable Membran ersetzen, die Kationen passieren lässt, Anionen jedoch zurückhält. Dann ist vA- =0; berücksichtigen wir dies in der Henderson-Gleichung, dann nimmt der normierte Wert für die Differenz der Kationen/Anionen-Wanderungsgeschwindigkeiten seinen größtmöglichen Wert an, nämlich =1. In der Nernst-Gleichung ist das Gleichgewichtspotenzial EG abhängig von den genannten Konstanten und: ln [X+]I)/([X+]II). Der Name Gleichgewichtspotenzial besagt, dass ein Gleichgewicht besteht zwischen dem Konzentrationsgradienten der X+ Ionen und dem entgegengesetzt wirkenden elektrischen Gradienten. Aufgrund der Semipermeabilität der Membran ist dieses Potenzial, im Prinzip, zeitunabhängig.
Jetzt aber genug der allgemeinen Theorie. Kommen wir von der Theorie zur Praxis. Welche Ionenarten treten denn an der Membran eines Neurons in welcher Konzentration auf? Es sind K+ Ionen, die an der Membraninnenseite höher konzentriert sind als an der Außenseite; für Na+ Ionen und Cl- Ionen sind die Konzentrationsverhältnisse umgekehrt, und Eiweiß-Anionen E- befinden sich nur an der Membraninnenseite. Wie verhält es sich mit den Membran-Permeabilitäten P für diese Ionenarten? Die Membran ist am stärksten permeabel für K+ und überhaupt nicht permeabel für E-, für Cl- gering und für Na+ geringer:
PK+ > PCl- > PNa+ > PE- =0
Vernachlässigen wir einmal die Cl- und Na+ Ionen und betrachten das Nernst-Potenzial allein für K+ und E- Ionen, dann brauchen wir in der allgemeinen Form der Nernst-Gleichung nur ln ([X+])/([X+]) durch ln ([K+])/([K+]) zu ersetzen. Tatsächlich nähert sich das K+ Gleichgewichtspotenzial dem Wert des Ruhepotenzials schon recht gut, aber eben nicht genau genug.
Jetzt kommt Herr Goldmann zu Wort. Um nämlich das Membran-Ruhepotenzial vollständig und korrekt beschreiben zu können, müssen wir – nach Goldmann – auch die Membran-Permeabilitäten der Na+ und Cl- Ionen berücksichtigen. Außerdem handelt es sich immer noch um ein zeitabhängiges Potenzial, dessen Zeitunabhängigkeit durch Energieaufwand – also ATP – gesichert wird. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einem Fließgleichgewichtspotenzial.
Ich beende jetzt die Tafelarbeit, und wir wollen das soeben Besprochene in aller Gemütsruhe in einer Animation verfolgen. Ferner habe ich hier für Sie in meiner schlichten Zeichenart – sozusagen anhand eines Comic – das analoge Zustandekommen einer Spannung zwischen K+ und E- Ionen dargestellt: Herrchen [E- Ion] führt Hündchen [K+ Ion] an der Leine spazieren; Hündchen verschwindet in einem Kellerloch, das sich als teildurchlässig, d.h. für Herrchen als undurchlässig erweist, so dass Hündchen kräftig zieht [Spannung zwischen E- und K+]. Sie werden mir diese grobe Zeichnung verzeihen; ernsthaft, eigentlich wollte ich Kunst studieren, jetzt wissen Sie warum ich das mir und anderen nicht angetan habe.
Das Ruhepotenzial bildet bei allen neurogenen Zellen – Sinneszellen, Nervenzellen, Muskelzellen – sozusagen das Ausgangspotenzial oder besser: Bezugspotenzial. Die Antworten der neurogenen Zellen sind mit Änderungen des Ruhepotenzials verbunden. Ausschlaggebend ist also nicht die Nulllinie, sondern der Wert des Ruhepotenzials. Das Membranpotenzial kann somit verschiedene Zustände einnehmen. Dies hier das wäre die Nulllinie; dort eingetragen ist der Wert für das Ruhepotenzial mit -70 mV, und damit etwa in der Größenordnung für die meisten Neurone; bei der Membran des quergestreiften Muskels ist das Ruhepotenzial etwas größer.
Im Ruhezustand ist die Membran also „polarisiert“ für bestimmte Ionenarten, wie wir gesehen haben. Wenn jetzt durch bestimmte Prozesse die Membran ihre semipermeablen Eigenschaften verändert, z.B. in der Weise, dass sie für Na+ Ionen wesentlich durchlässiger wird als für K+ Ionen – unter welchen Bedingungen das geschehen kann, werden wir gleich sehen – dann verringert sich die Potenzialdifferenz als Folge des Na+ Ioneneinstroms, und die Membran geht aus ihrem Ruhezustand in den Zustand der Erregung über: dann befindet sie sich im Zustand der Depolarisation. Wenn die Membran aufgrund veränderter Permeabilitätsverhältnisse wesentlich durchlässiger wird für K+ Ionen als für Na+ Ionen (also weitaus K+ permeabler als im Ruhezustand), dann vergrößert sich die Potenzialdifferenz als Folge des K+ Ionenausstroms, und die Membran geht über in den Zustand der Hemmung: wir sprechen dann von Hyperpolarisation. Diese Zuordnungen – Polarisation/Ruhepotenzial, Depolarisation/Erregungspotenzial, Hyperpolarisation/Hemmungspotenzial – wollen wir uns merken, denn wir werden auf diese Begriffe immer wieder stoßen.
Wir haben die ganze Zeit mit großer Selbstverständlichkeit von Permeabilität, Semipermeabilität und Änderung der Semipermeabilität gesprochen, ohne zu spezifizieren, worauf die Ionen-Permeabilität eigentlich beruht. Verantwortlich hierfür sind Ionenkanäle. Es gibt passive Ionenkanäle in unterschiedlicher Dichte; jene sind – über die gesamte Membran des Neurons verteilt – für das Ruhepotenzial verantwortlich: so ist z.B. die K+ Kanaldichte größer als die Na+ Kanaldichte. Weiterhin gibt es aktive Ionenkanäle: solche, die durch Reize rezeptorisch gesteuert werden, solche, die durch die Membranspannung elektrisch gesteuert werden bzw. solche, die durch Neurotransmitter chemisch gesteuert werden. Die verschiedenen aktiven Ionenkanäle allerdings findet man nur in bestimmten Membranabschnitten eines Neurons bzw. einer Sinnes(nerven)zelle. Die verschiedenen Ionenkanaltypen habe ich in der Folie durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Wir werden ihre Funktion später kennen lernen.
Als Beispiel wählen wir verschiedene Abschnitte einer chemischen Sinnesnervenzelle mit einem nachgeschalteten Neuron und schauen, welche Art Potenziale – durch die Beteiligung welcher Ionenkanäle – dort jeweils entstehen können. Die Abschnitte haben wir bereits kennen gelernt: rezeptorischer Dendrit, Soma, Axon, Axonendknoten, Synapse.
Schauen wir uns jetzt die verschiedenen Potenzialverläufe – von der Reizung bis zur Signalübertragung – in einer Animation an: Die Rezeptoren nehmen als Reiz ein Duftmolekül auf und bewirken daraufhin die Öffnung von Na+ Kanälen; das sind also reizgesteuerte Na+ Kanäle. Infolge des Na+ Einstroms wird die Membran definitionsgemäß depolarisiert, d.h. erregt. Die zugeordnete Potenzialänderung heißt Rezeptorpotenzial. Das Rezeptorpotezial breitet sich über Dendrit und Soma unter leichtem Verlust seiner Amplitude aus bis dorthin, wo das Axon beginnt, zum Axonhügel. Die Axonmembran hat eine besondere Eigenschaft; sie besitzt nämlich spannungsgesteuerte Na+ und K+ Kanäle. Ist die Spannung des Rezeptorpotenzials hoch genug, überschwellig, dann entsteht ein Aktionspotenzial, d.h. ein Nervenimpuls: eine innerhalb von 1-2 ms sich vollziehende Potenzialänderung, deren Eigenschaft darin besteht, sich mit konstanter Stärke (Amplitude) – dem Abbrennen einer Zündschnur vergleichbar – längs des Axon bis zum Axonendknoten auszubreiten. Wie ein Nervenimpuls=Aktionspotenzial zustande kommt, wollen wir später sehen. Seitlich des Axonendknoten gibt es zusätzlich einen weiteren Typ spannungsgesteuerter Ionenkänale, nämlich Ca2+ Kanäle. Sie werden durch die Spannung des Aktionspotenzials geöffnet; als Folge der relativ hohen Ca2+ Konzentration im äußeren Elektrolyten strömen Ca2+ Ionen in den Axonendknoten. Der Anstieg der Ca2+ Ionen-Konzentration im Knoten bildet für die Vesikel das Signal, mit der präsynaptischen Membran zu fusionieren und ihren Neurotransmitter in den synaptischen Spalt zu entlassen; Transmitteroleküle docken an Rezeptoren der postsynaptischen Membran an und können – je nach Transmitter- bzw. Rezeptortyp – die Öffnung eines Na+ Kanals veranlassen; als Folge des Na+ Ionen Einstroms geht das Ruhepotenzial der postsynaptischen Membran in den Zustand der Depolarisation über; dieses Synapsenpotenzial heißt erregendes=exzitatorisches postsynaptisches Potenzial EPSP. An der postsynaptischen Membran gibt es also chemisch gesteuerte Ionenkanäle, und zwar nicht nur für Na+, sondern je nach Synapsen-und Transmittertyp für K+ oder Cl- Ionen. Ein K+ Ausstrom bzw. Cl- Einstrom führt zur Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran; dieses Synapsenpotenzial heißt hemmendes=inhibitorisches postsynaptisches Potenzial IPSP. In dieser Folie habe ich die verschiedenen Ionenkanäle, Ionenpermeabilitäten und Potenzialverläufe übersichtlich dargestellt.
Ich gehe einmal davon aus, dass die Sache soweit plausibel und verständlich ist. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, meinen Redefluss zu unterbrechen. Also, wie ich sehe, keinerlei Fragen; schließlich gebe ich mir ja auch alle Mühe, diese Zusammenhänge so anschaulich wie möglich darzustellen.
Wie bereits versprochen, wollen wir jetzt klären, wie die Ionenkanäle der Zellmembran eigentlich aussehen. Zunächst zur Zellmembran selbst. Sie besteht im Wesentlichen aus einer Lipid-Doppelschicht mit hydrophilen mit hydrophoben Gruppen, wobei die hydrophoben einander zugewandt sind, während die hydrophilen die Membran innen und außen bedecken. Abschnittsweise ist die Lipid-Doppelschicht von Proteinstücken und Kanalproteinen, sog. Tunnelproteinen, durchsetzt. Jene also bilden die Ionenkanäle. Betrachten wir zunächst verschiedene aktive Ionenkanaltypen. Ein spannungsgesteuerter Na+ Kanal könnte etwa so aussehen wie hier dargestellt. Solche Kanäle haben innere und äußere Tore, die je nach Membranspannung geöffnet oder geschlossen werden können. Ist die Membran depolarisiert, werden die Tore geöffnet und für Na+ Ionen permeabel, so dass Na+ Ionen ihrem Konzentrationsgefälle folgend nach innen diffundieren und an der Axonmembran zur Entstehung eines Aktionspotenzials führen, denn wir erinnern uns: spannungsgesteuerte Ionenkanäle gibt es im Axonbereich. Betrachten wir jetzt einen chemisch gesteuerten Ionenkanal. Hier befinden sich außen am Tunnelprotein Rezeptorproteine, an die Neurotransmitter-Moleküle andocken und den Ionenkanal für kurze Zeit öffnen. Während dieser Zeit können z.B. Na+ Ionen nach innen diffundieren und zur Ausbildung eines erregenden Synapsenpotenzials führen, denn chemisch gesteuerte Ionenkanäle finden wir im Synapsenbereich. Betrachten wir jetzt zum Vergleich einen passiven K+ Kanal. Das Tunnelprotein besitzt keinerlei Verschlussutensilien; der Kanal ist daher immer geöffnet, so dass K+ Ionen den Kanal prinzipiell nach außen durchqueren könnten, jedoch – wie wir wissen – durch ihre Eiweißanionen-Partner der Innenseite daran gehindert werden; und diejenigen K+ Ionen, die den Grenzübertritt dennoch schaffen, werden mit Ionenpumpen – zwecks Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials – wieder zurückgepumpt.
Wie heißt es doch? ‚Der stete Tropfen höhlt den Stein’. Denn, wenn auch in geringem Ausmaß – dafür aber ständig – diffundieren Na+ Ionen nach innen und K+ Ionen nach außen. Schließlich würde das Ruhepotenzial zusammenbrechen. Welche Möglichkeit besteht, Ionen-Konzentrations-Gradienten, und damit das Ruhepotenzial, aufrecht zu halten? Es war wiederholt von Ionenpumpen die Rede. Was sind das eigentlich für Mechanismen? Die Antwort ist schlicht und ergreifend einfach: mit Hilfe von „Ionen-Trägern“, und das Tragen von Ionen erfordert natürlich Energie, verfügbar durch ATP. Bevor ich den Ionentransport in einer Animation veranschauliche, ein kurzer Blick auf das biochemische Wirkungsprinzip der sog. Carrier-Hypothese. In die Lipid-Doppelschicht der Zellmembran sind Proteinschichten und Trägersysteme, Carriersysteme, eingebaut. Der Hypothese nach können die Träger T unter Energieaufwand umgewandelt und enzymatisch rückverwandelt werden.
Die Aufgabe der Ionenpumpe möge nun darin bestehen, in das Zellinnere diffundiertes Na+ entgegen dessen Konzentrationsgefälle nach außen zu transportieren und, umgekehrt, aus der Zelle diffundiertes K+ entgegen dessen Konzentrationsgefälle nach innen zu transportieren. Das geschieht quasi in einem Arbeitsgang; sinnvoller weise spricht man daher auch von einer kombinierten Na+/K+ Pumpe. Der eigentliche Pfiff dieser Pumpe besteht nun darin, dass durch Bindung des betreffenden Ions an einen zugeordneten Träger jeweils ein elektroneutraler Komplex gebildet wird, der dann seinem Konzentrationsgefälle folgend die Membran durchquert und sein Ion nach außen bzw. innen abgibt. Noch mal das Ganze in Zeitlupe: Na+ wird durch T1 von der Innenseite aufgenommen und durchquert als NaT1 die Membran; an der Außenseite wird Na+ nach außen abgegeben; sodann wird T1 unter ATP zu T2 umgewandelt, das seinerseits K+ von außen aufnimmt, als KT2 nach innen diffundiert, K+ abgibt; schließlich wird T2 enzymatisch in T1 rückverwandelt, das für die Aufnahme von Na+ bereit steht; – genau.
Jetzt endlich schauen wir uns das ganze – ohne weitere Worte – in einer Animation an. Zum Schluss noch ein paar Zahlen: Neurone besitzen durchschnittlich pro um2 100 bis 200 Na+/K+ Pumpen. Bei kleinen Neuronen können insgesamt 106 Pumpen pro Neuron tätig sein. Die maximale Leistung pro Pumpe beträgt etwa 200 Na+ Ionen pro sec.
Die Energie-abhängige Na+/K+ Pumpe ist also auf ATP angewiesen. ATP wird in der Glykolyse des Glukose-Katabolismus gewonnen. Nur am Rande sei hier erwähnt, dass Muskelfasern – deren Energie-Bedarf ja allein für die Kontraktionsleistungen zweifellos sehr hoch ist – bis zu 20% ihres Stoffwechsels für die Aufrechterhaltung ihres Ruhepotenzials mittels Ionenpumpen aufwenden müssen. Das erfordert reichlich Glukose und O2, – aber auch im ZNS. Fehlt dieser Treibstoff, z.B., wenn der Kreislauf bei Herzstillstand versagt, dann wird es für das Gehirn bitter ernst: etwa 4 sec nach einem Herzstillstand können reversible Funktionsstörungen des Gehirns auftreten; nach 8 bis 12 sec tritt Verlust des Bewusstseins ein; nach 8 bis 10 min kann der Hirntod eintreten.
Aber auch, wenn bei normal funktionierendem Herzen nur lokal ein arterielles Hirngefäß durch einen Thrombus verstopft ist, dann kollabiert der umgebende Hirnbereich und es kommt zum Schlaganfall=Hirninfarkt, in dessen Verlauf eine fatale selbst zerstörerische Kettenreaktion ausgelöst wird, die letztlich zum Absterben von Hirngewebe führt. Betrachten wir einige Stationen dieser Reaktionskette: wenige Sekunden nach örtlicher Unterbrechung der arteriellen Blutversorgung – Ischämie genannt – erlischt in den durch das Gefäß unmittelbar versorgten Neuronen das Ruhepotenzial, so dass die Nerventätigkeit zum erliegen kommt. Nicht, dass das bereits schlimm genug wäre, einige Stunden später wird eine Selbsttötungsmaschinerie – Apoptose genannt – gestartet, die sich zu allem Übel im Hirngewebe ausbreitet. Wie kommt das? Neurone reagieren auf Glukose-Defizit grundsätzlich „allergisch“: sie setzen massenhaft Glutamat frei, und zwar selbst solche Neurone, die Glutamat als Neurotransmitter gar nicht verwenden. Als Folge der Glutamatfreisetzung kommt es zu einem starken Na+ Einstrom in das Neuron und damit zu einer exzessiven Membrandepolarisation, die ihrerseits einen exzessiven Ca2+ Ionen-Einstrom nach sich zieht. Die Ca2+ Ionen ihrerseits vermitteln durch NO-Synthese im Neuron die Bildung von Peroxinitrit-Radikalen, und führen damit zu oxidativem Stress. Die Lipidperoxidation erfasst die Mitochondrien und die DNA. Durch Aktivierung des Transkriptionsfaktors – Nekrosefaktor-kappa B – wird ein Signalweg angeschaltet, der zum programmierten Zelltod – Apoptose – führt. Normalerweise hält ein inhibitorisches Protein des Zytoplasmas schützend NF-kB in der inaktiven Form.
Wie kann man dem vorbeugen, und welche Sofortmaßnahmen gibt es? Risikopatienten sollten täglich 100 mg Acetylsalicylsäure ASS, also Aspirin©, zur Blutverdünnung einnehmen. Wirksamer sein soll die Kombination aus den Thrombozyten-Aggregationshemmern {ASS und Dipyridamolsein}. Zusätzlich senkt ASS die Konzentration des gerade besprochenen Transkriptionsfaktors NF-kB auf ein für die Zelle unbedenkliches Maß. Da der Anstoß der Signalkaskade, der beim Schlaganfall zum programmierten Zelltod führt, erst einige Stunden nach der Ischämie einsetzt, muss vor allem die erste Stunde therapeutisch genutzt werden: Kühlen des Kopfes reduziert die Glutamatfreisetzung. Neuerdings wird zusätzliche Verabreichung von Coffeinol – das ist Koffein in Kombination mit Ethanol – diskutiert; noch ist jedoch unklar, auf welche Weise diese Wirkstofflösung das Gehirn schützt. Im akuten Zustand empfiehlt sich auch die Einnahme von Glutamat-Antagonisten, Kalzium-Antagonisten und Radikalfängern wie den Vitaminen A, C und E.
Auf diesem Gebiet ist noch viel Grundlagenforschungstätigkeit erforderlich. Interessant ist die Tatsache, dass bei Winterschläfern, z.B. Igeln oder Fledermäusen trotz Reduktion der Hirndurchblutung auf 10% kein Schlaganfall eintritt, vermutlich infolge des Absinkens ihrer Körpertemperatur auf 2 bis 1,8°C. Diejenigen unter den Säugern, die keinen Winterschlaf halten, tolerieren dagegen bestenfalls eine Reduktion der Körpertemperatur über mehrere Wochen auf 30°C. Bekäme man heraus, welche – hormonellen – Regulationsprinzipien Winterschläfer schützen, ergäbe sich vielleicht ein neuer therapeutischer Ansatz für den Menschen. Tatsächlich hat im Jahre 2005 das Aachener Biotechnologie-Unternehmen PAION aus dem Speichel der Vampirfledermaus Desmodus rotundus einen Wirkstoff Desmoteplase isoliert und gentechnisch produziert, mit dem Schlaganfall-Patienten noch neun Stunden nach der Attacke behandelt werden können. Für Desmoteplase erhielt PAION von der US-Zulassungsbehörde den Fast-Track-Status, ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zur Behandlung von Krankheiten, für die es bisher nur wenige Behandlungsmöglichkeiten gibt.
Wir machen jetzt thematisch einen Sprung und fragen: wie genau entsteht ein Aktionspotenzial AP ? APs zu bilden, ist bekanntlich eine Spezialität des Axon. APs entstehen an der Membran des Axonhügels; von dort aus pflanzen sie sich fort bis zum Axonendknoten. Die Entstehungsweise eines AP beruht auf sequentieller Aktivierung von Na+ und K+ Kanälen, ausgelöst durch eine überschwellige Membran-Depolarisation am Axonhügel. Folglich ist zu fragen: wie ändern sich die Membranpermeabilitäten für Na+ und K+ im Verlauf eines AP? Schauen wir uns die Ionenflüsse in den Na+ und K+ Kanälen erst einmal in einer Animation an. Zunächst das Ruhepotential: PK+ > PNa+. Jetzt möge die Membran des Axonhügels überschwellig depolarisiert werden; dann wird PNa+ >> PK+ , d.h. Na+ Kanäle werden geöffnet, Na+ Ionen strömen ein, erhöhen damit die Membran-Depolarosation, was wiederum erhöhten Na+ Einstrom zur Folge hat, etc. Im Zuge dieses nach Hodgkin benannten autoregenerativen Zyklus – Hodgkin-Zyklus – erreicht das AP blitzschnell seinen Spitzenwert. Sodann werden die Na+ Kanäle inaktiviert, d.h. geschlossen und K+ Kanäle geöffnet: PNa+ =0; PK+ =max. Jetzt strömen K+ Ionen nach außen, führen also zur Repolarisation und bedingen damit die Abstiegsflanke des AP, die mangels eines autoregenerativen Prozesses flacher verläuft als die Anstiegsflanke.
Die nächste Folie, die auf den ersten Blick recht komplex aussehen mag, ist jetzt leicht zu verstehen: Hier ist wieder unser bekanntes Koordinatensystem mit Nulllinie und Ruhepotenzialwert. Die Latenzzeit ist jene Zeit, die erforderlich ist, um die Impulsschwelle zu überschreiten; sie wird umso kürzer sein, desto stärker die auslösende Membrandepolarisation am Axonhügel ist. Unmittelbar nachdem das AP seinen Spitzenwert erreicht hat, schließt sich die absolute und danach die relative Refraktärzeit an. In der absoluten können keine weiteren APs ausgelöst werden, in der relativen sind dagegen APs von geringer Amplitude generierbar. Weiterhin dargestellt ist die Na+ und die K+ Leitfähigkeit sowie die Aktivierbarkeit der Na+ Kanäle im Verlaufe des AP. Zudem kann man in dieser Folie für die verschiedenen AP-Abschnitte jeweils die unterschiedlichen Na+/K+ Permeabilitätsverhältnisse durch anklicken abrufen.
Eine der vielen interessanten Fragen im Zwischenexamen oder in der Diplom-Vorprüfung wäre die folgende: wie kommt es zu dem blitzschnellen Anstieg des AP? Antwort: der schnelle Anstieg beruht auf einem autoregenerativen Prozess. Das, was sich da autoregeneriert, wollen wir auf der nächsten Folie verfolgen: links dargestellt das Na+ Einstrom-System, rechts das K+ Ausstrom-System. Verweilen wir zunächst beim Na+ Einstrom-System:
Membrandepolarisation:
spannungsgesteuerte Na+ Kanäle öffnen sich
Na+ Einstrom
Membrandepolarisation dadurch verstärkt
mehr spannungsgesteuerte Na+ Kanäle öffnen sich
Na+ Einstrom verstärkt
etc., bis nach dem Alles-oder-Nichts Gesetz die AP-Spitze erreicht ist und die Na+ Kanäle inaktiviert werden.
Im Anschluss an diesen als Hodgkin-Zyklus bezeichneten Prozess öffnen sich die K+ Kanäle K+ Ausstrom Membran-Repolarisation und vorübergehende Hyperpolarisation.
Die Na+ bzw. K+ Kanäle können pharmakologisch beeinflusst werden. Durch Tetraethylammonium TEA wird der K+ Kanal blockiert. Die Folge ist, dass jedes AP dauerdepolarisiert wird, und das wiederum bewirkt durch erhöhten Ca2+ Einstrom in den Axonendknoten eine vehemente Vesikel-Exozytose an der Synapse.
Durch Tetrodotoxin TTX wird der Na+ Kanal spezifisch irreversibel blockiert, was dazu führt, dass APs gar nicht erst entstehen können. Die Wirkung ist ebenfalls tödlich. Tetrodotoxin ist das Neurotoxin des Kugelfisches Tetraodon oder Fugu. Fugu wiederum ist eine Spezialität asiatischer, vorwiegend der japanischen, Küche; eine Mahlzeit kostet 100 bis 200 Dollar. Allerdings dürfen nur lizenzierte Köche diese, wie Sie gleich sehen werden, tödliche Delikatesse herstellen, denn man muss bei der Zubereitung des Fisches sehr sorgfältig umgehen. Interessanterweise stammt das Gift TTX gar nicht vom Kugelfisch selbst, sondern von bestimmten Bakterien, die sich vor allem in der Haut, der Leber und in den Ovarien ansiedeln. Hauptsächlich die Ovarien müssen vom Koch beim Tranchieren mit höchster Präzision – etwa vergleichbar dem Vorgehen eines Schönheitschirurgen – entnommen werden. Auch dann bleibt für das Muskelfleisch immer noch genug TTX übrig, um alte Genießer in den 7ten Himmel lukullischer Köstlichkeit zu entführen. Denn das Köstliche am Kugelfisch ist dessen Gift TTX. Die tödliche Dosis liegt bei 1-2mg, je nach Körpergewicht des Gastes, also 1200mal tödlicher als Zyankali; dann kehrt er aus dem Himmel nicht mehr zurück. Als ich in Kyoto war, habe ich um solche Gaststätten – hier ein Foto – immer einen respektablen Bogen gemacht.
Spaß beiseite, das teuflische am Fugu ist, dass er besonders dann so gut schmecken soll, wenn die Kugelfische am meisten TTX enthalten, und das ist kurz vor bzw. während der Laichzeit der Fall; dann läuft die TTX-Produktion ihrer Bakterien sozusagen auf Hochtouren. Pro Jahr sterben in Japan ca. 100 Menschen an Fugu. In Europa sind Fugu-Restaurants verboten, auch in japanischen Spezialitätenrestaurants darf Fugu nicht angeboten werden. In Japan erhalten alte erfahrene Stammgäste zum Fugu-Gericht – vom Kellner ihres Vertrauens – in gefalteter Serviette eine Prise Kugelfisch-Gonade extra; diese Dosierung erfordert natürlich langjährige Übung und Erfahrung des Gastes: jener – sich am Limit bewegend – führt dann gerade so wenig zwischen Daumen und Zeigefinger zum Mund, dass die Zungenspitze leicht betäubt wird; das ist das Signal, innezuhalten, wenn sich der lukullische Himmel einen Spalt weit zu öffnen beginnt, gerade so weit, um wieder zurückzukehren zu können.
Es sei hier am Rande erwähnt, dass die Wirkung von Lokal- oder Leitungs-Anaesthetika, die in der Medizin verwendet werden, auf einer Blockierung von Na+ Kanälen beruht, die jedoch reversibel und damit kontrollierbar ist.
Wenn man schon seine Na+ Kanäle mit dem Verzehr von Fugu in Gefahr bringt, sollte man dazu nicht noch gleichzeitig Alkohol trinken; dann bekommen nämlich die K+ Kanäle auch noch etwas ab, so dass es für die Bildung von Aktionspotenzialen echt eng werden kann. Was aber hat Ethanol mit dem K+ Kanal zu tun? Lange Zeit hat man sich Gedanken darüber gemacht, warum wir nach kräftigem Alkoholgenuss betrunken wirken, d.h. torkeln und lallen. Nun, die Wirkungsweise des Ethanols ist eine vielfältige und keineswegs in allen ihren Einzelheiten geklärt. Kürzlich hat man allerdings folgendes herausgefunden. Da gibt es den Fadenwurm Caenorhabditis elegans, den Sie sicherlich aus der Genetik-Vorlesung kennen, denn, man möchte es nicht glauben, bis zu 50% der 20 000 Gene dieses Wurms haben ihr Gegenstück im Genom des Menschen. Um es kurz zu machen, nicht nur Menschen, sondern auch Fadenwürmer werden nach Alkoholgenuss betrunken. Beim Fadenwurm hat man nun herausgefunden gefunden, dass das mit einem Gen namens slo-1 korreliert. Dieses Gen sorgt dafür, dass unter dem Einfluss von Ethanol der K+ Kanal sich häufiger öffnet, wodurch sich plausibler weise die Ausbildung und Ausbreitung von Aktionspotentialen verlangsamt. Die resultierende Trägheit im ZNS äußert sich in Störungen der Bewegungskoordination, also der Lokomotion und Sprache: torkeln, lallen. Dem betrunkenen Fadenwurm geht es fast ebenso; zwar kann er nicht lallen, jedoch unkoordiniert torkeln. Demgegenüber zeigten sich slo-1 Knockout-Mutanten des Fadenwurms einem Doppelkorn gegenüber immun. Man hofft, dass sich hier Perspektiven eröffnen für Medikamente gegen chronische Alkoholsucht.
Ergänzend und zum Abschluss dieses Vorlesungsblocks wollen wir die drei Zustände des spannungsgesteuerten Na+ Kanals kurz beleuchten und dann noch ein paar wichtige Merkpunkte zum Aktionspotenzial zusammenfassen.
Wie diese Folie zeigt, besitzt der Na+ Kanal zwei Tore, an der Innenseite ein hinteres h-Tor und in der Mitte ein m-Tor, wobei das h-Tor die Aktivierbarkeit des m-Tors bestimmt. Wir unterscheiden drei Kanal-Zustände: (1) Während des Ruhepotenzials ist das m-Tor geschlossen und das h-Tor offen, d.h. das m-Tor ist in diesem Zustand aktiviertbar. (2) Es wird aktiviert – d.h. geöffnet – durch eine Membran-Depolarisation: Start und Aufstrich des AP im Verlauf des Hodgkin-Zyklus. (3) Ist die AP-Spitze erreicht, wird das h-Tor geschlossen, während das m-Tor noch geöffnet ist: Start der absoluten Refraktärzeit. (4) bzw. (1) Das h-Tor beginnt sich wieder zu öffnen, während sich das m-Tor schließt.
Abschließend fassen wir ein paar wesentliche Aspekte des AP zusammen; dies beinhaltet, dass während der absoluten Refraktärzeit der Na+ Kanal nicht aktivierbar ist, und dass Ionenpumpen keine Voraussetzung für die Auslösung des nächstfolgenden APs bilden, denn APs resultieren aus kleinen Ionenflüssen. Zweifellos aber führen AP-Serien zu Gradientenverschiebungen der Ionenkonzentration, die durch Ionenpumpen kompensiert werden.
Das war’s für Block2, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
_________________________________________
Block3: Erregungsleitung
Myelogenese ZNS, PNS; Dekrement; Kreisströmchen; Saltatorische Ausbreitung; Frequenz/Amplituden-Modulation, Regeneration; Querschnittslähmung, Therapie-Aussichten
_________________________________________
vgl. Abbildungen Block 3
Fragen zu Block 3:
• Worin unterscheidet sich Reizleitung von Erregungsleitung und welche Strecken können/müssen Erregungen zurücklegen?
• Was versteht man unter Erregungsausbreitung mit Dekrement und welche Vorteile haben Aktionspotenziale AP?
• Welche Vorteile hat die segmentale Ummantelung des Axons durch Markscheiden bestehend aus Myelinschichten (Myelinisierung)?
• Wie entstehen Markscheiden im peripheren Nervensystem?
• Wie entstehen Markscheiden im Zentralnervensystem?
• Wie verschieben sich Ladungen durch Kreisströmchen bei der AP-Ausbreitung?
• Welche Vorteile hat die saltatorische AP-Ausbreitung längs des myelinisierten Axons?
• Wie werden Signale kodiert und an einer exzitatorischen Synapse dekodiert?
• Wie werden Signale an einer inhibitorischen Synapse dekodiert?
• Auf welchen Prinzipien beruht AP-Frequenzkodierung?
• Können Neurone nach Verletzung regenerieren bzw. sind Neurone ersetzbar?
• Welche schnellen Sekundärschäden setzen nach einer Rückenmarksverletzung ein und welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
.
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie zu Block3 der Vorlesung. Wir wollen uns heute mit der Erregungsleitung beschäftigen und halten noch einmal fest, dass Erregungsleitung überhaupt nichts mit Reizleitung zu tun hat, auch dann nicht, wenn es zuweilen in Lehrbüchern so steht. Das Phänomen der Reizleitung gibt es selbstverständlich auch: so werden z.B. im Mittelohr Schallwellen mittels Gehörknöchelchen vom Trommelfell zum ovalen Fenster der Kochlea geleitet.
In Block2 haben wir gesehen, wie Erregung zustande kommt und damit auch gleichzeitig erkannt, was eigentlich Erregung ist: Eine Membran-Depolarisation, die darauf beruht, dass – aus dem Zustand des Ruhepotenzials – die Na+ Ionen-Permeabilität der Zellmembran erhöht wird, was zum Na+ Einstrom in die Zelle führt. Tritt eine überschwellige Depolarisation am Axonhügel auf, so wird sie als AP mit konstanter Amplitude über weite Strecken weitergeleitet.
Der heutige Vorlesungsblock gliedert sich thematisch in verschiedene Abschnitte. Zunächst zur Erregungsleitung. Erregung=Membrandepolarisation würde sich längs der Nervenfaser ausbreiten unter Abschwächung ihrer Amplitude – d.h. mit Dekrement –, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, sich in Form von APs fortzupflanzen. Markscheiden mit ihrem Myelin ermöglichen hierbei eine besonders schnelle – sprunghafte=saltatorische – Ausbreitung. Myelin erfüllt also bei der Erregungsleitung eine wichtige Funktion. Wir vergleichen daher die Myelogenese, die Bildung der Markscheide, im zentralen und im peripheren Nervensystem. Ferner werden wir besprechen, was man unter Frequenz/Amplituden-Modulation bei Kodierungs- bzw. Dekodierungsprozessen im ZNS versteht. Schließlich werden wir uns die Frage stellen, inwieweit es Regenerationsfähigkeit im Nervensystem gibt, was für Prozesse bei Querschnittslähmung ablaufen und welche Therapieaussichten es gibt.
Beginnen wir mit den Themenkreis: Erregungsleitung, Leitungsgeschwindigkeit und Neuroglia. Hohe Leitungsgeschwindigkeit kann bei der Informationsverarbeitung -und Übermittlung im Gehirn und damit für den Grad der Intelligenz enorm wichtig sein. Von Albert Einstein trennen uns sicherlich Welten, auf jeden Fall, was Intelligenz auf einem speziellen Gebiet betrifft. Man hat sich daher immer wieder gefragt, woher es kommt, dass Einstein auf seinem Fachgebiet so spitzenmäßig war. Denn, mit der von ihm entwickelten Relativitätstheorie hat sich unsere Vorstellung vom Universum grundlegend verändert. Folglich gingen und gehen Neurophysiologen und Neuroanatomen der Frage nach, was an Einsteins Gehirn anders war als an dem eines normalen Sterblichen. Auf den ersten Blick gaben Vergleiche seines Gehirns mit den Gehirnen anderer Menschen hierüber – bis vor Kurzem – keinerlei Auskunft. Einsteins Gehirn war mit 1.230 g sogar deutlich leichter als das Durchschnittsgewicht eines männlichen Gehirns mit 1.400 g. Einstein hatte allerdings genauso viele Neuronen wie andere, so dass diese auf kleinerem Raum dichter gepackt waren und dadurch vielleicht effizienter mit einander kommunizieren konnten. Einem bestimmten "Intelligenz- Gen“ jedoch, da sind sich alle Forscher ziemlich einig, verdankte er sein Können wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
Die Untersuchungen an Einsteins Gehirn begannen damit, dass der Mediziner Dr. Thomas Harvey, der Einstein 1955 sezierte, dessen Gehirn entnommen hatte. Was daraufhin alles mit Einsteins Hirn angestellt wurde, ist höchst mysteriös und war wohl keineswegs eines Menschen und schon gar nicht des Nobelpreisträgers würdig. Es wurde buchstäblich in Einzelteile zerschnitten, jene wurden nummeriert, in Plastikbeutel verpackt und sorgfältig beschriftet. Diese Teile kursierten dann in der Welt herum, bis sie schließlich einen festen Standort gefunden hatten, wo sie in Marmeladengläsern aufbewahrt wurden.
Verlassen wir diesen makabren Teil und kommen nun zum neurobiologisch interessanten Punkt. Im Zuge wissenschaftlichen Fortschritts hat man Einsteins Gehirn aus den Einzelteilen wieder zusammensetzen und Computer-gestützt rekonstruieren können. Ein Forscherteam um Sandra Witelson – von der kanadischen McMasters-University in Hamilton – erkannte eine Auffälligkeit in Einsteins Gehirn: eine seitliche Region der Großhirnrinde – der Temporallappen – war überproportional stark entwickelt. Dort ist das mathematische Denken lokalisiert, aber auch das räumliche Vorstellungsvermögen. Bei Einstein fehlte zudem eine sonst übliche Furche in dieser Hirnregion, was auf mehrere und vor allem kürzere Nervenverbindungen hindeute. Wie Sie wissen, ist der cerebrale Cortex zwecks Oberflächenvergrößerung gefurcht, bestehend aus sog. Gyri (Erhebungen) und Sulci (Furchen). Dies bringt jedoch den Nachteil mit sich, dass der Informationsfluss zwischen zwei benachbarten Gyri verzögert wird: infolge von Umwegen beim Durchqueren der Sulci sind normalerweise entsprechend lange Axone erforderlich. Nun, bei Einstein war es so, dass gerade dort wo mathematische Probleme gelöst werden, die Furche fehlte jedoch – zugunsten sehr kurzer Verbindungen. Wir sehen also, wie wichtig offenbar kurze und damit schnelle Erregungsleitungen sein können. Ferner hat man festgestellt, dass durch das Fehlen dieser Furche bei Einstein eine dichte Überlagerung von solchen Nervennetzen möglich war, die einerseits für mathematisches Problemlösen und andererseits für räumliches Vorstellungsvermögen relevant sind. Einsteins Gehirn verfügte in besonderem Maße über die Fähigkeit der multisensorischen Interaktion und Integration. Das Interagieren von auditorischen und visuellen Nervennetzen führte bei ihm dazu, dass er visuelle Bildinformation nicht nur optisch, sondern auch akustisch wahrnehmen konnte und vice versa.
Nun haben sich Forscher diesen Bereich von Einsteins Gehirn einmal zytologisch genauer angesehen und festgestellt, dass das Verhältnis von Gliazellen zu Neuronen wesentlich größer war als bei jedem anderen bislang untersuchten Menschen. Gliazellen sind quasi die Elektriker und Gouvernanten des Nervensystems. Einige von ihnen halten die physiko-chemischen Prozesse, die der Erregungsleitung zugrunde liegen, aufrecht, indem sie die Nerven isolieren, versorgen, reparieren, usw.
Während Einsteins Spezialbegabung also u.a. darauf zurückgeführt werden könnte, dass in der für diese Begabung zuständigen Hirnregion kurze Wege für schnelle Informationsleitung zur Verfügung standen, gibt es aber auch den umgekehrten Fall, nämlich, dass Signale sehr lange Informationswege entlang sehr langer Axone zurücklegen müssen, ohne dass das irgendetwas mit Intelligenz zu tun haben hätte. Denken wir z.B. an eine Giraffe, die ich hier in meiner schlichten Form an der Tafel skizziere. Wenn die Giraffe ihr Hinterbein bewegen möchte, dann geht dieser Befehl von sog. Pyramidenzellen ihrer motorischen Großhirnrinde aus, die ihre Axone – Hirn und Halsmark durchquerend – bis zu den Motorneuronen der lumbalen Rückenmarkssegmente entsenden. Das ist eine beträchtliche Strecke, etwa bis zu 4m. So lang kann also ein Neuron sein! Wenn man bedenkt, dass sich APs längs der Axone im Rückenmark mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 80 m/s fortpflanzen können, würde es nur 1/20 s dauern, bis der Wille der Giraffe ihr Hinterbein erreicht hat. Die nächste Folie zeigt dies noch anschaulicher am Beispiel des Dinosaurier Barosaurus lentus, dessen APs vom Gehirn eine Strecke von etwa 27 m zurücklegen müssten, um sein äußerstes Schwanzende einzukrümmen, gesetzt den Fall der Saurier wollte es. Da die Erregungsleitung bei Echsen als Kaltblüter 1/3 langsamer ist als bei Säugern als Warmblütern, würde beim Saurier schon eine gute Sekunde verstreichen, bis das Signal vom Kopf zum Schwanzende gelangt ist.
Diese Betrachtungen gelten natürlich nur für jene Neuriten, die als Axone APs generieren können, zudem mit Markscheiden isoliert sind und infolgedessen eine schnelle Leitfähigkeit besitzen. Deshalb wollen wir uns jetzt zuerst einmal fragen, wie sich Erregung als Depolarisation längs einer Membran ausbreitet, die keine APs bilden kann.
Vorausschicken möchte ich einen Vergleich zwischen Nervenfaser und Kupferdraht. Eine 1m lange Nervenfaser von 1um Durchmesser besitzt etwa den gleichen elektrischen Längswiderstand wie ein 3mm starker Kupferdraht der Länge von 1,6 x 1010 km [vergleichbar dem 10fachen Abstand: Erde–Saturn]. Ein 3um starker Kupferdraht hätte den gleichen Längswiderstand bei einer Länge von einigen 1000 km.
Angenommen, wir haben hier solch eine Nervenfaser, deren Zellmembran dort erregt, d.h. depolarisiert, werden möge. Daraufhin resultiert ein Na+ Ionen-Einstrom durch die Membran, der jedoch zu keinen Aktionspotentialen führen wird, da die hier betrachtete Membran nicht elektrisch erregbar ist, also keine spannungsgesteuerte Na+ Kanäle besitzt. Ferner möge diese Membrandepolarisation der hier aufgetragenen Potenzialdifferenz (Spannungsdifferenz) entsprechen, und wir wollen jetzt verfolgen, mit welchem Amplitudenverlauf sich die Depolarisation ausbreitet. Dies geschieht längs der Nervenfaserausdehnung x gemäß der fallenden e-Funktion v=vo e-x/l ; nach einer Strecke l beträgt die Amplitude nur noch 37% ihres Ausgangswerts. Dieses dürftige Ergebnis war beim Vergleich der Nervenfaser mit einem Kupferdraht zu erwarten. Die Erregungsausbreitung erfolgt mit erheblicher Amplitudenabnahme, d.h. mit Dekrement, und büßt damit Information ein, – übrigens etwas, was HiFi-Fans überhaupt nicht lustig finden würden und daher selbst bei Kupferleitungen möglichst dicke, kurze verwenden. Zweifellos gibt es im Gehirn kleine Schaltneurone, deren Fasern so kurz sind, dass eine Leitung mit Dekrement kaum zum Tragen kommt.
Sollen jedoch in einer Nervenfaser, einem Neurit, die Erregungen (a) ohne Informationsverlust (Amplitudenverlust) und (b) möglichst schnell geleitet werden, dann muss die Faser elektrisch erregbar sein und folglich APs bilden können. Schnelle Erregungsleitung gewährleistet z.B. ein dickes Axon, je dicker desto schneller, – in Grenzen natürlich. Diesen Weg haben die Wirbellosen Tiere (Evertebraten) beschritten. Die flinken räuberischen Kraken unter den Mollusken besitzen sogar Riesenaxone, die mehrere Millimeter dick sein können. Bei den Wirbeltieren (Vertebraten) spielt die Dicke des Axons ebenfalls eine Rolle. Das allein würde jedoch im Rückenmark einer Giraffe oder eines Wals zu erheblichen Raumproblemen führen, zumal ganze Bündel von zigtausenden Axonen dort unterzubringen sind. Das Rückenmark könnte dann locker die Dicke eines Fabrikschornsteins annehmen, beim Menschen immerhin noch die Dicke eines Laternenmasts. Also, was tun? Gebraucht werden im Rückenmark hauchdünne, lange, schnell leitende Axone; aber wie? Hier finden bestimmte Gliazellen als „Elektriker“ Anwendung, indem sie das Axon abschnittsweise umwickeln und isolieren. So gibt es bestimmte Elektriker für den Innendienst im ZNS; sie nennen sich Oligodendrogliazellen, und andere für den Außendienst im PNS, genannt Schwannsche Zellen.
Lassen Sie uns jetzt am Beispiel der Schwannzellen verfolgen, wie jene dem Axon helfen, seine Leitungsgeschwindigkeit enorm zu vergrößern. Wir vergleichen hierzu ein nicht isoliertes Axon einer Krake mit einem isolierten Axon einer Katze; beide sind elektrisch erregbar, leiten also Erregungen in Form von APs ohne Dekrement, – und zwar gleich schnell. Zunächst zur Krake: wie bei allen Evertebraten ist das Axon unisoliert, die Nerven liegen bei ihr sozusagen blank. Die enorme Dicke des Axons gewährleistet die erforderliche schnelle Erregungsleitung. Demgegenüber können die Axone der Vertebraten isoliert sein; dabei hat sich ein pfiffiges Prinzip herausgebildet; als Beispiel wählen wir ein Axon aus dem Rückenmerk der Katze: dieses Axon ist segmentweise von einer Markscheide umgeben (myelinisiert) mit dem großen Vorteil, dass – für gleich schnelle Leitungsgeschwindigkeit wie bei der Krake – ganz dünne Axone ausreichen. Durch die segmentweise isolierende Ummantelung des Axon mit einer Markscheide ist die Leitungsgeschwindigkeit – gegenüber einem marklosen Axon – immens vergrößert.
Werfen wir jetzt einen Blick auf das Rückenmark des Menschen: es hat einen Durchmesser von maximal 1,5cm. Wären die im Rückenmark verlaufenden Axone nicht myelinisiert, müsste das Rückenmark für gleich bleibende Leitungsgeschwindigkeiten nahezu 40cm dick sein, und das wäre in jeder Hinsicht extrem unbequem, vom Gewicht gar nicht erst zu reden.
Nun wollen wir uns der Frage widmen, wie die Myelinisierung stattfindet. As Beispiel wählen wir zunächst das periphere Nervensystem. Es handelt sich also um die Markscheidenbildung=Myelogenese von Axonen der sensorischen und motorischen peripheren Nerven. Die Markscheide wird hier von Schwann-Zellen gebildet. Wie wir bereits wissen, differenzieren sich diese während der Embryogenese aus bestimmten Glioblasten der Neuralleiste. Sie haben zunächst eine rundliche Form. Der amöboiden Bewegungsweise fähig wandern sie – dem chemischen Gradienten einer vom Axon ausgesandten attraktiven Substanz folgend – zum Axon hin. Dort angekommen heften sich die Schwann-Zellen in Reih und Glied längs an das Axon, ohne gegenseitig aneinander zu stoßen. An diesen freien Stellen – den sog. Ranvierschen Schnürringen – liegt das Axon jeweils blank. Nur dort können später (nach Abschluss der Myelogenese) die Axone erregt werden; darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir haben jetzt also gesehen, wie die Segmentierung der Markscheide zustande kommt. Nun folgt die eigentliche Myelogenese: die Schwann-Zellen umfließen und umwickeln das Axon, – ganz grob vergleichbar, wie etwa eine mit Senf bestrichene Rindsroulade eine Gewürzgurke umwickelt: hier im Querschnitt dargestellt. Während der Umwicklung wird von den Wickeln Myelin abgeschieden, – das würde dann in unserem Rouladenbeispiel jeweils den Senfschichten entsprechen. Das Myelin besteht chemisch aus Lipoiden. Folglich ist das Axon in diesen als Markscheiden bezeichneten Segmenten isoliert, d.h. elektrisch nicht erregbar. Wozu das Ganze gut ist, werden wir gleich sehen. Zuvor wollen wir wieder die schematische Darstellung mit den natürlichen Verhältnissen vergleichen. Bleiben wir zunächst beim Ranvierschen Schnürring, den wir im histologischen Präparat sehen: hier verläuft das Axon und dort der nicht myelinisierte Bereich zwischen zwei Markscheiden. Wir schauen uns jetzt den Ranvierschen Schnürring im Elmi-Längsschnitt stark vergrößert an. Dort also hört das Myelin auf. Und jetzt betrachten wir das myelinisierte Axon in einem Elmi-Querschnitt: die Umwicklung ist also spiralig und nicht konzentrisch. Lassen Sie mich abschließend – für Sie nachvollziehbar – den Prozess der Myelogenese an der Tafel Schritt für Schritt skizzieren.
Wie aber entsteht die Markscheide im ZNS? Im Endeffekt kommt es auf das Gleiche heraus, lediglich der Weg bis zur Markscheide ist etwas anders. Die Markscheide der Axone des ZNS wird nämlich nicht von Schwann-Zellen, sondern von Oligodendroglia-Zellen gebildet. Diese Gliazellen – wie der Name Dendron besagt – sind bäumchenartig verzweigt. Sie besitzen dünne „Ärmchen“; an deren Enden befinden sich „Händchen“, mit denen sie jeweils ein Axon greifen: dabei beträgt das Verhältnis zwischen Oligodendrogliazellen zu Axonen etwa 1:40. Eine Oligodendrogliazelle kann also 40 verschiedene Axone ummanteln und mit (konzentrisch) abgeschiedenen Myelinschichten elektrisch isolieren. Ranviersche Schnürringe entstehen zwischen den jeweils nebeneinander angeordneten Händchen, die von verschiedenen Oligodendrogliazellen stammen können.
An dieser Stelle sei bereits vermerkt, dass sich die Schwann-Zellen des PNS und die Oligodendrogliazellen des ZNS in einem wichtigen Punkt erheblich unterscheiden, nämlich im Zusammenhang mit der Regeneration verletzter Neurone. Nach der Durchtrennung eines Axons – etwa verursacht durch einen Unfall –, genannt Axotomie, erweisen sich Schwann-Zellen des PNS aufgrund der von ihnen ausgesandten chemischen Stoffe für die regenerierenden auswachsenden Axone als einwanderungsfreundlich. Demgegenüber erweisen sich Oligodendrogliazellen des ZNS regenerierenden Axonen gegenüber als einwanderungsfeindlich. Das ist eines der großen Probleme nach Rückenmarksverletzungen. Die Oligodendrogliazellen des Rückenmarks verhindern durch das von ihnen ausgesandte inhibitorisch wirkende Protein NI-35/250, dass regenerierende Axone im Rückenmark ihre nachgeschalteten Neurone erreichen. Wir kommen gegen Ende der Vorlesung darauf noch genau zu sprechen.
Noch einmal auf die Erregungsleitung zurückkommend wollen wir fragen: wie verschieben sich die Ladungen im inneren und äußeren Elektrolyten längs der Axon-Membran bei der Fortpflanzung von Aktionspotenzialen. Zunächst ein kreativer Blick auf unser bereits bekanntes Potenzial-Koordinatensystem: Nulllinie, Minus-70Millivolt-Ruhepotential und Plus-20Millivolt-Aktionspotential. Während der Fortpflanzung der APs verschiebt sich also das Membran-Potenzial zwischen Plus und Minus, bzw. vice versa. In der nächsten Folie soll dies die Axon-Membran darstellen, hier wäre außen und dort innen. Jetzt möge die Membran an dieser Stelle depolarisiert werden gekennzeichnet durch den Pfeil: in Ruhe ist sie zunächst außen positiv und innen negativ geladen; depolarisiert, d.h. elektrisch erregt ist sie außen negativ und innen positiv. Kurz: die Polarität kehrt sich an dieser Stelle der Membran um. Da die Polarität in der Nachbarschaft invers ist, innen negativ und außen positiv, kommt es im inneren und äußeren Elektrolyten zur Ausbildung von Kreisströmchen, die sich längs der Membran fortpflanzen, vergleichbar dem Abbrennen einer Zündschnur. Sobald dieser Prozess am Axonhügel gestartet ist, setzt er sich automatisch kontinuierlich unter Beibehaltung der AP-Amplitude (also ohne Dekrment und damit ohne Informationsverlust) bis zum Axonendknoten fort.
Solch ein kontinuierlich sich fortpflanzender Kreisströmchen-Prozess ist jedoch relativ langsam. Vergleichen Sie einmal die kontinuierlich kriechende Fortbewegung einer Schlange mit der diskontinuierlich springenden Bewegung eines Kängurus. Übertragen auf unser Problem wäre zu fragen: was könnte die Kreisströmchen veranlassen zu springen? Antwort: die segmentiert ausgebildete Markscheide! Wir verfolgen dies auf der Folie: aufgrund der isolierenden Wirkung der Markscheide laufen sich dort die Kreisströmchen tot und bilden sich anstelle dessen nur zwischen den elektrisch erregbaren Ranvierschen Schnürringen aus. Die Markscheiden veranlassen, dass sich die Erregung nicht kontinuierlich, sondern von Schnürring zu Schnürring diskontinuierlich, d.h. sprunghaft – oder vornehm lateinisch ausgedrückt „saltatorisch“ – ausbreitet.
Abschließend wollen wir uns den Unterschied zwischen kontinuierlicher und diskontinuierlicher Erregungsausbreitung in einer PowerPoint-Animation anschauen. Beide starten zur gleichen Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit: der kontinuierliche Vorgang wird vom diskontinuierlichen jedoch schnell überholt. Man kann sich gut vorstellen, dass mit zunehmendem Abstand der Schnürringe – in Grenzen – die sprunghafte Ausbreitungsgeschwindigkeit zunimmt.
Wir wollen uns jetzt einem anderen Themenkomplex zuwenden und fragen, was man bei der Erregungsleitung und Erregungsübertragung unter Kodierung bzw. Dekodierung versteht. Diese Folie kennen Sie bereits; sie illustriert das Phänomen der Reiz/ Erregungstransformation. Beginnen wir mit der Reizaufnahme durch eine Sinnesnervenzelle, z.B. eine Riechzelle. Duftmoleküle docken an Chemorezeptoren an und lösen durch Öffnung von Na+ Kanälen ein Rezeptorpotenzial aus, das sich längs des kurzen dendritischen Abschnitts der Sinneszelle zunächst elektrotronisch mit Dekrement fortsetzt und über das Soma ausbreitet bis zum Axonhügel. Da längs des Axons die zurückzulegende Strecke wesentlich länger ist als im dendritischen Bereich, wird die Depolarisation des eintreffenden Rezeptorpotenzials umgesetzt in APs. Man nennt das Rezeptorpotenzial auch Generatorpotenzial, weil es APs am Axonhügel generiert. Das bedeutet funktionell, dass die Depolarisation hier kurzfristig zur Öffnung von spannungsgesteuerten Na+ Kanäle führt und, zeitversetzt, zur Öffnung von K+ Kanäle führt. Wie wir wissen, pflanzen sich die APs bis zum Axonendknoten fort. In derselben Richtung wird längs der Neurotubuli der in Vesikel verpackte Neurotransmitter langsam transportiert. Dieser Transport korreliert natürlich nicht mit der Leitung der APs. Wichtig ist, zu wissen, dass die chemische Signalübertragung auf das nachgeschaltete Neuron an der Synapse mittels Neurotransmitter erfolgt. Als Folge der Transmitter-Rezeptor-Bindung an der postsynaptischen Membran werden bei einer erregenden Synapse chemisch gesteuerte Na+ Kanäle geöffnet; der resultierende Na+ Einstrom führt zur Ausbildung eines langsamen erregenden postsynaptischen Potentials, auch exzitatorisches postsynaptisches Potential genannt oder abgekürzt: EPSP.
Nach kurzer Wiederholung dieser bereits bekannten Grundlagen wollen wir jetzt endlich auf Kodierungs- und Dekodierungsprozesse eingehen: wie und wo kann Information verschlüsselt bzw. entschlüsselt werden? Angenommen, wir haben einen starken Duftreiz, d.h. die Duftmolekül-Konzentration ist relativ hoch. Dann werden aufgrund der vielfachen Molekül-Chemorezeptor-Bindungen zahlreiche Na+ Kanäle geöffnet, was wiederum zu einem Rezeptorpotenzial von entsprechend hoher Amplitude führt. Es besteht also eine positive Korrelation zwischen der Reizintensität und der Amplitude des Rezeptorpotenzials. Wir nennen dies Amplitudenmodulation. Am Axonhügel wird die Amplitude des Rezeptorpotenzials kodiert, d.h. verschlüsselt, in eine entsprechende Sequenz von APs und zwar ausgedrückt in deren Frequenz. Je höher die Amplitude, desto mehr APs werden pro Zeiteinheit generiert. Worauf beruht das Prinzip der Amplituden/Frequenzmodulation? Dem Prinzip liegt die sog. Intensitäts-Zeitbeziehung zugrunde: I*t=c; das Produkt aus der Intensität I und dessen Einwirkzeit=Latenzzeit t ist konstant c. Da die Latenzzeit t bis zur Auslösung eines AP umgekehrt proportional zur Intensität der Membrandepolarisation (Amplitude des Rezeptorpotenzials) ist, t=c/I, gilt für die Frequenz der APs: F=1/t; das bedeutet, je höher die Intensität, desto kleiner die Latenz und desto höher die Frequenz.
Die Dekodierung findet bei der Signalübertragung an der Synapse statt. Wenn in zeitlicher Sequenz APs am Axonendknoten eintreffen, dann resultieren in entsprechenden Zeitabschnitten Ausschüttungen eines erregenden Neurotransmitters, z.B. Acetylcholin ACh. Dementsprechend viele Na+ Kanäle werden geöffnet, und die zugeordneten EPSPs überlagern sich zu einem summierten EPSP, dessen Gesamt-Amplitude durch die Frequenz präsynaptisch einlaufender APs bestimmt wird. Die Amplitude des summierten EPSPs kann dann aufgrund jenes Prinzips, das wir gerade kennen gelernt haben, am Axonhügel des nachgeschalteten Neurons wieder in eine Sequenz von APs entsprechender Frequenz kodiert werden. Das Ganze schauen wir uns hier in einer Grafik für unterschiedliche Reizintensitäten an. Gibt es hierzu irgendwelche Fragen? Wie ich sehe ist das nicht der Fall.
Betrachten wir jetzt das Ganze für eine inhibitorische Synapse. Nun, wenn man das zuvor geschilderte verstanden hat, ist das folgende leicht nachzuvollziehen. Den präsynaptischen Kodierungsprozess kennen wir ja bereits. Der Unterschied der Dekodierung liegt im postsynaptischen Prozess. Wenn in zeitlicher Sequenz APs am Axonendknoten eintreffen, dann resultieren in entsprechenden Zeitabschnitten Ausschüttungen eines inhibitorischen Neurotransmitters, z.B. Gamma-Amino-Buttersäure, GABA [bitte nichtl zu verwechseln mit Gamma-Hydroxi-Buttersäure GHB]. Dementsprechend viele Cl- Kanäle werden geöffnet, und die zugeordneten inhibitorischen postsynaptischen Potenziale IPSPs überlagern sich zu einem summierten IPSP, dessen negativ verlaufende Amplitude durch die Frequenz präsynaptisch einlaufenden APs bestimmt wird. Die IPSP-Amplitude kann natürlich am Axonhügel des nachgeschalteten Neurons keine APs auslösen, sondern dient am Soma der Verrechnung mit (E)PSPs, die über andere Synapsen einlaufen.
In der folgenden Folie sind einige Merkpunkte zur Frequenzkodierung zusammengefasst:
1) der Alles-oder-Nichts Charakter des AP sichert eine konstante Amplitude und damit eine Erregungsleitung über weite Strecken ohne Informationsverlust.
2) die absolute Refraktärzeit R eines AP bestimmt den Sequenzcharakter der APs, wodurch die maximale AP-Frequenz durch R begrenzt wird.
3) Die Intensität/Latenzzeit-Beziehung I*t=c führt dazu, dass die Amplitude einer Membrandepolarisation (Intensität) durch eine entsprechend hohe Frequenz von APs ausgedrückt wird.
Wie bereits versprochen, wollen wir uns jetzt mit einem ganz anderen Thema beschäftigen und fragen, was passiert eigentlich, wenn Neuronen verletzt werden oder gar absterben bzw. zerstört werden. Beginnen wir mit dem Neuronentod, der sich in unserem Gehirn von der Wiege bis zur Bahre vollzieht, anfangs – in der Wiege – als gewollt programmierter Zelltod, danach bis zur Bahre langsam mehr oder weniger kontinuierlich. Ich hatte in der ersten Vorlesung bereits darauf hingewiesen, dass das altersbedingte Neuronensterben jedoch nicht so dramatisch ist, wie früher aufgrund von Messfehlern angenommen. Die Neuronen schrumpfen mit der Zeit. Das betrifft vor allem auch die Markscheide. Dadurch wird die Erregungsleitung etwas langsamer. Demgegenüber wird mit zunehmenden Alter die erfahrungsbedingte Vernetzung der Neuronen größer; das Gehirn wird weiser. Ein bestimmter Grundbestand an Neuronen ist natürlich schon wichtig. Massiver Neuronentod – z.B. im fortgeschrittenen Stadium von Aids oder der Alzheimerschen Krankheit – hat Demenz zur Folge.
Abgesehen von solchen dramatischen Hirnerkrankungen wäre zu fragen, unter welchen alltäglichen Bedingungen Neuronentod verstärkt eintritt. Dass Neuronen massenhaft absterben, nachdem man eine Nacht kräftig dem Alkohol zugesprochen hat, gehört sicherlich in den Bereich der Fabel. Kater, Gedächtnislücken und Filmrisse sind nicht Ausdruck einer gravierenden irreversiblen Hirnschädigung. Aber auch beim Alkohol macht es schließlich die Dosis. Säufer, die morgens bereits eine Flasche Whisky frühstücken, reduzieren ihren Neuronenbestand soweit, dass sie sich buchstäblich um den Verstand bringen.
Ein gar nicht zu unterschätzender Neuronenkiller ist Stress; natürlich nicht der gelegentliche Ärger mit einem Mitmenschen oder der Examensdruck, auch nicht der eher anregende Eustress, sondern der sich ständig wiederholende Distress – also Dauerstress – und das damit verbundene Ansteigen des Stresshormons Kortisol ist hier ausschlaggebend. Bei Vietam-Kämpfern kennt man das posttraumatische Stresssyndrom. Welches ist die Kausalkette hierfür? Wie wir wissen, haben Neurone einen hohen Bedarf an Glukose. Kortisol hindert Neurone daran, Glukose aufzunehmen. Unterschreitet die Glukoseaufnahme in Neuronen einen bestimmten Wert, dann sterben sie schließlich ab. Bedauerlicherweise findet dies im Gehirn vor allem dort statt, wo gelernt wird, also im Hippocampus. Früher meinte man, dass dieser Neuronen-Verlust unwiederbringlich ist. Heute weiß man, dass gerader der Hippocampus zu den wenigen Hirnstrukturen gehört, in denen Neurone neu gebildet werden können, also Nachschub möglich ist. Das hat man zunächst an Ratten zytochemisch nachweisen können. Es gibt ganz bestimmte, pfiffige Verfahren, mit denen man alte Neuronen von neu gebildeten unterscheiden kann. Danach wurde dies für Affen bestätigt, und inzwischen weiß man es – auf Grund non-invasiver PET-Analysen – auch vom Menschen.
Wie schützt man sich vor Neuronentod? Schutz gegen Stress und gegen altersbedingtes Neuronensterben bietet sowohl geistiges, aber vor allem auch motorisches Training. Letzteres ist kein Scherz, sondern mehrfach erwiesen, selbst bei Ratten. Es ist auch kein Zufall, dass Johannes Heesters mit seinen über 100 Jahren Theater-Rollen auswendig lernen kann. Er kann das, weil er es sein Leben lang bis zum heutigen Tage tut und dadurch sein Gedächtnis und seinen Körper trainiert und damit beide fit hält. Eine gewisse genetische Disposition ist für das Fit bleiben im Alter sicherlich hilfreich. Es besteht nämlich in der Tat eine erhöhte Genaktivität für die Bildung von Faktoren, die in diesem Zusammenhang förderlich sind, z.B. den brain-derived neurotrophic factor BDNF.
Nur am Rande möchte ich darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass bestimmte Neurone im erwachsenen Gehirn aus Vorläuferneuronen neu gebildet werden können, eigentlich ein alter Hut ist. Musterbeispiel sind die Riechzellen der Vertebraten. Riechzellen sind Rezeptorneurone, also Sinnesnervenzellen. Ihr Bestand umfasst bei uns etwa 3x106 Rezeptorneurone; die Lebensdauer jeder Zelle beträgt etwa 30 Tage. Nach dem Absterben einer Zelle wird diese aus einer sog. Basalzelle ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, in dessen Verlauf der Gesamtbestand an Sinneszellen etwa konstant gehalten wird. Womit sich natürlich viele Fragen stellen, z.B.: wie finden die Axone der Riechzellen ihre postsynaptischen Neuronen im Vorderhirn? Wie verschalten sie sich derart zweckmäßig, so dass das Geruchsvermögen, vor allem aber auch das Geruchserinnerungsvermögen, erhalten bleiben. Man weiß auf diesem Gebiet – wie wir gesehen haben – bereits einiges, aber noch lange nicht alles.
Jetzt endlich wollen wir uns der wichtigen Frage zuwenden und fragen, was geschieht, wenn – etwa durch einen Unfall – das Axon eines peripheren Nerven, z.B. im Armbereich, durchtrennt wird. Wir veranschaulichen das an der Tafel: hier ist ein Neuron mit Dendriten und dort das Axon umgeben von einer segmentierten Markscheide, gebildet von Schwann-Zellen. Der Axonendknoten steht mit dem nachgeschalteten Neuron über eine Synapse in Kontakt. Jetzt wird das Axon durchtrennt: der Fachausdruck hierfür heißt „Axotomie“. Sodann stirbt der Zellkörper-lose Teil ab, und zwar unwiederbringlich, denn ohne Zellkörper kann der Axon-Abschnitt nicht überleben. Damit ist die Verbindung zum nachgeschalteten Neuron unterbrochen. Der am Zellkörper verbliebene Axonstumpf wird von der Zelle versorgt; er überlebt. Die am Ende des Stumpfes verbliebenen Gliazellen der Markscheide erinnern sich jetzt, sozusagen, ihrer Teilungsfähigkeit, beginnen sich zu teilen und bilden hierbei Zellbänder, die sog. Hanken-Büngnerschen Bänder. Diese können als Leitstrukturen für das von seinem Stumpf her auswachsende Axon dienen. Um im Bild zu bleiben, erinnert sich das Axon nunmehr an seine ontogenetische Fähigkeit, die es von der Entwicklung des Nervensystems her kennt, nämlich, Filopodien zu bilden, die an ihren Endabschnitten mit Spürnasen (=Axonkegel) versehen sind, und entlang der Hanken-Büngnerschen Bänder chemotropismisch zum postsynaptischen Neuron hin wachsen. Solche Prozesse haben wir ja bereits kennen gelernt.
Dass Regenrationsfähigkeit durchaus möglich ist, ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass dies nur im peripheren Nervensystem PNS möglich ist. Dieser Erfolg hängt im PNS allerdings von einem Wettlauf ab zwischen der Geschwindigkeit des Regenerations-Prozesses und der Geschwindigkeit der Wundvernarbungs-Prozesse. Je schneller die Vernarbung, desto stärker wird die Regeneration gehemmt. Der Vernarbungsprozess lässt sich aber pharmakologisch bremsen.
Wie gesagt, eine Voraussetzung dafür, dass auswachsende Axonstümpfe ihre postsynaptischen Neurone, hängt vom Gliazell-Typ ab, der dessen Markscheide bildet: Schwann-Zellen des PNS sind einwanderungsfreundlich. Sie bilden den auswachsenden Axonen gegenüber keinen Widerstand, sondern ziehen sie an.
Im ZNS sieht die Angelegenheit ganz anders aus. Denn jener Gliazell-Typ, von dem die Markscheide in Gehirn und Rückenmark abstammt, sind Oligodendrogiazellen; diese erweisen sich für regenerierende Axone als einwanderungsfeindlich. Sie bilden den auswachsenden Axonen gegenüber Widerstand, und darauf beruhen die gravierenden Probleme bei totalen bzw. parziellen Rückenmarksverletzungen. Oligodendrogliazellen geben Stoffe ab, die das axonale Wachstum zu postsynaptischen Neuronen verhindern. Das habe ich für Sie in dieser Folie noch einmal übersichtlich zusammengefasst. Das Rückenmark besteht aus Weißer und Grauer Substanz. In der weißen befinden sich Axone mit ihrer Markscheide, die den Hemmstoff neurite inhibitor NI-35/250 aussendet. Die Graue Substanz dagegen, die im Wesentlichen die markscheidenlosen Somata der Nervenzellen beherbergt, verhält sich aufgrund ihres Gehalts an Nervenwuchsstoffen – z.B. dem basophil fibrinoblast growth factor bFGF und dem nerve growth factor NGF – dagegen einwanderungsfreundlich.
Nun, seitdem man das weiß, können Sie sich vorstellen, dass Neurologen und Neurobiologen in der neurophysiologisch/neuropharmakologischen Forschung alles daran setzen, bei Querschnittsgelähmten herauszufinden, mit welchen Möglichkeiten man diese Wachstum-stimulierenden und Wachstum-inhibierenden Prozesse therapeutisch steuern kann. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt über Grundlagenforschungen berichten, die etwa 30 Jahre lang zurückliegen. Ich war damals gerade ein paar Jahre hier an der Universität Kassel, damals noch Gesamthochschule genannt, tätig und besuchte einen Kongress in Schweden. Dort wurden erstmalig bahnbrechende Experimente an Ratten vorgetragen. Man hatte bei Ratten experimentell eine totale Rückenmarksdurchtrennung durchgeführt. Diese Ratten waren dann nicht mehr lokomotionsfähig, d.h. sie konnten sich nicht mehr koordiniert fortbewegen. Man ist dann hingegangen und hat ein Stück peripheren Nerv – z.B. vom Riechnerven – frei präpariert, deren Axone von Schwannzell-Markscheide umgeben waren [wohlgemerkt nicht von Oligodendrogliazell-Markscheide!]. Dieses Stück Nerv hat man dort, wo das Rückenmark unterbrochen war, zwecks Überbrückung – wie einen Bypass als Nervenbrücke – eingepflanzt, und zwar das eine Ende in die Weiße Substanz und das andere in die Graue Substanz. Hinzugefügt wurde noch eine Mischung von den Wachstumsfaktoren, unter anderem bFGF und NGF.
Das Ergebnis war viel versprechend: nach etwa nach 3 Monaten vermochten die Ratten ihre Beine – wenn auch eingeschränkt – wieder koordiniert zu bewegen, und nach 12 Monaten konnten sie wieder ganz gut laufen. Bei der histologischen Aufarbeitung – post mortem – fand man heraus, dass beide Nervenendigungen eingewachsen waren. Da die Schwannzell-Markscheiden keine Inhibitor-Eigenschaften haben, konnten sich die aus den Rückenmarkstümpfen auswachsenden Axone mit diesem – wenn auch ortsfremden – Gewebe anfreunden, es durchqueren und zu ihren ursprünglich nachgeschalteten Rückenmarks-Neuronen ziehen, mit diesen Synapsen bilden und – wie man zuvor festgestellt hatte – Erregungen leiten. Die ganze Theorie, die dahinter steckte, war hiermit experimentell belegt.
Nun, ich berichte hierüber natürlich nicht zuletzt deswegen, um zu einem Problem überzuleiten, das uns Menschen betreffen kann verbunden mit der Frage: ist es möglich, dass querschnittsgelähmte Menschen nach Rückenmarksverletzungen den Rollstuhl wieder verlassen können oder, treffender gesagt, ihn gar nicht erst benutzen müssen. Das heißt, müssen alle Menschen, deren Rückmark verletzt ist – wie heute noch allgemein üblich/nötig – unbedingt im Rollstuhl landen? Etwas ist heute wohl ziemlich unumstritten: wenn sich der Betroffene erst einmal längere Zeit auf den Rollstuhl eingestellt hat, ist es wohl nahezu unmöglich, diesen wieder zu verlassen mit der Perspektive, einmal wieder gehen zu können. Aber es ist nicht bei allen Querschnittslähmungen unbedingt erforderlich, in den Rollstuhl zu gelangen. Ich habe verschiedene Kongresse zu diesem Thema besucht und auch Berichte von Betroffenen gehört, die Unfall bedingte partielle (!) Rückenmarksdurchtrennungen besaßen und heute so herumgehen wie ich hier.
Wie und warum der Weg eines Betroffenen nicht in den Rollstuhl führte, möchte ich kurz schildern. Der Betroffene hatte auf jeden Fall einen starken Überlebenswillen, genauer gesagt, einen sehr starken Gesundheitswillen: er sagte sich, ich will durch Willenskraft dieses Problem lösen, auch wenn ich meine Beine zunächst nicht bewegen kann. Er hatte zu dieser Thematik viele Fachbücher studiert und verfügte schließlich über ein solides Fachwissen. Das zentrale Leitmotiv seines Lebens war „ich will mich bewegen“. So hat er an verschiedenen Bewegungstherapien teilgenommen. Interessant ist, dass die Krankenkassen dies alles nicht bezahlen wollten. Die Diagnose „Querschnittslähmung“ bedeutet für Krankenkassen automatisch: „Rollstuhl“. Damit war die Angelegenheit für die Krankenkasse beendet, – nicht jedoch für den hier Betroffenen. Solange es auch nur den Hauch einer Möglichkeit gibt, sagte er sich, dann klappe ich den verordneten Rollstuhl erstmal einmal zusammen und schlage einen therapeutischen Weg ein.
Lassen sie uns zunächst einmal sehen, mit welchen physiologischen organischen Problemen sich der Betroffene auseinander setzten musste. Außer der Unterbrechung des nervösen Signalflusses laufen zwei fatale Prozesse ab, einen haben wir bereits beim Schlaganfall kennen gelernt. Wenn bei einer partiellen Rückenmarksschädigung Axone durchtrennt werden, dann sind gleichzeitig auch Gefäße durchtrennt, und das führt zur Ischämie verbunden mit: Sauerstoff/Glukose-Defizit, starker Glutamat-Ausschüttung, Hypererregung, stark erhöhtem Kalziumionen-Einstrom in die Neurone, NO-Synthese, aggressive freie Radikale, Apoptose (=Zelltod). Parallel hierzu treten aus den Gefäßstümpfen Immunzellen, die die Mikroglia aktivieren und den Prozess der Apoptose sogar noch fördern. Als ob die Durchtrennung von Nervenbahnen im Rückenmark – und die damit verbundene Unterbrechung des Signalflusses – nicht schon schlimm genug wäre: parallel dazu setzt also eine selbstzerstörerische Maschinerie ein. Letztere ist noch gar nicht so lange bekannt.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Nach Eintreten einer Rückenmarksschädigung mit Querschnittslähmung sollte innerhalb von 8 Stunden ein hoch dosiertes Cortisonpräparat verabreicht werden zusammen mit Nervenwuchsstoffen, Glutamatrezeptor-Blockern und Apoptose-Blockern, Letzteres also Therapien, die wir beim Schlaganfall kennen gelernt haben. Cortison, erwähnte ich eingangs bereits, wirkt immunsuppressiv und hat damit entzündungshemmende, d.h. anti-inflammatorische Funktion. Hierdurch wird eine begrenzte Linderung der motorischen und sensorischen Funktionen erreicht. Im Anschluss an diese Sofortmaßnahme um Gottes willen nicht in den Rollstuhl zum Ausruhen: Jetzt muss unbedingt sofort mit einem speziellen „Schreitprogramm für Querschnittsgelähmte“ begonnen werden. Jede Passivbewegung im Rollstuhl würde dazu führen, dass kein Schreittraining mehr wirken kann. Warum? Bei teilweiser Rückenmarksverletzung sind ja wenigstens immer noch die Voraussetzungen dafür gegeben, sich teilweise bewegen zu können. Solange dies allein theoretisch möglich ist, sollte der Betroffene ständig versuchen, Bewegungen auszuführen. Denn, wenn das Gehirn erst einmal keine Rückmeldung von der Muskulatur mehr erhält und daraus schließt, dass die Muskulatur nicht arbeitet, gibt das Gehirn auch keine Signale mehr zur Muskulatur. Das Gehirn ist „gnadenlos“, indem es seiner eigenen Logik folgt, die von derjenigen unseres Verstandes abweicht: wenn die Muskulatur sich nicht mehr kontrahiert, wird sie vom Gehirn buchstäblich vergessen; sie existiert für das Gehirn einfach nicht mehr. Umgekehrt, sobald die Signale vom Gehirn zur Muskulatur verstummen, sagt sich die Muskulatur, dass sie nicht mehr gebraucht wird und sie beginnt, zu degenerieren d.h. zu verkümmern. Der Teufelskreis wäre damit geschlossen.
Die Therapieformen und Erfolgsaussichten hängen also stets von der Schwere der Rückenmarksverletzung ab. Solange einige Verbindungsfasern unversehrt sind, ist die Prognose für den Erfolg einer Therapie durchaus positiv; die Erfolgsquote liegt dann bei 80 bis 90%. Das wusste man früher nicht. Damals gab es keine Alternative zum Rollstuhl. Seit 1990 gibt es diese neuen Therapiemöglichkeiten bestehend aus speziellen Schreitprogrammen für Querschnittsgelähmte. Diese Therapien nutzen die Plastizität und die Lernfähigkeit des Nervensystems. Unser Gehirn besteht aus neuronalen Netzen. In diesen Netzen sind Neurone in bestimmter Weise miteinander verschaltet; wir sprechen von motorischen Programmen, die die Muskelkontraktionen koordinieren. Diese Programme können durch Lerntraining umorganisiert, also umprogrammiert werden. Das ist natürlich nicht ganz so einfach wie es sich hier anhört. Wenn ein Nerv durchtrennt wird, wachsen am abgeschnittenen Axonende zunächst feine vielseitig verzweigte Axonäste aus. Eine wilde kompensatorische Verzweigung findet also statt. Es werden folglich viele Motorneuronen aktiviert, was zu einer Hyperreflexerregbarkeit führt bis hin zur Spastizität und Erhöhung des Muskeltonus. Alles das schränkt natürlich zusätzlich die Bewegungsfähigkeit sehr stark ein, es beweist jedoch, dass das Rückenmark plastisch ist, das heißt durchaus noch programmierfähig ist. Die Spastizität kann pharmakologisch eingedämmt werden. Durch gezieltes Schreittraining, d.h. motorisches Lernen müssen dann die intakten Nervennetze umprogrammiert werden. Während des reflexartigen Schreitens sind die Patienten in einen Fallschirmgurt gehängt, so dass ihre Füße gerade das Laufband berühren. Die Beinbewegungen werden durch das Laufband angeregt. Von Mal zu Mal wird dann das Körpergewicht mehr und mehr auf die Beine verlagert, bis schließlich das Rückenmerk selbst die Schreitbefehle gibt, so dass schließlich Oberkörper und Beine sich rhythmisch koordiniert bewegen. Im Verlaufe dieses Lernprozesses werden neue Schaltungen programmiert, die dann neue Bewegungen koordinieren. Das heißt, alte Bewegungsmuster werden durch neue neuronale Programme erzeugt. Den Bewegungskoordinationen entsprechen dann Bewegungsmuster, die in ihrem Erscheinungsbild relativ normal aussehen, aber ihrer Entstehungsweise nach nicht normal sind. Der Betroffene bewegt sich „anders“ und er merkt auch, dass er sich anders bewegt.
Eine weitere wichtige Therapie besteht darin, durch elektrische Stimulation der Beinmuskulatur und der Haut das Gehirn gewissermaßen zu überlisten. Denn hierdurch erhält das Gehirn Meldungen, die ihm sagen, dort gibt es offenbar noch etwas, womit es lohnt, sich auseinanderzusetzen.
Ich möchte noch auf ein weiteres Problem hinweisen. Wie schon eingangs gesagt, besteht immer ein Wettlauf zwischen regenerierendem Nervengewebe und nekrotischem Zystengewebe aus Vernarbungsprozessen. Hier können die sich teilenden Gliazellen keine geordneten Hanken-Büngnerschen Bänder als Leitstruktur bilden, sondern sie wuchern und es können Glianarben entstehen. Sie werden nun mit Recht sagen, dass zu allem Unglück diese Gliazellen auch noch einwanderungsfeindlich sind. Die Forschung ist augenblicklich dabei, Antagonisten gegen die von Oligodendrogliazellen ausgesandten Inhibitoren zu entwickeln. Man könnte das Zystengewebe allerdings auch mittels Schläuchen aus Gewebe, die einwanderungsfreundliche Schwannzellen und fetale Nervenzellen enthalten, überbrücken. Als Leitstrukturen sind z.B. Brücken aus peripheren Nerven geeignet, deren Gliazellen ja einwanderungsfreundlich sind. Ferner gibt es Möglichkeiten für den Einsatz entsprechender Gentechnikprodukte. Stammzellen als Ersatzteillager werden ebenfalls diskutiert. Hier versucht man, omnipotente Zellen zu beeinflussen, dass sie Ziel gerichtet wachsen und sich mit geeigneten Neuronen verschalten, so dass die durchtrennten Verbindungen im Rückenmark durch neue Neurone und deren Axone wieder hergestellt werden können.
Wir halten also fest: im Rückenmark – wie auch im Gehirn – gibt es bevorzugte Hauptverbindungen, vergleichbar Autobahnen, die flüssig eine Menge an Informationen gewissermaßen automatisch verarbeiten. Entsteht ein Unfall – um im Bild zu bleiben – gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder im Stau stehen bleiben und warten oder gegebenenfalls eine Umleitung nehmen, die – wenn auch zunächst umständlich – jedoch zum selben Ziel führt. Mit der Zeit entwickelt das Gehirn aus solchen Nebenstraßen wieder Datenautobahnen, die den Informationsfluss umleiten. Diese Bahnen werden zweckgebunden zunehmend effizienter, je häufiger sie durch Training benutzt werden.
__________________________________________
Block4: Synaptische Übertragungen
Schnelle vs. Langsame(2nd-Messenger)Synapsen; Vesikel-Prozesse; Gedächtnis, Signaltransduktionen, cAMP, IP3; Rechenoperationen; NO-gesteuerte Prozesse
__________________________________________
vgl. Abbildungen Block 4
Fragen zu Block 4:
• Welche Einzelschritte lassen sich an einer "schnellen Synapse" unterscheiden?
• Nach welchem Prinzip öffnet Acetylcholin einen Na+ Ionenkanal?
• Wo und wie werden synaptische Vesikel gebildet?
• Welche Vesikelmembran-Interaktionen finden bei Exozytose und Endozytose statt?
• Über welche Signal-Transduktionen induziert ein Neurotransmitter an "langsamen Synapsen" strukturelle Veränderungen im Zusammenhang mit langfristiger Informationsspeicherung?
• Welche Signalkette führt rückwirkend zur Steigerung (Potenzierung) der synaptischen Übertragung?
• Synapsen gleichen elektronischen Modulen: Wie werden neuronale Aktivitäten summiert?
• Synapsen gleichen elektronischen Modulen: Wie werden neuronale Aktivitäten subtrahiert?
• Synapsen gleichen elektronischen Modulen: Wie wird multipliziert, z.B. Faktor <1 ?
• Schmerzausschaltung: Wie lässt sich synaptische Übertragung beeinflussen?
.
Meine Damen und Herren,
wir werden uns heute in Block4, aber auch in den folgenden Vorlesungs-Blöcken, mit verschiedenen Prozessen der chemischen synaptischen Übertragung beschäftigen. Der Begriff Synapse ist ja bereits bekannt: Neurone sind nicht, wie Ende des 19.Jh noch angenommen, kontinuierlich miteinander „verwachsen“, sondern stehen jeweils über Kontaktstellen, den Synapsen, miteinander in Verbindung. Im Folgenden wollen wir chemische Synapsen betrachten, chemisch deshalb, weil die in den elektrischen Signalen verschlüsselte Information von Neuron zu Neuron auf chemischem Wege übertragen wird, nämlich mit Hilfe von Neurotransmitter. Axone leiten APs zur Synapse; Axone haben im wesentlichen Leitungsfunktion. Die sich fortpflanzenden APs enthalten einen Code, der in ihrer Frequenz enthalten ist. An den Synapsen werden APs dekodiert in ein postsynaptisches Potential PSP, wobei die Amplitude des PSP die Frequenz der präsynaptisch einlaufenden APs widerspiegelt. Wir treffen hier also auf die bekannten Prinzipien der Codierung (am Axonhügel) und Dekodierung (an der Synapse).
Nun, die Aufgabe dieser Synapsen besteht nicht allein darin, zu dekodieren oder Signale zu übertragen. Der Dekodierungsprozess bildet gewissermaßen die Voraussetzung für weitere, sich anschließendeProzesse unterschiedlichster Art, z.B. Verrechnung von Informationen, die über verschiedene Synapsen eintreffen – Summation, Subtraktion, Multiplikation – bis hin zur Informationsspeicherung als Voraussetzung für das Kurz- bzw. Langzeitgedächtnis. Wie gelernt wird und wie Information langfristig gespeichert wird, darüber hat man lange Zeit spekuliert. Seit dem Jahre 2000 und der Vergabe des Nobelpreises für Medizin an Eric Kandel wissen wir recht genau, was sich hinter Gedächtnisprozessen verbirgt und wie sie funktionieren. Auf synaptischen Prozessen – vermittelt durch bestimmte Neurotransmitter – beruhen auch unsere Gefühle, Liebe, Glück, Schmerz, Hass, Emotionen aber auch – als „Nebeneffekte“ – verschiedene Formen der Sucht. Auf synaptischen Funktionen und ihrer Neurotransmitter beruht auch die Motorkoordination und damit die Verhaltenssteuerung. Alles dies möge Ihnen einen Vorgeschmack auf die nächsten Vorlesungsblöcke geben.
Heute wollen wir uns zunächst mit den Grundfunktionen der chemischen Synapsen beschäftigen. Wir beginnen mit der sog. schnellen synaptischen Übertragung vermittelt durch Acetylcholin ACh alsNeurotransmitter. Hier sehen Sie auszugsweise den Axonendknoten eines Neurons mit der präsynaptischen Membran, hier den synaptischen Spalt und dort die postsynaptische Membran des nachgeschalteten Neurons. Als Beispiel sehen Sie im Axon längs eines Neurotubulus einen Vesikel, mit ACh gefüllt. Unter dem Einfluss von Ca2+ Ionen – die, durch APs ausgelöst, durch spannungsgesteuerte Ca2+ Ionenkanäle in den Axonendknoten strömen – gelangt der Vesikel zur präsynaptischen Membran und entlässt ACh in den synaptischen Spalt. ACh dockt an einen nikotinischen Rezeptor der postsynaptischen Membran an, und als Folge der Transmitter-Rezeptor-Bindung öffnet sich ein Na+ Ionenkanal. Infolge des Na+ Ionen-Einstroms geht das Potenzial der postsynaptischen Membran vom Zustand des Ruhepotenzials in den Zustand der Depolarisation über. Wir sprechen daher von einem erregenden oder exzitatorischen postsynaptischen Potential, EPSP. (Die von verschiedenen erregenden Synapsen eintreffenden EPSPs werden summiert.) Im Anschluss an die Transmitter-Rezeptor-Bindung kommt es zur Transmitter-Inaktivierung, woraufhin sich der Na+ Kanal schließt. Jetzt tritt Ach-Esterase in Aktion. Sie zerlegt ACh in die Komponenten Acetat und Cholin, die zur präsynaptischen Membran diffundieren, dort aufgenommen und wieder in Vesikel verpackt werden. Dies geschieht entweder gleich im Axonendknoten oder über die axoplasmatischen Transportwege unter Beteiligung des Golgi-Apparates. LassenSie uns jetzt die soeben geschilderten Schritte nach und nach in einer Animation anschauen.
Solche simplen didaktischen Schemata sind dazu geeignet, sich vorzustellen, wie das Ganze etwa funktioniert bzw. funktionieren könnte. Sie werden jetzt zu Recht fragen, wie die Transmitter-Rezeptor-Bindung und die Ionenkanal-Öffnung in Wirklichkeit aussieht. Wir passen daher das grobe Schema der Realität an. Also, die Frage: nach welchem Prinzip öffnet ACh einen Na+ Kanal? Betrachten Sie hier die Feinstrukturen, z.B. die Lipid-Doppelmembran mit ihren hydrophilen und hydrophoben Bereichen. Die Zellmembran wird durchsetzt durch einen Na+ Ionenkanal. Der Ionenkanal zeichnet sich darin aus, dass er durch bestimmte Protein/Lipid-Einheiten ausgekleidet ist. Diese fünf Einheiten sind bekannt: alpha, beta, gamma, delta, darunter zwei alpha-Einheiten. Lassen Sie uns schauen, wie diese Struktur weiter aufgebaut ist und welche Zusammenhänge es zwischen Struktur und Funktion gibt. Dazu legen wir einen Querschnitt durch den Ionenkanal: jetzt sind die Zuordnungen zwischen den Einheiten besser zu erkennen, und wir sehen, wie diese Einheiten hier den Na+ Kanal auskleiden, jeweils mit hydrophilen M2-Makromolekülen und hydrophoben M1-, M3- und M4- Molekülen. Dieses Schema kommt den realen Verhältnissen schon recht nahe. Fragen wir also wie solch ein Rezeptor-gesteuerter Ionenkanal funktioniert. Dazu schauen wir uns noch einmal drei Kanal-Einheiten im schematischen Längsschnitt an: hier die beiden gegenüberliegenden alpha-Einheiten und symmetrisch dahinter die gamma-Einheit. Entsprechend dieser Darstellung besteht längs der hydrophilen M2-Moleküle ein negativer Gradient, dessen Negativität vom äußeren Teil der Membran nach innen zunimmt. Allein schon aufgrund dieses negativen Gradienten werden die positiv geladenen Na+ Ionen nach innen „geschleust“. Hinzu kommt ein Mechanismus, der mittels der hydrophilen M2-Moleküle eine pumpenartige Funktion ausübt. Die alpha-Einheiten haben eine besondere Aufgabe. An ihrem äußeren Ende befindet sich jeweils eine Tasche, die mit Rezeptoren für ACh ausgekleidet ist. Als Folge der ACh-Rezeptorbindung öffnet sich der Na+ Kanal indem die M2-Moleküle auseinanderweichen und pumpen. Auf diese Weise werden durch das Andocken von ACh Na+ Ionen entlang des negativen Gradienten ins Innere geschleust.
Gibt es hierzu fragen? Keine Fragen. Zweifellos werden die Zusammenhänge jetzt ein wenig komplizierter; ich gehe daher bewusst langsam voran.
Jetzt widmen wir uns detailliert der Frage, wo und wie synaptische Vesikel gebildet werden. Die zugeordnete Folie sieht auf den ersten Blick relativ kompliziert aus; wir werden uns zunächst auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.
1. Weg der Vesikelbildung. Im Bereich des Zellsomas, nahe dem Zellkern, befinden sich das raue Endoplasmatische Retikulum ER sowie der Golgi-Apparat. Beide dienen der Bildung von Vesikeln, „traditionell“ würde ich sagen, denn die Vesikelbildung kann im Neuron auch anderenorts stattfinden. Die Vesikel werden längs der Neurotubuli via Kinesin-Transport zum Axonendknoten befördert und gelangen – auf Ca2+ Signale hin – zur präsynapischen Membran, wo der Neurotransmitter per Exozytose in den synaprischen Spalt gelangt. Dafür, dass diese Prozesse geordnet ablaufen, sorgen sog. rab1,2,3,4,5,6 Moleküle. Dies sind niedermolekulare GTP-aktivierte G-Proteine (=Proteasen), die gewissermaßen als „Vesikel-Verkehrslotsen“ fungieren. Die 6 verschiedenen rabs erfüllen die unterschiedlichsten Funktionen: unter dem Einfluss von rab1 und rab2 bildet das raue ER Transfer-Vesikel; jene lagern am Golgi-Apparat, der, vom cis- in das trans-Netzwerk überführt, schließlich unter dem Einfluss von rab6 die synaptischen Vesikel entstehen lässt.
2. Weg der Vesikelbildung. An bestimmten Synapsen kann der Neurotransmitter im Anschluss an seine Bindung an den Rezeptor als Ganzes – unter Vermittlung eines Transportproteins – durch Endozytose wieder aufgenommen werden. Der Neurotransmitter wird sodann im Axonendknoten unter dem Einfluss von rab5 in eine Hülle verpackt; auf diese Weise entstehen endozytotische Vesikel. Diese können unter dem weiteren Einfluss von rab5 einem Endosom einverleibt werden. Das Endosom hat eine bestimmte Funktion: es muss nämlich den endozytotischen Vesikel mit einer speziellen Membran umgeben, deren Eigenschaft darin besteht, später mit der präsynaptischen Membran in Interaktion treten zu können, d.h. mit ihr zu fusionieren.
3. Weg der Vesikelbildung. Dieser Weg führt vom endozytotischen Vesikel unmittelbar zum synaptischen Vesikel. Endozytotische Vesikel können auch über den Dynein-Transport zum Golgi-Apparat befördert und dort recycelt werden.
4. Weg der Vesikelbildung. Hierbei handelt es sich um den sog. „kiss-and-run“ Mechanismus. Um im Bilde zu bleiben, „küsst“ der Vesikel die präsynaptische Membran und lässt seinen Neurotransmitter in den synaptischen Spalt „entrinnen“. Nach dessen Aktion an der postsynaptischen Membran wird der Transmitter durch Endozytose wieder aufgenommen und der „kiss-and-run“ Mechanismus wiederholt sich von neuem, usw. Für manche Prozesse kann solch eine schnell wiederholbare Übertragung von großem Nutzen sein.
Die Exozytose. Jetzt wollen wir uns die komplizierten präsynaptischen Prozesse etwas genauer anschauen und fragen, wie die Interaktion der synaptischen Vesikel mit der präsynaptischen Membran erfolgt, d.h.: wie funktionieren Exozytose und Endozytose? Die Folie zeigt innerhalb des Axonendknoten einen Vesikel, der von einer speziellen Membran – Synaptotagmin – umgeben ist, die bestimmte Eigenschaften besitzt. Sie ist nämlich für Ca2+ Ionen empfindlich. Unter dem Einfluss von Ca2+ Ionen und vermittelt durch den Verkehrslotsen rab3 wird der Vesikel zur Andockstelle der präsynaptischen Membran geführt. Rab3 sagt dem Vesikel, er möge sich auf das Ca2+ -Signal hin in diese Richtung bewegen. Daraufhin geht das Synaptotagmin der Vesikelhülle eine Bindung mit der präsynaptischen Andockstelle ein, die daraufhin ihre Zusammensetzung ändert und zu Neurexin wird. Auf dieses Signal hin wird aus Synaptotagmin –> Synaptobrevin und aus Neurexin –> Syntaxin. Die Reaktion zwischen Synaptobrevin und Syntaxin führt zur Membranauflösung an der präsynaptischen Andockstelle: damit ist die Voraussetzung für die Exozytose geschaffen.
Die Endozytose. Nachdem der Neurotransmitter sozusagen seine Pflicht und Schuldigkeit getan hat, erfolgt unter Vermittlung von rab5 die Endozytose. Zwecks Rückaufnahme des Transmitters wird die präsynaptische Membran stellenweise aufgelöst. Sodann wird der Neurotransmitter innerhalb des Axonendknotens umgeben von einer völlig neuen Membran bestehend aus Clathrin. Sobald der Umhüllungsprozess abgeschlossen ist, tritt ein neues Protein in Aktion: Dynamin. Es schneidet den Vesikel innen ab.
Um Sie einwenig zu beruhigen, solche speziellen Einzelheiten wird kaum jemand in einer neurobiologischen Prüfung oder in einer Klausur als Grundwissen abfragen. Es sei denn, Sie wollen von sich aus ergänzend in einer Prüfung Ihren Prüfer oder Ihre Prüferin erfreuen und ein hervorragendes Prüfungsergebnis erzielen. Genau, solche Überraschungen habe ich schon erlebt.
Jetzt wollen wir den Schwierigkeitsgrad noch etwassteigern und uns mit der Funktionsweise „langsamer Synapsen“ beschäftigen. Damit stellt sich sofort die Frage: warum sind langsame Synapsen langsam? Welche Vorteile hat langsame synaptische Übertragung gegenüber der schnellen? Wenn man die Frage so stellt, könnte man sie eigentlich mit einem klaren „nein“ beantworten. Denn schnelle Synapsen sind dort angebracht, wo Information spontan schnell übertragen werden muss, z.B. bei der Motorkoordination. Langsame Synapsen sind dort angebracht, wo Information gespeichert werden soll. Diese Synapsen sind deshalb relativ langsam, weil hier komplexe biochemische Prozesse in Form von Signal-Transduktionen (Signal-Kaskaden) ablaufen. Die Aufgabe langsamer Synapsen besteht nämlich darin, unter Einbezug eines 1. Boten (first messenger) und eines 2. Boten (second messenger) mindestens zwei verschiedene Prozesse auszulösen: einerseits dafür zu sorgen, dass die Information auf das nachgeschaltete Neuron durch Regulierung von Ionenkanälen der Zellmembran übertragen wird; andererseits dafür zu sorgen, dass der Informationstransfer im nachgeschalteten Neuron Spuren hinterlässt, z.B. in Form von Strukturänderungen. Hierbei kann es sich um Gedächtnisspuren handeln im Zusammenhang mit langfristiger Speicherung von Information, – als Bestandteil des Langzeitgedächtnisses. Unter Strukturänderung versteht man z.B. neue Verknüpfungen mitnachgeschalteten Neuronen über die Bildung und Verzweigung von Axonkollateralen. Wenn wir also etwas dauerhaft lernen, dann bilden sich zwischen bestimmten Neuronen neue Verknüpfungen aus. Weisheit ist demnach keineswegs mit der Anzahl der Neuronen im Gehirn korreliert – denn die nimmt ja bekanntlich im Laufe des Alters ab –, sondern mit der Anzahl neuer Verknüpfungen. Wenn Sie in dieser Vorlesung etwas gelernt haben – und davon möchte ich ausgehen dürfen – dann haben sich in Ihrem Gehirn strukturelle Veränderungen in Gestalt neuer Verknüpfungen ergeben. Diese Erkenntnis ist noch nicht sehr alt – auf die Verleihung des Nobelpreises an Eric Kandel 2000 in diesem Zusammenhang hatte ich ja schon hingewiesen – und wir wollen jetzt sehen, wie das etwa funktioniert.
Frage: über welche Signalwege kann Neurotransmitter an einer langsamen Synapse strukturelle Veränderungen im Zusammenhang mit langfristiger Informationsspeicherung induzieren. Betrachten wir hierzu diese Folie. Dies hier sei ein Axonendknoten eines vorgeschalteten Neurons; die Vesikel mögen als Neurotransmitter Noradrenalin enthalten. Die Transmitter-Ausschüttung erfolgt wie bei den schnellen Synapsen: AP -> Ca2+ Signal -> Vesikel-Exozytose -> Andocken des Neurotransmitters an den zugeordneten Rezeptor der postsynaptischen Membran. Bei diesem Rezeptor handelt es sich um einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor, – und darin unterscheidet ersich von den Rezeptoren der schnellen Synapsen. Was bedeutet das? G-Proteine sind GTP-aktivierte Proteine, und sie wirken als Signal übertragende Proteine. Wenn diese als Folge der Transmitter-Rezeptorbindung aktiviert sind, resultiert daraus eine Aktivierung des Enzyms Adenylatcyclase AC. Jenes vermittelt die Bildung von cyclischem Adenosinmonophosphat cAMP aus Adenosintriphosphat ATP. Während also in diesem komplexen Prozess Noradrenalin als „1st messenger“ fungiert, bildet cAMP den „2nd messenger“. cAMP ist zellbiologisch in sehr vielfältige Funktionen eingebunden. Sie werden daher in verschiedenen Vorlesungen mit cAMP Bekanntschaft machen: Zellbiologie, Biochemie, Genetik, Mikrobiologie, Pflanzenphysiologie, Evolutionsbiologie, Sinnesphysiologie, Neurophysiologie usw.
In unserem Falle ist der Adressat von cAMP die Poteinkinase A, PKA. Jene phosphoryliert Proteine mit dem Ziel, die Proteinstruktur zu verändern. So führt PKA zur Öffnung von Na+ Kanälen und, durch Na+ Einstrom, zu einem erregenden postsynaptischen Potential EPSP. Das, was also bei den rezeptorgesteuerten Na+ Kanälen der schnellen Synapsen quasi in einem Zug ging, vollzieht sich hier über Zwischenschritte relativ langsam. Der „Pfiff“ der langsamen Synapsen besteht nun darin, dass sich die Signalwege von der PKA aus gabeln. PKA kann nämlich nicht nur die Tunnelproteine der Na+ Kanäle phosphorylieren und jene für Na+ Ionen passierfähig machen, sondern sie kann auch Regulator-Proteine der DNA im Zellkern phosphorylieren. Die hierdurch eingeleiteten Transkriptionsprozesse führen über mRMA zur Synthese bestimmter Proteine. Solche Proteine können ihrerseits verschiedene Prozesse auslösen: einerseits können sie dazudienen, die Dichte der Rezeptoren an der postsynaptischen Membran zu erhöhen und damit den synaptischen Signaltransfer verbessern. Dadurch wird die postsynaptische Membran empfindlicher für den zugeordneten Neurotransmitter.
Ferner werden bestimmte andere Proteine hergestellt, die die Zelladhäsion im Axon herunterfahren und damit die Voraussetzung für die Entstehung von Axonkollateralen bilden. Wie ist das zu verstehen? Der Zusammenhalt in der Zelle wird durch Zelladhäsion gesichert. Hierzu dienen Zelladhäsionsmoleküle. Werden diese Moleküle gehemmt, dann kann die Zelle ihre Struktur – z.B. durch Bildung axonaler Verzweigungen – verändern.
Unter den langsamen Synapsen gibt es noch einen weiteren Typ, dessen Aufgabe u.a. darin besteht, die synaptische Übertragung zu potenzieren. Auch hier finden wir an der postsynaptischen Membran G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Neurotransmitter als „1st messenger“ ist Glutamat. Durch G-Protein werden hier allerdings zwei verschiedene „2nd messenger“ aktiviert: zum einen die Phospholipase-C PLC, die über Diacylglycerin DAG die membrangebundene Proteinkinase-C PKC aktiviert. PKC tritt in das Zytoplasma und phosphoryliert daraufhin Na+ Kanäle der postsynaptischen Membran; der resultierende Na+ Einstrom bedingt ein EPSP.
Zum anderen führt PLC zur Bildung von Inositoltriphosphat IP3, das an die Membran des endoplasmatischen Reticulum ER andockt und Ca2+ Kanäle öffnet. Das ERist reich an Ca2+ Ionen, die daraufhin in das Zytoplasma diffundieren (im Austausch gegen Mg2+ Ionen). Sodann können Ca2+ Ionen z.B. die Synthese von Stickstoffmonoxid NO stimulieren, das nun seinerseits auf komplizierten Wegen – retrograd transneuronal, vermittelt durch Gliazellen – in den Axonendknoten des vorgeschalteten Neurons eindringt und das Enzym Guanylatcyclase GC aktiviert. Jenes vermittelt die Bildung von cyclischem Guanylatmonophosphat cGMP, das nun seinerseits den präsynaptischen, AP-abhängigen Ca2+ Einstrom verstärkt und folglich die Synapse durch erhöhte Neurotransmitter-Ausschüttung potenziert.
Gibt es hierzu Fragen? Natürlich gibt es Fragen, denn in der soeben besprochenen Kausalkette habe ich einen wichtigen Zwischenschritt ausgelassen. Frage: auf welche Weise kann cGMP die spannungsabhängigen Ca2+ Kanäle der Axonendknotenmembran beeinflussen? Antwort: nicht direkt, sondern indirekt durch Phosphorylierung, d.h. Schließung, von K+ Kanälen. Dann kann nämlich ein präsynaptisch eintreffendes AP nicht durch das K+ Ausstromsystem repolarisiert werden. Dafür wird die Depolarisation des AP verlängert, was sich entsprechend stimulierend auf die Öffnung der Ca2+ Kanäle auswirkt.
Haben Sie das verstanden? Falls nicht, wollen wir die Entstehungsweise eines AP kurz rekapitulieren. Nach überschwelliger Depolarisation der Membran des Axonhügels öffnen sich zuerst Na+ Kanäle, es folgt Na+ Einstrom, die resultierende Membran-Depolarisation im Verlaufdes Hodgkin-Zyklus bedingt die Anstiegsflanke des AP, woraufhin Na+ Kanäle inaktiviert werden; sequenziell öffnen sich dann K+ Kanäle und der K+ Ausstrom bedingt durch Repolarisation die Abstiegsflanke des AP. So weit so gut, was aber geschieht, wenn die K+ Kanäle durch cGMP inaktiviert d.h. geschlossen bleiben? Dann kann keine Repolarisation eintreten, und die Depolarisationsphase des AP verlängert sich.
Lassen Sie uns an dieser Stelle drei wichtige Punkte festhalten, die für das Lernen und die Gedächtnisbildung von großem Interesse sind:
- Bahnung: die Verstärkung (Potenzierung) vorhandener alter Synapsen innerhalb weniger Sekunden, wobei z.B. durch äußere Stimuli die Signalübermittlung zwischen Neuronen gebahnt wird.
- Vernetzung: die Ausbildung neuer Fortsätze und neuer Verknüpfungen zwischen Neuronen innerhalb weniger Stunden, wodurch eine langfristige Speicherung von Information möglich ist.
- Frischzellen: die Produktion neuer Neurone durch Teilungsfähigkeit im Hippokampus unter dem Einfluss von sensorischen und/oder motorischen Aktivitäten innerhalb von Tagen bis Wochen, womit Plastizität und Kreativität gewährleistet sind.
Wir kommen jetzt zu einem neuen Punkt, der die Funktion von Synapsen betrifft, nämlich ihre Eigenschaft als Rechner. Neuronen beherrschen nämlich – aufgrund ihrer synaptischen Eingänge – die drei Grundrechenarten: addieren, subtrahieren und multiplizieren. Bevor wir darauf näher eingehen, vergegenwärtigen wir uns noch einmal zwei grundlegende Neuronenschaltungen. Man spricht von Konvergenzschaltung, wenn ein Neuron über mehrere Synapsen Eingänge verarbeitet, und von Divergenzschaltung, wenn dieses Neuron das Ergebnis der Verarbeitung über Axonkollaterale an andere Neurone weitergibt.
Betrachten wir zunächst die Addition: zwei Neurone N1 und N2 mögen jeweils über eine erregende Synapse auf ein Neuron N3 konvergieren. Dann wird jeweils in N1 und in N2 eine präsynaptisch eintreffende Sequenz vonAPs (über die Freisetzung eines bestimmten Neurotransmitters, z.B. ACh) Na+ Ionen-Einstrom in N3 auslösen und zu einem EPSP führen, dessen Amplitude von der Frequenz der präsynaptischen APs abhängig ist. Die von beiden Synapsen stammenden EPSPs werden sich dann, über das Soma von N3 ausbreitend, zu einem EPSP von entsprechend höherer Amplitude addieren und im Axonhügel von N3 eine AP-Sequenz von entsprechend höherer Frequenz generieren.
Jetzt kommen wir zur Subtraktion. Sie ist im Grunde genommen der Addition vergleichbar, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Für die Vorzeichenumkehr sorgt eine hemmende Synapse. Wir gehen von der gleichen Konvergenzschaltung aus: N1 und N2 konvergieren über ihre Axonendknoten auf ein Neuron N3. Im Gegensatz zum vorigen Beispiel sei jedoch die Synapse zwischen N2 und N3 hemmend, d.h. entsprechend anders ist der Neurotransmitter (z.B. Gamma-Aminobuttersäure GABA): er öffnet Cl- Ionenkanäle der postsynaptischen Membran. Dann wird eine präsynaptisch eintreffende Sequenz von APs über N1 einen Na+ Ionen-Einstrom in N3 auslösen und zu einem EPSP führen, dessen positive Amplitude mit der Frequenz der präsynaptischen APs korreliert ist; demgegenüber wird eine präsynaptisch eintreffende Sequenz von APs über N2 einen Cl- Ionen-Einstrom in N3 auslösen und zu einem IPSP führen, dessen negative Amplitude mit der Frequenz der präsynaptischen APs korreliert ist. Die AP-Frequenz in N1 sei größer als die in N2. Die von den Synapsen stammenden EPSP und IPSP werden sich über das Soma von N3 ausbreiten und mit umgekehrten Vorzeichen addieren, d.h. das IPSP wird vom EPSP subtrahiert, so dass das resultierende EPSP (von entsprechend geringerer Amplitude) im Axonhügel von N3 eine AP-Sequenz von entsprechend geringerer Frequenz generiert. Was bedeutet das? Wir können sagen, wenn ein Neuron N1 mit einem Neuron N3 exzitatorisch verknüpft ist, dann wird der Erregungstransfer reduziert, sofern ein Neuron N2 über eine hemmende Synapse mit N3 verbunden ist, gesetzt den Fall N1 und N2 sind gleichzeitig aktiv.
Was aber versteht man „neuronal“ unter Multiplikation? Betrachten wir einen Fall, in dem der Faktor <1 ist. Sie werden zu Recht sagen, genau, das läuft ja wieder auf eine Hemmung hinaus, richtig, allerdings auf keine Subtraktion wie im soeben erwähnten Beispiel, sondern auf die Hemmung um einen Faktor. Diese Art Hemmungkommt z.B. bei der Unterdrückung von Schmerzen zur Geltung. Angenommen ich habe Zahnschmerzen. Im Sprechzimmer des Zahnarztes angekommen, lässt der Schmerz bereits deutlich nach, und sobald mich der Zahnarzt auf den Behandlungsstuhl bittet und fragt, wo es denn weh tut, scheint der Schmerz wie weggeblasen. Anderes Beispiel. Kürzlich hatte ich eine sehr schmerzhafte einseitige Bandscheibengeschichte. Als mich der freundliche Orthopäde fragte, auf welcher Seite ich Schmerzen hätte – ich wusste es vorher noch genau – sagte ich, ich glaube hier, oder dort, nein hier, ja eigentlich nirgends. Das ist keineswegs Einbildung, und das ist auch keine Wunder. Vielmehr ist dies neurophysiologisch erklärbar. Dazu noch ein Beispiel. Der Zahnarzt fängt an, zu bohren, und das tut in der Tat weh. Was unternehme ich dagegen? Ich kneife mit der rechten Hand die linke oder umgekehrt, und das mildert den Zahnschmerz. Wie ist das möglich? Es könnte sich hierbei schlicht und ergreifend um eine Aufmerksamkeitsverschiebung handeln: die Konzentration auf den nicht abschätzbaren Zahnschmerz wird durch Konzentration auf den dosierbaren selbst zugefügten Schmerz verschoben. Es wäre aber auch möglich, dass die durch das Zahnbohren aktivierte Schmerzbahn durch den Signalweg des selbst zugefügten Schmerzes gehemmt wird.
Wir wissen zwar nicht, welches die Bahnen für die soeben geschilderte Schmerzhemmung sind und wie sie interagieren. Allerdings gibt es relativ gut untersuchte Beispiele fürSchmerzausschaltung; die zugeordneten Neuronenschaltungen befinden sich im Rückenmark, und wir kennen sogar die zugeordneten Neurotransmitter. Mit denen wollen wir uns jetzt im Zusammenhang multiplikativer Verrechnungen auseinandersetzen.
Fragen wir uns zwischendurch, welche Gehirnregionen bei Additionen, Multiplikationen und Subtraktionen aktiv sind. Bei Addition und Subtraktion werden beide Hirnhälften punktuell verteilt beansprucht, wenn auch unterschiedlich stark, während bei der Multiplikation punktuelle Unilateralität vorherrscht. Was das im Einzelnen genau bedeutet, weiß man z. Z. noch nicht.
Multiplikative Verrechnungen setzen immer eine bestimmte Synapsenkonfiguration voraus, und zwar in Gestalt einer axo-axonischen Synapse: hierbei bildet der Axonendknoten eines Neurons eine Synapse mit dem seitlichen Axonendknoten eines anderen Neurons. Betrachten wir eine Körperregion, in der ein Schmerzreiz gesetzt wird; dieser wird von einer Schmerzfaser erfasst. (Bei der Schmerzfaser handelt es sich um eine Sinnesnervenfaser, deren Zellkörper im Spinalganglion des Rückenmarks liegt.) Der Axonendknoten der Schmerzfaser bildet im Rückenmark mit einem Schmerz-Neuron eine Synapse, das die Schmerzinformation dem Gehirn – zwecks Schmerzbewertung – zuführt. Der erregende Neurotransmitter heißt Substanz P, und zwar P für englisch „pain“. Wenn wir in jener Körperregion Schmerzen haben, dann werden die Schmerzen auf diesem Wege aufgenommen und übertragen, und das Gehirn nimmt sie wahr. Neben dem Schmerz-Neuron gibt es noch einenanderen Neuronentyp, nämlich ein Schmerz-Modulatorneuron. Interessanterweise bildet der Axonendknoten dieses Neurons eine Synapse am Axonendknoten der Schmerzsinnesnervenfaser (=axo-axonische Synapse) und moduliert damit – reduzierend – die Ausschüttung des Transmitters Substanz P.
Wenn unter bestimmten Bedingungen dieses Schmerz-Modulatorneuron aktiviert wird, dann sollte die Schmerzleitung gehemmt werden. Die möglichen Bedingungen kennen wir inzwischen. Der "Weißkittel-Effekt" des Zahnarztes ist psychisch, also vom Gehirn aus gesteuert. Bei dem Neurotransmitter handelt es sich um ein endogenes Morphin, das (Endorphin) Methionin-Enkephalin. Es führt dazu, dass Ca2+ Ionenkanäle für die Schmerzübertragung mittels Substanz P geschlossen werden.
Vielleicht können solche Schmerz-Modulatorneurone aber auch aktiviert werden unter dem Einfluss von Akupunktur. Das Ergebnis dieser Methode ist zwar unzweifelhaft, man weiß allerdings nicht, ob die Akupunkturnadel (nur) auf diesem Wege wirksam ist. Tatsächlich hat man jedoch in der Rückenmarksflüssigkeit=Zerebrospinalflüssigkeit von Ratten, die akupunktiert wurden, eine erhöhte Konzentration von Endorphinen gefunden. Lassen Sie uns schauen, wo solche Endorphine lokalisiert sind. Wir sehen eine relativ hohe Dichte von Opiatrezeptoren im sog. Hinterhorn des Rückenmarks.
Abschließend wollen wir uns einen Video-Clip ansehen, der illustriert,wie beispielsweise Migräne zustande kommt, was man früher darüber dachte, und wie sich Migräne heutzutage therapieren lässt, – unter anderem auch durch Akupunktur. Daran anknüpfend werde ich Ihnen eine Art „Werbefilm“ aus dem chinesischen Fernsehen vorführen, der offenbar zeigt, dass selbst eine Lungenoperation unter dem Einfluss von Akupunktur schmerzfrei durchgeführt werden kann. Danach werden wir ein paar Aspekte zur Akupunktur aus wissenschaftlicher Sicht hören.
Also, die Migräne galt lange Zeit als eine Art einseitige Durchblutungsstörung im Gehirn. Das besagte eigentlich alles und gar nichts. Inzwischen sind jedoch Verfahren entwickelt worden, die diesen Kopfschmerz sichtbar machen, Schmerzzentren im Gehirn lokalisieren und es erlauben, Medikamente gezielt einzusetzen. Wie wir heute wissen, sind Durchblutungsstörungen keineswegs (allein) die Ursache der Migräne; in der Regel kann während der Schmerzattacke die Blutzufuhr sogar weitgehend normal sein. Vielmehr scheint das Gehirn von Migränepatienten besonders stark auf äußere Reize zu reagieren:
Außenreize:
Starke Neurotransmitterausschüttung
- Arterienerweiterung
- Entzündungsreaktionen durch Gefäß-aktive Neuropeptide
- Gefäßschmerzen der Hirnhaut (Dura mater)
Nebenwirkung:
Massive Neurotransmitterfreisetzung simuliert „Vergiftung“.
Folge: Übelkeit, Erbrechen
Konsequenz: Serotonin-Mangel [Hinweis: Serotonin wirkt analgetisch]Therapie: z.B. Triptane (Relpax®=Eletripan) =Serotonin-Agonisten, alternativ oder kombiniert mit Akupunktur
Verfolgen wir eine typische Migränepatientenkarriere: der Neurologe hatte nichts gefunden. Für ihn war der Patient kerngesund. Der Patient litt aber an Übelkeit, es war ihm schlecht, und er hatte sodann Kopfschmerzen. Als nichts mehr zu helfen schien, hatte er es mit Akupunktur versucht. An dieser Therapie scheiden sich die Geister: Heilung oder Hokuspokus? Naturwissenschaftliche Erklärungen für den Erfolg von Akupunktur sind z. Z. noch rar. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass, wie wir bereits gesehen haben, von den „Akupunktur-Nadeln“ auf der Haut Signale ins Rückmark gehen, die die Schmerzleitung zum Gehirn hemmen. Dennoch bleibt die Wirkung von Akupunktur immer noch ein Rätsel für die Wissenschaft.
Das war’s für Block4, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
_________________________________________________
Block5: Lernprozesse
Aplysia, Synaptische Sensitisierung, Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, CREB1/2; Konditionierung, Langzeit-Potenzierung(LTP) und Langzeit-Depression(LTD)
_________________________________________________
vgl. Abbildungen Block 5
Fragen zu Block 5:
• Welche Stadien des Gedächtnisses lassen sich unterscheiden?
• Welche Gedächtnissysteme kann man unterscheiden?
• Grundlagenforschung: Welche neuronalen Prozesse spielen beim Kurzzeit-Gedächtnis der Meeresschnecke Aplysia eine Rolle?
• Welche neuronalen Prozesse spielen beim Langzeit-Gedächtnis von Aplysia eine Rolle?
• Was könnten Regulator-Proteine CREB1/CREB2 des Zellkerns mit Supergedächtnisleistungen bzw. Gedächtnislücken zu tun haben?
• Bilden Prionen einen Schlüssel zur Erinnerungsfähigkeit?
• Wie lassen sich synaptische Übertragungseigenschaften modulieren?
• Assoziatives Lernen: Wie lässt sich klassische Konditionierung durch Hebb-Synapsen erklären?
• Welches Trainingsmuster kommt bei der klassischen Konditionierung zum Einsatz?
• Furcht-Konditionierung bei der Ratte durch Langzeitpotenzierung (LTP): Welche Neuronenschaltung könnte zugrundeliegen?
• Furcht-Konditionierung bei der Ratte: Auf welchen neurochemischen Prozessen könnte die LTP beruhen?
• Welche Wirkungen können Ca 2+ Ionen bei LTP entfalten?
• Lidschlag-Konditionierung beim Kaninchen durch Langzeitdepression (LTD): Wie wird Lidschlag-Konditionierung induziert?
• Lidschlag-Konditionierung beim Kaninchen durch LTD: Welche Neuronenschaltung könnte zugrundeliegen?
• Lidschlag-Konditionierung beim Kaninchen: Auf welchen neurochemischen Prozessen könnte die LTD beruhen?
• Zusammenfassende Übersicht (I): Welche Prozesse im Neuron werden durch cAMP/PKA gesteuert?
• Zusammenfassende Übersicht (II): Welche Prozesse im Neuron werden durch IP3/Ca 2+ gesteuert?
• Zusammenfassende Übersicht (III): Welche Folgeprozesse im Neuron werden durch den Mediator NO beeinflusst?
.
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie zu Block5 der Vorlesung. Heute wollen wir uns mit den neurobiologischen Grundlagen des Lernens beschäftigen. Sie werden im Laufe der bisherigen Blöcke gesehen haben, dass wir uns von relativ einfachen Zusammenhängen mehr und mehr zu komplizierten hochgearbeitet haben. Jetzt stehen wir vor den wohl komplexesten, aber auch aufregendsten Prozessen: Speichern, Gedächtnis, Erinnern.
Auf die Verleihung des Nobelpreises in diesem Zusammenhang an den Neurobiologen Eric Kandel im Jahre 2000 habe ich bereits an verschiedenen Stellen hingewiesen. Heute werden wir nun endlich einige seiner wichtigsten Arbeiten besprechen. Kandel hat seine Erkenntnisse im Tierversuch an der Meeresschnecke Aplysia gewonnen und die zugrunde liegenden Prinzipien auf Säugetiere und damit auch auf den Menschen übertragen können, so dass das Ganze tatsächlich eine hochinteressante Angelegenheit ist: denn prinzipiell scheinen Schnecken wohl ähnlich zu lernen – und Gelerntes zu behalten – wie Menschen. Diese Nachricht steht natürlich im Interesse der Presse. Hier einige Ausschnitte aus Focus (2003): Merken mit Molekülen; VOX (2005): Gibt es bald eine Gedächtnispille? FAZ (2005): Sind Erinnerungen ansteckend?
Wir kommen darauf detailliert zu sprechen. Ich werde mich bemühen, diese komplizierte Materie so einfach wie möglich darzustellen, möchte Sie allerdings wieder bitten, zwischendurch zu fragen, wenn Ihnen irgendwelche Fakten nebulös erscheinen und Sie den Eindruck haben, dass ich bestimmte Zusammenhänge nicht deutlich genug erklärt habe; haken Sie also einfach nach. Dies ist auch insofern wichtig, weil ich kausalanalytisch vorgehe Schritt für Schritt, bzw. Schritt und Folgeschritt. Bliebe ein Schritt von Ihnen nicht verstanden, dann lägen auch die Folgeschritte im Dunkeln. Jetzt aber genug der allgemeinen Rederei.
Zum Menü des heutigen Tages: Zunächst stelle ich Ihnen die Meeresschnecke Aplysia vor, – auch Seehase genannt. Wir beginnen mit einfachen Lernleistungen, den synaptischen Sensitisierungen, werden uns sodann dem Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis zuwenden und in diesem Zusammenhang wichtige Transkriptionsfaktoren CREB1/CREB2 kennen lernen, die für das Langzeitgedächtnis verantwortlich sind. Wir werden uns dann weiter mit Phänomenen der Konditionierungen beschäftigen. In diesem Zusammenhang wichtig sind z.B. konditionierte synaptische Bahnungs- und Hemmungsprozesse vermittelt durch synaptische Langzeitpotenzierung LTP bzw. Langzeitdepression LTD.
Beginnen wir mit der simplen Frage: was ist Lernen? Antwort: Lernen hängt eng zusammen mit der Gewinnung und Speicherung von Information, die abgerufen werden kann. Was versteht man unter Informationsspeicherung? Nun, Informationsspeicherung ist jede Art eines neuronalen Prozesses, der dazu führt, dass ein Signal im Nervensystem eine Wirkung, hinterlässt, präziser gesagt eine Nachwirkung. Wir nehmen ein Umwelt-Signal auf und dieses hinterlässt im Nervensystem eine Nachwirkung, verbunden mit der Möglichkeit der Erinnerungsfähigkeit. Nun kann man sich fragen: was ist Nachwirkung? Nachwirkung hängt zusammen mit Speicherung. Wir unterscheiden mindestens drei verschiedene Formen der Speicherung in der Nachwirkung von Signalen.
Zunächst einmal die kurzfristigen Speicherungen. Es gibt sogar eine ultrakurze Speicherung, das Ultrakurzzeitgedächtnis UZG. Darunter verstehen wir die Fähigkeit, ein Signal, das etwa 100 bis 200 Millisekunden kurz auftritt, ikonenhaft abzuspeichern. Dies sind Phänomene, denen sich das Fernsehen bei Reklamespots sehr häufig bedient. Oft sehen wir Signale als extrem kurze Einblendungen, die wir uns – Aufmerksamkeit steigernd – ikonenhaft einprägen. Diese Augenblicke können eine größere Signalwirkung haben, als eine längere Szene. Wenn man – ich meine natürlich „Mann“ – in einer Reklameszene für einen kurzen Augenblick ein Frauenbein sieht, dann erhöht das enorm und nachhaltig die Aufmerksamkeit, auch, wenn in der Reklame etwas völlig anderes angepriesen wird, z.B. Zahnpasta.
Mit kurzfristiger Speicherung verbinden wir noch ein anderes Kurzzeitgedächtnis KZG, das sog. Notizblockgedächtnis=Arbeitsgedächtnis. Es dauert 1 bis 60 sec, also etwa solange man das Schlagen der Kirchturmuhr zurückverfolgen kann. Beispiel: Angenommen, wir wollen beim Handwerken eine Latte ausmessen; dann zeigt der Zollstock z.B. 68cm an; genau, die merken wir uns, indem wir lautlos wiederholen: 68, 68, 68, 68, ....... Sodann tragen wir die Länge 68cm in unsere Bauzeichnung ein. Die 68 cm sind relativ schnell vergessen – Gott sei Dank –, denn stellen Sie sich vor, wir würden tagelang – oder gar unser Leben lang – über 68cm nachdenken. Daher auch der Name Notizblockgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis. Es erleichtert uns die Arbeit, in dem wir kurzfristig Information speichern, um mit ihr kurzfristig arbeiten zu können und, um sie danach schnell wieder zu vergessen. Auch das Vergessen ist ein von der Natur gewollter Prozess. Manche Menschen sind arm dran, denn sie können Nebensächlichkeiten einfach nicht vergessen. Ich werde Ihnen später darlegen, worauf das beruht.
Demgegenüber entspricht der langfristigen Speicherung das Langzeitgedächtnis LZG. Dieses dauert Tage bis Jahrzehnte. Ich kann mich heute noch leicht an Episoden erinnern, die ich vor 60 Jahren erlebte. Man fragt sich, wie das möglich ist. Auch hiermit werden wir uns heute beschäftigen.
Damit Information in das Nervensystem gelangen und gespeichert werden kann, muss erst eine bestimmte Zeit verstreichen; diese Zeit heißt in der Fachsprache Konsolidierungszeit. Es ist also jene Zeit, die Information benötigt, um vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis überführt werden können. Wird diese Zeit durch irgendwelche Ereignisse unterbrochen, kann die Langzeitspeicherung verhindert werden. Darauf beruhen z.B. Phänomene der retrograden Amnesie: der Verlust der Erinnerungsfähigkeit eines zurückliegenden Ereignisses. Wenn man z.B. bei einem Verkehrsunfall unter psychischer und/oder physischer Schockwirkung steht, kann man sich häufig nicht mehr an den Verlauf des Geschehens erinnern; eben, weil der Schock innerhalb der Konsolidierungszeit stattgefunden hat. Im Tierexperiment lässt sich die Konsolidierungszeit genau berechnen: Schocks, die nach der Konsolidierungszeit eintreten, haben auf die langfristige Gedächtnisspeicherung keinen Einfluss mehr.
Wir wollen jetzt auf Gedächtnis-Systeme zu sprechen kommen. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen: das explizite Gedächtnis (bewusst, deklarativ, verbal) und das implizite Gedächtnis (unbewusst, nicht-deklarativ, nicht-verbal). Das explizite deklarative Gedächtnis untergliedert sich in das Episodengedächtnis (persönliches und autobiografisches Wissen von Zusammenhängen), und das semantische Gedächtnis (lexikalisches Wissen=Weltwissen von Einzelheiten). Weltwissen hat mit persönlichem Erleben nichts zu tun. Das implizite Gedächtnis ist unterteilt in das prozedurale Gedächtnis (Speicherung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten). Wenn ich Fahrrad fahren lerne oder andere Motorkoordinationen trainiere und wiederhole und diese schließlich beherrsche, dann ist das eine Speicherung, die sich hauptsächlich unbewusst vollzieht. Diese verschiedenen Formen des Gedächtnisses sind unterschiedlichen Hirnregionen, z.T. überlappend, zugeordnet; darauf wollen wir hier nicht näher eingehen. Eine weitere Form des impliziten Gedächtnisses ist das Priming, wodurch bestimmte Ereignisse leichter gespeichert werden können.
Steigen wir jetzt also in die Grundlagen der Gedächtnisfunktionen ein; wie Sie in dem bereits bekannten Übersichtsbild aus der Zeitschrift Focus sehen, zählt dies heute bereits zum Allgemeinwissen. Die in dieser Abbildung dargestellten Zusammenhänge sind zwar stark vereinfacht, aber sehr instruktiv und sind daher als Aufmacher oder Aufhänger für das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, bestens geeignet: der Lernprozess beginnt mit dem Aufnehmen von Informationen und endet in deren Verankerung. Beispiel:
(1) Beim Lernen lesen wir eine Zahl und wiederholen sie in Gedanken.
(2) Das Gehirn filtert die Information und leitet sie zur Gedächtnisbildung weiter; im Zentrum der Gedächtnisbildung stehen Nervenzellen und ihre Synapsen.
(3) An solchen Synapsen wird aus dem Endknoten der Neurotransmitter Glutamat ausgeschüttet. Glutamat überträgt das Signal zur nächsten Nervenzelle, indem es an NMDA Rezeptoren der postsynaptischen Membran andockt. Dies wiederum fördert im nachgeschalteten Neuron die Bildung eines sog. Gedächtnis-Proteins, CREB genannt.
(4) CREB seinerseits induziert als Transkriptionsfaktor im Zellkern die Bildung von mRNA, und es werden Proteine unterschiedlicher Funktion gebildet.
(5) Einige Proteine sorgen z.B. dafür, dass neue Synapsen entstehen bzw. alte gefestigt werden. Die Information ist jetzt verankert, und es reichen schon geringe Reize aus, um ihn wieder abzurufen.
Wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, welche biochemische Maschinerie sich hinter diesem Ganzen verbirgt. Beginnen wir zunächst mit einfachen Lernprozessen bei der Meeresschnecke Aplysia, die hier grob umrissen ist. Sie hat einen Kopf mit zwei Fühlern und einen Kriechfuß, dessen Ende sich zu einer Art Schwanz verjüngt. Seitlich der Körpermitte befindet sich eine Kieme, die mit einer röhrenartigen Körperfalte, dem Sipho, verbunden ist. Sipho und Kieme dienen der Atmung. Daher mag Aplysia es überhaupt nicht, wenn ihr Sipho – z.B. von einem Feind – gezwickt und dadurch ihre Lebensfreude beeinträchtigt wird. Sie zieht dann ihre empfindliche Kieme unter einer Mantelfalte schützend ein. Bei dieser einfachen Verhaltensreaktion handelt es sich um eine Art Schutzreflex. Wenn allerdings dieser Feind der leidgeprüften Aplysia auch noch auf den Fuß tritt, dann wird sie eklig, d.h. hyperempfindlich. Hypersensitiv sie dann ist, genügt schon eine schwache Berührung ihres Sipho, um ihre Kieme schützend unter die Mantelfalte einzuziehen. Das bedeutet: durch Reizung des Fußes wird die Signalübertragung zwischen Sipho und Kieme sensitiviert, und diese Empfindlichkeit bleibt eine kurze Zeitlang im Gedächtnis der Schnecke erhalten, wird also kurzfristig gespeichert.
Würde sich ein Mensch in einer entsprechenden Situation nicht ähnlich verhalten? Wenn mir jemand auf die Schulter haut, dann reagiere ich entsprechend. Tritt mir jemand, dann auch noch auf den Fuß, dann reagiere ich entsprechend heftiger. Fasst mir danach jemand auch nur behutsam auf die Schulter, raste ich aus. Diese Empfindlichkeit hält eine Zeitlang an.
Jetzt wollen wir bei Aplysia prüfen, welche Neuronen-Schaltung ihrem Schutzreflex zu Grunde liegt. Im Sipho befindet sich ein sensorisches Neuron S1, das auf mechanische Berührung Signale zum Motorneuron MN der Kieme sendet. Die Signalübertragung auf das motorische Neuron wird vermittelt durch einen Neurotransmitter. Wird das Sipho-Neuron aktiviert, dann wird die Kiemenmuskulatur kontrahiert.
Nun kommt der Schwanz ins Spiel: im Schwanz befindet sich ein anderes sensorisches Neuron S2. Wird der Schwanz berührt, dann wird die Information übertragen auf ein erregendes Zwischenneuron EN, das mit dem Axonendknoten des Neuron S1 eine axo-axonische Synapse bildet; Neurotransmitter ist Serotonin. Als Folge der Serotonin-Ausschüttung wird die Transmitter-Ausschüttung zum Motorneuron MN verstärkt; d.h. der Signalweg S1-> MN wird durch den Signalweg S2-> EN->S1 sensitiviert.
Wie funktioniert das? Wir vergrößern den fraglichen Abschnitt in dieser Darstellung und verfolgen, was hier neuronal geschieht. Hier ist der Axonendknoten von EN (der von S2 erregt wird) und dort ist der Axonendknoten von S1, der eine Synapse mit dem Motorneuron MN bildet. Betrachten wir an dieser Stelle zunächst den Signalfluss von S1 zu MN. Präsynaptische Aktionspotenziale AP (deren Entstehungsweise bekanntlich jeweils auf Na+ Einstrom und zeitlich versetztem K+ Ausstrom beruht) aktivieren Ca2+ Känale, deren Ca2+ Einstrom (gekoppelt mit Mg2+ Ausstrom) die Vesikel-Exozytose induziert. Durch erhöhten Ca2+ Einstrom kann die Vesikel-Exozytose und damit der Transmitterausstoß zu MN verstärkt werden. Wie wir bereits wissen, lässt sich der Ca2+ Einstrom forcieren, wenn K+ Kanäle geschlossen werden, weil dadurch die depolarisierende Wirkung der APs verlängert wird.
Schließlich brauchen wir nur noch zu klären, auf welche Weise das vom EN ausgeschüttete Serotonin eine Signalkette in Gang setzt, die zur Schließung von K+ Kanälen der Axonendknotenmembran von S1 führt. So geht es: auf Aktivierung von S2 hin, und der daraus resultierenden Aktivierung von EN, wird Serotonin in den synaptischen Spalt geschüttet. Serotonin dockt an einen Rezeptor R an, der seinerseits mit einem G-Protein korrespondiert (=G-Protein gekoppelter Rezeptor). Als Folge der Serotonin-Rezeptor-G-Protein-Bindung, wird das Enzym Adenylatzyklase AC aktiviert, das seinerseits die Bildung von cAMP aus ATP vermittelt. cAMP hat als Adressaten die Proteinkinase A, PKA, die K+ Kanäle phosphoryliert. Dies führt dazu, dass K+ Kanäle geschlossen werden. Damit hat sich der kausalanalytische Kreis – im Zusammenhang mit dem zuvor Besprochenen – geschlossen. Diese relativ kurzfristig anhaltende Sensitivierungsphase ist einem Kurzzeitgedächtnis zuzuordnen.
Die Sensitivierungsphase kann jedoch auch langfristig, tagelang anhalten. Wie funktioniert das zugrundeliegende Langzeitgedächtnis der Schnecke? Lassen Sie uns diese, auf den ersten Blick etwas kompliziert anmutende Abbildung, betrachten. Wir befinden uns hier im Bereich des Neuron S1; dort ist die bekannte serotonerge Synapse seitens Neuron EN. Betrachten wir zunächst die Signaltransduktion im Schnelldurchgang: Serotonin führt über cAMP zur Aktivierung von Regulatorproteinen CREB (=cAMP response element binding protein), die über Transkription und Translation solche Proteine synthetisieren lassen, die ihrerseits – durch Aufhebung der Zelladhäsion – Axonkollaterale im sensorischen Neuron S1 entstehen lassen, welche – als Grundlage des Langzeitgedächtnisses – neue dauerhafte synaptische Verbindungen mit dem Motorneuron MN bilden. Betrachten wir diesen Prozess jetzt ganz langsam, sozusagen zum Mitschreiben:
1) Serotonin dockt an Rezeptor R an, G-Protein aktiviert Adenylatzyklase AC, die die Bildung von cAMP aus ATP vermittelt. cAMP hat zwei Proteinkinasen als Adressaten:
2) cAMP wirkt zunächst auf MAPK (mitogen activated proteinkinase).
3) MAPK hemmt CREB2 Protein, wodurch die Hemmung von CREB2 auf CREB1 aufgehoben wird.
4) cAMP wirkt auch auf Proteinkinase A, PKA.
5) PKA aktiviert CREB1.
6) CREB1 – aktiviert und von der Hemmung befreit – aktiviert sog. CRE-Gene (cAMP response element genes).
7) CRE-Gene werden transkribiert, und es kommt zur Synthese von Ubiquitin-Hydrolase.
8) 9)10) Über PKA und MAPK führt der Weg zur Hemmung von Zelladhäsionsmolekülen Aplysia-CAM (cell adhesive molecule).
(1) 11) Durch Aufheben der Zelladhäsion im Axon ist die Voraussetzung für die Abzweigung von Axonkollateralen und damit für die Bildung des Langzeitgedächtnisses geschaffen.
Ich habe an verschiedenen Stellen dieser Vorlesung bereits darauf hingewiesen, dass Lernen, Speicherung und Wissen – also Gedächtnisbildung – auf der Herstellung neuer neuronaler Verknüpfungen beruht, auch bei uns. Kluge Gehirne sind bis zu einem gewissen Grade wohl vernetzter als dumme.
Sie werden nun mit Recht fragen, wenn mit der Aktivierung von CREB1 der Weg für Information in das Langzeitgedächtnis freigegeben wird, welche Aufgabe hat dann CREB2? Durch CREB2 wird dem Eintritt von Informationen in das Langzeitgedächtnis zunächst ein Riegel vorgeschoben. Und das ist ganz wichtig. Gäbe es diesen Riegel nicht, dann würde die arme Schnecke, aber auch wir, uns jeden „Quatsch“ merken. D.h., wenn man ein Telefonbuch lesen würde, dann könnte man es anschließend auswendig. Nun, das ist nicht aus der Luft gegriffen, das gibt es. Manche Menschen, bei denen offenbar die CREB2/CREB1 Balance nicht optimal funktioniert, sind gegen Signalspeicherung machtlos: manche blättern ein Telefonbuch durch und können es anschließend auswendig. Andere schauen sich den Kölner Dom an und können ihn anschließend fotografisch genau zeichnen bis ins letzte Detail mit allen Fenstern und Nischen etc. Das sind sog. Inselbegabungen, wie wir sie beispielsweise von Autisten her kennen.
Normalerweise wird Information der sofortige Eintritt in das Langzeitgedächtnis LZK verwehrt, – in Form des Riegels CREB2. Erst, wenn unter bestimmten Bedingungen jeweils in Intervallen ständig cAMP gebildet wird, dann kann über eine andere Proteinkinase (MAPK, den Namen muss man sich wirklich nicht merken) CREB2 gehemmt, und damit das LZK entriegelt, werden. Dadurch wird CREB1 enthemmt und der Zutritt zum LZK ist offen.
Diese Erkenntnis hat auch Implikationen für die Lernpsychologie. Büffeln, indem man ununterbrochen dieselbe Vokabel wiederholt, führt nicht zur Hemmung von CREB2. Das Gedächtnis kommt einem vor wie blockiert. Intervall-Lernen spielt eine sehr große Rolle. Wenn man Vokabeln in Intervallen lernt, zwischendurch Pausen macht und memoriert, dann sind die Voraussetzungen für die Hemmung von CREB2 – und die Enthemmung von CREB1– geschaffen. Das ist keine Hypothese mehr, sondern eine inzwischen akzeptierte Theorie.
Lassen Sie uns die Gedächtnis-Regulator-Proteine noch etwas beleuchten, denn hier gibt es ganz interessante Aspekte. Ist die Balance der Aktivitäten von CREB2:CREB1 zu Gunsten CREB1 verschoben, dann hat man ein hervorragendes Gedächtnis. Der Extremfall wäre – wie bereits angedeutet – die Inselbegabung, die ihre „Wissensinsel“ einem Supergedächtnis verdankt. Was aber, wenn die Balance der Aktivitäten CREB2:CREB1 stark zu Gunsten CREB2 verschoben ist? Bei gesunden Menschen nimmt im Alter die Merkfähigkeit ab, und es kommt zu plötzlichen – aber vorübergehenden – Gedächtnislücken: man kann die Brille nicht finden, hat die Zeit vergessen, oder kommt nicht auf den Namen seines Nachbarn, – alles, wenn Sie wollen, alltägliche Ärgerlichkeiten. So etwas kann aber auch krankhaft stark ausgeprägt sein.
Dann besteht die Gefahr, dass das Langzeitgedächtnis verkümmert. Wir wissen heutzutage nicht genau, ob bei der Alzheimerschen Krankheit auch solche Prozesse eine Rolle spielen. Neurobiologen suchen intensiv nach Möglichkeiten, Patienten, die an einer Demenz leiden, helfen zu können.
Neurobiologen und Neuropharmazeuten suchen nach Substanzen, die beispielsweise zu einer dosierbaren Hemmung von CREB2 führen. Wäre es nicht schön, wenn man für die Wirkungsdauer einer solchen Substanz – in der Darreichungsform einer „Gedächtnis-Pille“ – sozusagen ein Zeitfenster öffnen könnte, in dem man optimal lernt und behält? Angenommen, Sie bereiten sich auf eine Examensarbeit vor; dann würde solch eine Pille für einen bestimmten Zeitraum das Fenster für die Hemmung von CREB2 öffnen, und auf diese Weise optimal viel Information aufnehmen und speichern lassen. Jeder Vorteil birgt aber auch Gefahren, hier die Gefahr (bei Überdosierung) sein Gedächtnis in ein Supergedächtnis (auch für Nebensächlichkeiten) umzufunktionieren, – eine Horrorvision, wenn infolge der zugrundeliegenden massiven neuronalen Verknüpfungen das Gehirn buchstäblich "verfilzen" würde.
Alles Utopie? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Kürzlich wurde in Nachrichtensendungen von ARD und VOX gezeigt, wie im Labor des pharmazeutischen Unternehmens „Helicon Therapeutics“ an der Entwicklung von Gedächtnis-fördernden Medikamenten gearbeitet wird. Dazu ein kurzer Viodeo-Clip. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Forschung auf diesem Gebiet entwickelt. Die Zukunft hat also bereits begonnen.
Bis jetzt war von Speicherung und Gedächtnis die Rede: langfristige Informationen werden in Form von strukturellen Veränderungen, d.h. von neuen synaptischen Verbindungen zwischen Neuronen – sowie der Bahnung/Sensitivierung ihrer Synapsen – im Langzeitgedächtnis gespeichert. Wie aber funktioniert die Erinnerung? Welche Verbindungen müssen aktiv werden, um zu wissen, welcher Inhalt abgerufen werden soll? Das ist ein Problem. Wie gesagt, ich kann mich an Ereignisse erinnern, die mehr als 60 Jahre zurückliegen. Wie ist es möglich, dass ich mich erinnere? Dies kann eigentlich nur eine chemische Grundlage haben. In Frage kommen Proteine. Diese sind allerdings nicht so lange haltbar, jedenfalls keine 60 Jahre. Folglich müssen hier andere Phänomene mit hinein spielen.
Das, was ich Ihnen jetzt vortrage, sind hypothetische Modellvorstellungen. Sie sind nicht bewiesen, sie weisen jedoch auf neue Funktionsprinzipien hin. Wiederholen wir noch einmal die
- Frage: wenn das Langzeitgedächtnis auf neuen synaptischen Verknüpfungen beruht, worauf basiert die spezifische, Jahrzehnte andauernde Erinnerungsfähigkeit und die Gedächtnisauffrischung?
- Problem: Gewöhnliche Moleküle (Proteine) wären unbeständig.
"Trick": Prionen-Proteine sind – wie von BSE bekannt – dauerhaft beständig. Gedächtnis- Proteine des Typ CPEB (cytoplasmic polyadenylation element binding protein) könnten durch Interaktion mit mRNA (als Gen-Kopien) die neuen Synapsen erinnerungsspezifisch markieren, Prionen-Gestalt annehmen und durch "Ansteckung" von CPEBs sich vermehren ("Gedächtnisauffrischung"). Profitiert das Langzeitgedächtnis von der "ansteckenden Eigenschaft" der CPEB Prionen? Handelt es sich bei den BSE- und CJK-Erregern des ZNS um entartete „Gedächtnis-Prionen“? Interessanterweise findet man BSE- und CJK-Prionen ausschließlich in zentralnervösem Gewebe, also dort, wo gelernt wird.
Vielleicht ist dies weit hergeholt, aber etwas lässt sich nicht leugnen: Prionen-Proteine sind dauerhaft, sie können anderen Proteinen ihre Konfiguration aufdrängen, d.h. sich vermehren und damit der Auslöschung des Gedächtnisses entgegenwirken, es also auffrischen. Hier ein Bild, das zeigt, wie Prionen aussehen: in der gutartigen Form und in der entarteten Form. Dies hier wäre die Normalstruktur in kleinen Abschnitten die helikale gutartige Struktur, dort die entsprechende entartete nicht-helikale infektiöse Struktur, die anderen Proteinen ihre eigene Struktur aufdrängt. – Wie gesagt, „Gedächtnis-Prionen“ sind zur Zeit noch spekulativ, aber in dieser Richtung wird bereits intensiv geforscht.
Bevor wir uns Konditionierungsprozessen bei Säugetieren zuwenden, lassen Sie uns – sozusagen als Einschub – zusammenfassend verschiedene Möglichkeiten der präsynaptischen Neuromodulation betrachten. Im Grunde genommen handelt es sich hierbei stets um das Verknüpfungs-Schema einer axo-axonischen Synapse: der Axonendknoten eines Neurons N1 bildet eine Synapse mit einem nachgeschalteten Neuron N; die synaptische Übertragung wird moduliert durch ein Neuron N2, dessen Axonendknoten eine Synapse mit dem Axonendknoten von N1 bildet (axo-axonische Synapse). Bei dieser präsynaptischen Modulation sind zwei verschiedene Neurotransmitter wirksam: Transmitter-1 vermittelt die Signaltransmission von N1 auf N, während Transmitter-2 diese Signaltransmission moduliert (=Neuromodulator).
Die Neuromodulation kann je nach Neuromodulator-Typ im Endeffekt z.B. den Ca2+ Einstrom in den Axonendknoten von N1 drosseln und damit die Signaltransmission von N1 nach N hemmen. Beispiel: Schmerzausschaltung im Rückenmark. Wird dort als Transmitter-2 das Methionin-Enkephalin ausgeschüttet, kommt es zu einer 2nd messenger-vermittelten Öffnung von K+ Kanälen, so dass die präsynaptisch in N1 eintreffenden Aktionspotentiale AP in ihrer Amplitude reduziert werden, was den Ca2+ Einstrom in N1 abschwächt.
Die Neuromodulation kann aber auch im Endeffekt den Ca2+ Einstrom in den Axonendknoten von N1 steigern und damit die Signaltransmission von N1 nach N fördern. Beispiel: präsynaptische Sensitisierung bei Aplysia. Wird dort als Transmitter-2 das Serotonin ausgeschüttet, kommt es zu einer 2nd messenger-vermittelten Schließung von K+ Kanälen, so dass die depolarisierende Wirkung der präsynaptisch in N1 eintreffenden APs zeitlich gespreizt wird, was den Ca2+ Einstrom in N1 abschwächt.
Wir kommen endlich zum assoziativen Lernen und wollen uns hier mit der sog. klassischen Konditionierung befassen. Grundlegende Zusammenhänge werden Sie noch aus der Schule kennen. Ich darf mich in der Einleitung daher kurz fassen. Was versteht man unter klassischer Konditionierung? Nervensysteme neigen dazu, Ereignisse, die wiederholt zeitlich zusammentreffen, mit Ursache/Wirkungs-Beziehungen zu verknüpfen. Die Kenntnis der Beziehung zwischen einer Ursache (z.B. bissiger Hund) und der zugeordneten Wirkung (Hundebiss) kann wichtig sein. O.K., das kann man verstehen.
Neurobiologische Grundlage hierfür sind sog. Hebbsche Verknüpfungen basierend auf Hebbschen Synapsen. Donald Hebb hat 1949 daraus die Hebbsche Regel entwickelt. Diese Regel besagt: gleichzeitig aktive Neuronenpaare werden durch eine Veränderung ihrer Verbindungen stärker aneinander gebunden, wenn Hebb-Synapsen vorliegen. Schön, aber das sagt uns zunächst nicht sehr viel. Deswegen schauen wir uns die Funktionsweise anhand einer allgemeinen Modellschaltung an und versuchen noch einmal, das Ganze zu verstehen: ein Neuron N3 hat gepaarte Eingänge von zwei Neuronen N1 und N2. Der Eingang von N2 zu N3 sei überschwellig (gut passierbar), der Eingang von N1 zu N3 dagegen unterschwellig (kaum passierbar). Wenn jetzt die Neurone N1, N2 und N3 wiederholt gleichzeitig erregt sind, dann wird der zuvor unterschwellige Eingang von N1 zu N3 überschwellig, d.h. es kommt zu einer Bindung zwischen den Neuronen N1 und N3, die vorher nicht gegeben war. Mit anderen Worten die Übertragung von N1 auf N3 wird gebahnt bzw. potenziert.
Als Verhaltensbeispiel einer klassischen Konditionierung wählen wir die Furchtkonditionierung der Ratte. Ein Schock, z.B. Elektroschock, führt bei der Ratte zur Steigerung ihrer Herzschlagrate. In der Fachsprache: der unkonditionierte Stimulus US führt zu einer unkonditionierten Reaktion UR. Ein neutraler Glockenton löst bei der Ratte überhaupt keine Reaktion aus: er lässt die Ratte herzschlagmäßig kalt, ihre Herzschlagrate bleibt ruhig. Wenn wir jetzt den Glockenton als konditionierten Stimulus CS – bzw. zu konditionierenden Stimulus – und den Elektroschock US zusammen anbieten und die Paarung mehrmals wiederholen (wir sprechen von Kontiguität), dann wird der Glockenton zum konditionierten Stimulus CS, in dem er schließlich – allein geboten – die gesteigerte Herzschlagrate als konditionierte Reaktion CR auslöst.
Wo und wie findet diese Konditionierung statt? Betrachten wir das neuronale Verknüpfungsschema. Das hier dargestellte „Lernmodul“ besteht aus drei Neuronen: N1 (Schafferfaser), N2 (Kommissuralfaser) und N3 (Pyramidenzelle des Hippocampus). Anders ausgedrückt: Pyramidenzellen des Hippocampus – eine für das Lernen wichtige Struktur des Telencephalon – erhält Hörinformation über die Schafferfaser und Schmerzinformation über die Kommissuralfaser. Normalerweise wird die Herzschlagrate durch Aktivierung des sympathischen Nervensystems erhöht. Jenes kann aktiviert werden durch den Elektroschock US. Der Elektroschock kann aber auch über die Kommissuralfasern die Pyramidenzellen erregen, die daraufhin die Herzschlagrate erhöhen. Ohne Einfluss bleibt jedoch der Glockenton, denn als US – allein geboten – erreicht seine Information über die Schafferfaser die Pyramidenzelle kaum.
Wenn aber Ton und Schock gepaart wiederholt geboten werden, dann wird – durch gleichzeitige Aktivierung der Neurone N1, N2 und N3 – die Synapse zwischen Kommissuralfaser N1 und Pyramidenzelle N3 gebahnt (potenziert), so dass schließlich der Ton – allein geboten – als CS zur Erhöhung der Herzschlagrate CR führt.
Welche Signaltransduktionen in den Neuronen N1, N2 und N3 liegen dieser klassischen Konditionierung zugrunde? Wir transponieren die erforderlichen Essentials in das bereits bekannte allgemeine Schema und präzisieren die Frage: aufgrund welcher Signaltransduktionen wird die zunächst schwache unterschwellige Bindung zwischen N1 und N3 gebahnt? Wie ist es möglich, dass gleichzeitige Aktivierung der drei Neurone N1, N2 und N3 eine solche Bahnung zustande kommen lässt? Wir betrachten jetzt in Großaufnahme den Ausschnitt bestehend aus N3, N1-Axonendknoten und N2-Axonendknoten. Hier ist der große Ausschnitt: N1-Schafferfaser(Ton-Info), N3-Pyramidenzelle der hippocampalen CA1-Region, N2-Kommissuralfaser(Schmerz-Info). Die postsynaptischen Membranen der beiden Synapsen – N1/N3 und N2/N3 – der Pyramidenzelle haben verschiedene Ionenkanäle. Betrachten wir zunächst die sog. A/K-Ionenkanäle, die durch den Neurotransmitter Glutamat für Na+ Ionen geöffnet werden. Wenn die Synapse N2/N3 über A/K-Ionenkanäle aktiviert ist, bewirkt der Na+ Einstrom eine überschwellige Membrandepolarisation (und durch Aktivierung von N3 erhöht sich die Herzschlagrate). Das sollte man auch erwarten. Wenn die Synapse N1/N3 über A/K-Ionenkanäle aktiviert ist, bewirkt der Na+ Einstrom eine unterschwellige Membrandepolarisation (die nicht ausreicht, N3 zu aktivieren).
Jetzt kommt der „Pfiff“: wenn die A/K-Kanäle beider Synapsen gleichzeitig aktiviert sind, resultiert durch den Brutto Na+ Einstrom eine relative starke Membrandepolarisation. Diese starke Membranspannung sorgt jetzt dafür, dass ein anderer Typ von Glutamat-Rezeptoren – die NMDA Rezeptoren – aktiv werden. Zunächst sind die zugeordneten Na+ Kanäle durch Mg2+-Ionen verschlossen. Sobald jedoch die Brutto Membrandepolarisation einen kritischen Wert erreicht hat, dann löst sich der Mg2+ Pfropf und extrazelluläre Ca2+ Ionen strömen massiv in das Zellinnere. Die Ca2+Ionen stimulieren die Stickstoffmonoxid-Synthese und können jetzt retrograd über Gliazellen in den Axonendknoten des präsynaptischen N1-Neurons eindringen und über eine Signalkaskade cGMP aktivieren, was – auf einem uns bereits bekannten Wege – einen Prozess auslöst, der letztlich dazu führt, dass der Ca2+Ionen-Einstrom verstärkt und somit die synaptischen Übertragung anhaltend potenziert wird. Wir nennen dieses Phänomen daher auch synaptische Langzeitpotenzierung LTP. Jetzt kann der Glockenton – als CS allein geboten – N3 aktivieren und die Herzschlagrate als CR erhöhen.
Die folgenden Folien vermitteln Ihnen einen Eindruck über den histologischen Aufbau des Hippocampus und eines Pyramidenneurons der CA1 Region bei der Ratte, sowie die Lokalisation des Hippocampus im Gehirn des Menschen.
Ca2+Ionen können bei LTP verschiedene Wirkungen entfalten. Diese fasse ich für Sie in dem folgenden Übersichtsbild zusammen:
1) Durch Aktivierung von CaMKII (Kalzium-Kalmodulinkinase II): Phosphorylierung von A/K-Kanälen führt zur postsynaptischen Membranerregbarkeit und damit zu frühen LTP.
2) Durch Stimulierung der NO-Synthese: Steigerung präsynaptischer Vesikel-Exozytose führt zur Aufrechterhaltung der LTP.
3) Durch Aktivierung der PKA: Phosphorylierung der CREB1-Proteine führt zum Anschalten der CRE-Gene; Proteinprodukte führen durch Hemmung von CAM zu neuen Verknüpfungsmustern und damit zu lang anhaltenden LTP.
Wir wollen jetzt eine andere klassische Konditionierung beleuchten: die Lidschlag-Konditionierung. Wenn man einem Kaninchen einen fokussierten Luftstrom auf die Kornea des Auges bläst, dann wird Lidschlag ausgelöst. Auf einen indifferenten Ton hin erfolgt kein Lidschlag. Trifft jedoch der Luftstrom in Kombination mit dem Ton wiederholt auf die Kornea, dann löst schließlich der Ton allein den Lidschluss aus. Wo und wie findet das ganze statt? Sie erinnern sich an die – vom Design her schöne – Neuronenschaltung aus dem Kleinhirn, die ich Ihnen im Block1 der Vorlesung als Musterbeispiel für Neuroarchitektur vorstellte. Jetzt lernen wir Ihre Funktion kennen.
Sie sehen hier sog. Körnerzellen, deren Axone die Parallelfasern bilden. Jene stehen über erregende Synapsen mit Pyramidenzellen in Kontakt; diese erhalten auch erregende Eingänge von Kletterfasern eines Kerns, der Inferiore Olive IO heißt; die Pyramidenzellen hemmen die Neurone des Nucleus interpositus. Der Interpositus ist ständig gehemmt; fragen Sie mich bitte nicht warum. Offenbar ist diese Hemmung wichtig, denn wir werden gleich die Bedingungen kennen lernen, unter denen diese Hemmung aufgehoben wird.
Lassen Sie uns jetzt anhand einer einfachen Neuronenschaltung den Informationsfluss bei der Lidschlagkonditionierung verfolgen. Zunächst zum Lidschluss-Reflex als unkonditionierte Reaktion: der Luftstrom (US) wirkt auf den Trigeminuskern TK und löst über motorische Kerne des Halsmarks MH per Muskelkontraktion M den Lidschlag aus (UR). Wenn wir jetzt einen Ton applizieren, dann könnte dessen Information nur über den Interpositus den Lidschlag aktivieren; jener allerdings ist gehemmt. Würden die Purkinjezellen schweigen, wäre der Interpositus nicht mehr gehemmt. Also müssen im Verlauf der klassischen Konditionierung – durch Kombination des Luftstroms mit dem Ton – die Purkinjezellen zum Schweigen gebracht werden. Dann nämlich kann der Ton allein als CS ungehindert den Lidschlag über NI, NR, MH auslösen. Die folgende Animation macht dies deutlich: durch wiederholte Kombination von Ton (über Parallelfaser) und Luftstrom (über Kletterfaser) wird die Purkinjezelle gehemmt im Verlaufe einer Langzeitdepression LTP.
Jetzt schauen wir uns an, wie es zu dieser Langzeitdepression kommt. Wir transponieren zunächst die Verhältnisse der Lidschlag-Konditionierung in unser altbekanntes Schema. Aufgabe: durch wiederholte Kombination von
Ton [US] über Parallelfasern (N1)
und
Luftstrom [US] über Kletterfasern (N2)
Möge die Purkinjezelle (N3) gehemmt werden, so dass nach Enthemmung des Interpositus der Ton (allein) [CS] den Lidschluss [CR] auslösen kann.
Lassen Sie uns jetzt darüber nachdenken, wie durch die Stimuluspaarung Prozesse ausgelöst werden, die die synaptische Übertragungen N1/N3 und N2/N3 hemmen und damit N3 zum Schweigen bringen.
In der folgenden Folie ist das Lernmodul bestehend aus N1, N2 und N3 etwas vergrößert dargestellt. Vor der Lidschlagkonditionierung sind die Synapsen N1/N3 und N2/N3 aktiv und aktivierbar. Unter anderem trägt dies dazu bei, dass die Purkinjezelle N3 aktiv ist und den Interpositus hemmt. Infolge der Kombination von Luftstrom und Ton werden in N3 Signaltransduktionen ausgelöst, die die synaptischen Übertragungen N1/N3 und N2/N3 blockieren. Betrachten wir jetzt einen Ausschnitt des Lernmoduls stark vergrößert. Die postsynaptischen Membranen beider Synapsen besitzen die uns inzwischen bekannten Glutamat-aktivierten A/K-Ionenkanäle. Während der kombinierten Stimulation erfolgt durch beide postsynaptischen Membranen Na+ Einstrom; die resultierende Brutto Membran-Depolarisation führt zu starkem Ca2+ Einstrom. Damit nicht genug, die Ca2+ Konzentration im Zytoplasma wird auf einem anderen Signalweg noch weiter erhöht: an der postsynaptischen Membran von N1/N3 befindet sich nämlich noch ein anderer Rezeptor-Typ, den wir bereits kennen; es ist ein G-Protein gekoppelter Rezeptor, der über Phospholipase C, PLC, die Bildung von Inositoltriphosphat IP3 vermittelt. IP3 dockt an die Membran des endoplasmatischen Retikulum ER, Ca2+ Kanäle öffnen sich, und Ca2+ Ionen strömen aus. Gleichzeitig wird durch PLC über Diacylglycerin DAG die membranständige Proteinkinase C, PKC, stimuliert, die sodann in das Zytoplasma dringt.
Sobald der Ca2+ Spiegel einen kritischen Wert erreicht hat, werden die A/K-Kanäle durch die stark aktivierte PKC phosphoryliert und geschlossen. Damit sind die synaptischen Übertragungen von N1/N3 und N2/N3 langfristig unterbunden; man nennt das synaptische Langzeitdepression LTD. Damit wird der Interpositus nicht mehr gehemmt, und die Voraussetzung ist geschaffen, dass der Ton über den Interpositus Lidschlag auslösen kann.
Abschließend fassen wir die mannigfachen Wirkungen von cAMP/PKA, IP3/Ca2+ und NO jeweils in drei Übersichten zusammen.
Das war’s für Block5, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
_________________________________________________________
Block6: Neurochemie der Emotionen (I)
Belohnungs -und Bestrafungssysteme; Limbisches System; Nucleus accumbens, N. amygdalae; Dopamin; Cocain, Amphetamin, Ecstasy; Canabis; Nicotin, Coffein
_________________________________________________________
vgl. Abbildungen Block 6
Fragen zu Block 6:
• Glück - was ist das? Welche chemischen Systeme des Gehirns steuern Emotionen?
• Was versteht man unter Stimmung?
• Wie wurden die Belohnungs -und Bestrafungssysteme entdeckt?
• Wo im Gehirn sind Belohnungs -und Bestrafungssysteme lokalisiert?
• Wo liegen wichtige Nervenzellen, die Dopamin, Noradrenalin oder Serotonin produzieren?
• Wodurch lassen sich neurochemische Gleichgewichte beeinflussen, und wie lassen sich Stimmungen "chemisch stimulieren"?
• Historischer Abriss: Wie wurde mit Kokain früher umgegangen?
• Wie wirkt Kokain auf das Belohnungssystem?
• Eine Modellvorstellung vom Tor zum Glück: mehr "Schlüssel" (mehr "Schlösser") mehr "Glück"?
• Wie entsteht Sucht, und welches sind die drei Hauptstadien der Drogensucht?
• Auf welchen biochemischen Veränderungen basiert Drogensucht? Gibt es ein Sucht-Gedächtnis?
• Was sind "Designer-Drogen"?
• Welche Wirkungen zeigen Amphetamin und Ecstasy?
• Warum ist Rauchen eine Sucht, und was hat Nikotin mit Dopamin zu tun?
• Wie greift Koffein vielfältig in verschiedene Stoffwechselvorgänge ein?
• Welche pharmakologischen Wirkungen hat ein "Joint"?
.
Meine Damen und Herren,
in den letzten beiden Blöcken standen Synapsen im Vordergrund. Zugegeben, hierbei handelte es sich stellenweise um einen komplexen, relativ trockenen Stoff. Nun, das war sozusagen die Pflicht; jetzt kommt die Kür. Sie dürfen sich in den nächsten beiden Vorlesungsblöcken gewissermaßen ein wenig zurücklehnen und genießen, denn der kommende Stoff stammt aus dem alltäglichen Leben. Es geht um Emotionen. Dazu gleich ein einleitender Video-Clip über die verschiedenen Momente des Glücks. Glück, was ist das? Lassen Sie uns die neurobiologischen Grundlagen beleuchten, die Glück, Angst, Depressionen, – aber auch den verschiedenen Formen der Sucht zugrunde liegen, denn Glück und Sucht/Abhängigkeit sind leider manchmal nicht voneinander zu trennen.
Zunächst kurz zum Menü des heutigen Block6. Wir werden uns mit Belohnungs- und Bestrafungssystemen beschäftigen; das sind keine Sozialsysteme, sondern neuronale, sog. limbische Systeme des Gehirns, die es uns erlauben, Glück und Angst zu empfinden. Für Glück ist der Nucleus accumbens und für Angst z.B. der Nucleus amydalae zuständig. Ein wichtiger Glück- vermittelnder Neurotransmitter ist das Dopamin. Menschen, denen die natürliche Dopamin-Produktion nicht ausreicht, greifen zu Drogen – wie z.B. Cocain oder Amphetamin – die die Dopaminfreisetzung heftig ankurbeln und diese Menschen dann in Zustände des Schein-Glücks versetzten. Die Wirkungen von Nicotin, Coffein und Canabis werden wir ebenfalls kennen lernen. Diese Folie zeigt uns den Fahrplan für die kommenden beiden Blöcke.
Jeder normale Mensch hat positive und negative Phasen, d.h. manchmal gute und manchmal schlechte Laune, und man kann sagen, dass unser launisches Stimmungssystem einem mehr oder weniger periodischen Verlauf folgt. Es gibt Zeiten des „Hochs“, in denen wir – wir wissen häufig nicht einmal warum – einfach gut drauf sind: wir fühlen uns sogar durch Nebensächlichkeiten positiv verstärkt und neigen zu positiven Bewertungen. Kurz: wir steigen morgens mit dem „richtigen Bein“ auf. Dann folgt die Zeit eines „Tiefs“, in der wir – eigentlich ohne erkennbaren Grund – übel drauf sind: sogar Erfolge lassen uns kalt, wir fühlen uns eher negativ verstärkt und neigen zu negativen Bewertungen. Kurz: wir sind morgens mit dem „falschen Bein“ aufgestanden. Solche Phasen wechseln sich ab; das ist völlig normal, denn es gibt – offenbar wie beim Wetter – kein Dauerhoch und auch kein Dauertief. Eigentlich freue ich mich immer, wenn ich mich in einem Tief befinde, – sozusagen in Erwartung auf das nächste Hoch. Das angenehme Gefühl in der Erwartung auf Freude hat, wie wir gleich sehen werden, eine neurobiologische Grundlage.
Wo liegen die Hirnstrukturen, denen wir Glücksempfindungen verdanken? Wir beginnen mit der Erforschung der Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Im Jahre 1945 wollte der amerikanische Hirnforscher James Olds eigentlich etwas ganz anderes erforschen: er wollte an Ratten herausbekommen, welche Hirnstrukturen für das Lernen verantwortlich sind. Dazu wählte er folgende Versuchsanordnung. Die Ratte saß in einem Käfig auf einer geerdeten Metallplatte. In ihr Gehirn war eine hauchdünne Elektrode implantiert. Metallplatte und Elektrode waren über eine Gleichstromquelle und einen Impulsgenerator miteinander verbunden. Die Ratte selbst konnte nun durch Betätigung eines Hebels den Stromkreis schließen oder öffnen, und damit einen Ort ihres Gehirns stimulieren, d.h. erregen. Im Fachjargon spricht man von „intracranieller Selbststimulation“.
Das Ganze hinterlässt bei Ihnen sicherlich einen unangenehmen Eindruck. Die Ratte empfindet hierbei jedoch keinerlei Schmerzen. Ich erwähnte bereits früher, dass das Gehirn selbst schmerzunempfindlich ist. Schmerzempfindlich ist die harte Hirnhaut, die sog. Dura mater. Deshalb muss nach Öffnung eines Schädellochs – unter Anästhesie – die betäubte Hirnhaut zur Seite geschoben werden. Übrigens auch in der Human-Neurochirurgie werden operative Hirneingriffe stets am wachen Patienten durchgeführt, damit der Neurochirurg bei Stimulation des Hirngewebes anhand des Verhaltens des Patienten wichtige funktionelle Hinweise über die zu behandelnden Hirnbereiche gewinnt.
Zurück zu James Olds. Er stellte fest, dass die Ratte bei bestimmten Elektrodenpositionen den Schalter des Stromkreises offenbar gern schloss, ja bei Stimulation eines bestimmten Hirnbereichs den Hebel geradezu bis zur Erschöpfung betätigte. Olds schloss daraus, dass die Erregung solcher Hirnbereiche von der Ratte wohl als angenehm – gewissermaßen als Belohnung – empfunden wurden. Allerdings gab es auch bestimmte Elektrodenpositionen, deren Stimulation die Ratte konsequent mied. Sie betätigte den Hebel einmal, aber nie wieder. Offenbar war das für sie so fürchterlich, dass das als Bestrafung empfunden wurde. Wiederum andere Elektrodenpositionen lösten weder Suche noch Ablehnung des Hebels aus.
Damit hatte Olds zwar keine Lernzentren des Gehirns entdeckt; er hatte aber zufällig zwei Hirnsysteme entdeckt, die – gerade auch – beim Lernen eine wichtige Rolle spielen, nämlich Systeme für positive Verstärkung (Belohnung) und negative Verstärkung (Bestrafung).
Die nächste Folie zeigt uns anhand eines schematischen Längsschnitts durch das Säugerhirn, wo die Belohnungs-und Bestrafungssysteme liegen. Das Belohnungssystem folgt dem sog. Limbischen System; ein wichtiger Kern ist der Nucleus accumbens. Zum Bestrafungssystem gehören Anteile des Nucleus amygdalae sowie diencephale und mesencephale Strukturen des Zentralen Höhlengrau. Alle Säugetiere besitzen solche Belohnungs- und Bestrafungssysteme, auch wir Menschen. Nach Zustimmung von Patienten hat man vor Hirnoperationen auch Selbststimulationsuntersuchungen durchführen lassen mit Resultaten, die denen der Rattenversuche vergleichbar waren. Bei Erregung von Positionen im Belohnungssystem berichteten die Patienten über Glücksgefühle, die Erregung von Positionen im Bestrafungssystem empfanden sie dagegen als beängstigend.
Jetzt stellte sich natürlich die Frage nach den zugeordneten Neurotransmittern. Dazu brauchte in der Versuchsanordnung die Reizelektrode nur gegen eine mit Neurotransmitter gefüllte Mikropipette ersetzt zu werden, die per Stromstoß Neurotransmitter iontophoretisch applizierte. Es stellte sich heraus, dass mit Dopamin gefüllte Mikrokapillaren in bestimmten Hirnorten von den Ratten als angenehm empfunden wurden, und diese Orte waren deckungsgleich mit dem Belohnungssystem. Entsprechendes fand man beim Menschen. Demnach ist Dopamin ein wichtiger Überträgerstoff für die Glücksempfindung. Das betrifft vor allem den Nucleus accumbens, der im Jargon auch „Glückszentrum“ genannt wird. Nun, für positive Stimmung sorgt nicht allein Dopamin, sondern auch andere Monoamine wie Serotonin und Noradrenalin; jedes wirkt in diesem Zusammenhang etwas anders. Eine gewisse Ausgewogenheit dieser Neurotransmitter – ein neurochemisches Gleichgewicht – sichert unsere Stimmungslage. Schwankt das Gleichgewicht, ändert sich unsere Stimmungslage entsprechend.
Jetzt werden Sie sicherlich fragen, wo jene Nervenzellen im Gehirn liegen, die für den erforderlichen Neurotransmitter-Nachschub sorgen. Hier ist wieder das bekannte Hirnschema in Seitenansicht. Die Somata von dopaminergen Neuronen, die das limbische Belohnungssystem mit Dopamin versorgen, befinden sich in der Ventralhaube des Mittelhirns, also des Mesencephalon; diese dopaminergen Neurone gehören zum „mesolombischen System“. Hier habe ich ein Neuron herausgezeichnet mit seinen ausstrahlenden Axonkollateralen. Das Glückszentrum Nucleus acumbens erhält also sein Dopamin von Neuronen der Ventralhaube. Am Rande sei erwähnt, dass es im Mittelhirn noch einen anderen Ort gibt, dessen Nervenzellen Dopamin produzieren: es ist der Schwarze Kern, Nucleus niger; dieser innerviert das telencephale Corpus striatum als Bestandteil des für die Motorkoordination verantwortlichen motorischen Systems. Kommen wir zu den anderen Neurotransmittern: Noradrenalin wird im sog. Blauen Kern, Nucleus coeruleus, und Serotonin im medullären Raphekern produziert. Wichtig ist, dass jedes einzelne Neuron über seine Axonkollateralen in weite Bereiche des Gehirns einstrahlt; d.h., wenn das Neuron aktiv ist, schüttet es seinen Neurotransmitter fast gleichzeitig in verschiedenen Hirnteilen zur Signalübertragung aus, sodass sich Gesamtzustände einstellen oder verändern lassen. Das gilt für alle drei hier betrachteten Neurotransmitter, und Sie sehen jetzt, was ich vorhin unter neurochemischen Gleichgewichten verstehen wollte.
Wird in dieses Gleichgewicht von außen eingegriffen, kann es außer Kontrolle geraten, – und damit kommen wir zum Problem der Störung neurochemischer Gleichgewichte durch Drogen. Wir sehen hier noch einmal unser bekanntes „launisches Stimmungs-System“. Belohnungssysteme sind sehr wichtig, denn gute Taten werden in der Regel belohnt – schlechte Taten in der Regel nicht – und deshalb werden gute Taten wiederholt; aber bitte in maßvoller Dosierung: jeden Tag eine gute Tat ist schon O.K. Nur am Rande möchte ich vermerken, dass hierin bereits ein Suchtpotenzial liegt; denken wir z.B. an das sog. „Helfer-Syndrom“. Ein vom Helfer-Syndrom Betroffener hat im Über-Ich das Ideal verinnerlicht, dass man nur dann gut sei, wenn man anderen Menschen hilft.
Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar Gedanken zu Glück bzw. Belohnung einschieben.
Ein interessanter Aspekt am Belohnungssystem ist jener, dass nicht nur die „Freude über etwas“, sondern vor allem auch die „Vorfreude auf etwas“ mit Dopaminstößen verbunden ist. Manche Menschen gehen shoppen ohne sich die Objekte der Begierde gekauft zu haben und sind dann zweifach glücklich: die Vorfreude auf das Zukaufende und die Freude darüber, dafür kein Geld ausgegeben zu haben. Wichtig ist: wir können uns freuen, ohne das Objekt der Begierde zu besitzen. Das gilt für Säuger generell. Bei einem Mäusemännchen fand man heraus, dass dessen Dopaminspiegel allein beim Anblick des Mäuseweibchens steil anstieg, etwa ebenso steil wie während der späteren Kopulation mit dem Weibchen.
Nun gibt es auch Menschen, die sich einen „Belohnungs-Kick“ verschaffen wollen, – und zwar ohne eine gute Tat. Diese belohnen sich auf chemische Art, indem sie zur Pille greifen und z.B. durch Einnahme von Cocain die Wirkung von Dopamin im Belohnungssystem puschen. Unter dem Einfluss von Cocain entsteht Euphorie, d.h. man bewertet neutrale Situationen emotional überspitzt positiv. Zudem fördert Cocain die Wachsamkeit, die Ausdauer, die Reaktionsbereitschaft, und es senkt den Appetit. Nun könnte man sagen, das sind ja im Grunde genommen keine besonders verwerflichen Wirkungen. Gerade in Ausnahmesituationen wären sie hilfreich, und die Mannequins bleiben schön dünn. Die gravierende Schattenseite besteht in der Gewöhnung an den Drogeneffekt – man nennt dies Resistenz – und die damit verbundene Dosissteigerung sowie die Sucht nach der Droge. Unter starkem Einfluss von Cocain entstehen Halluzinationen, Größenwahn und Identitätsverlust. Übrigens, Cocain stammt aus den Blättern des Coca-Strauchs Erythroxylum coca; diese Pflanze produziert Cocain als natürliches Insektizid.
Wie wurde aber im Laufe der Jahrhunderte mit Cokain umgegangen? Nicht immer wurde Cocain kritisch betrachtet. Die alten Inka verehrten geradezu das Cocain und betrachteten es als ein Geschenk des Sonnengottes, und zwar nicht nur für höhergestellte Menschen, sondern auch vor allem für die Arbeiter, und das hatte einen bestimmten Grund. Wir bestaunen bewundernd die Bauten aus der Inka-Kutur, z.B. die Ruinenstadt Machu Picchu in den Anden: ein 18 km2 großes Terrassenwerk aus 3000 Stufen, bis zu 50 t pro Baustein, und das ganze errichtet in einer Höhe von 2500 m über dem Meeresspiegel. Das erforderte geradezu unmenschliche die Kräfte. Förderlich, keineswegs jedoch hinderlich, war bei dieser Arbeit das Kauen von Coca-Blättern. Die Bauarbeiter waren auf diese Art und Weise hoch motiviert, sie waren glücklich und ausdauernd, und sie hatten kein Hungergefühl, so dass die Nahrungsversorgung auch kein Problem darstellte. Die Lebenserwartung bei solcher Arbeitsweise unter Cocain-Genuss war natürlich nicht sehr groß, so dass Spätfolgen der Drogensucht wohl kaum zum Tragen kamen.
Im Abendland wurde Cocain im Jahre 1860 zum ersten Mal von Albert Niemann aus Cocablättern isoliert und dann bei der Firma Merck synthetisch hergestellt. Cocain verwendete man zunächst als Lokalanästhetikum; es blockiert Na+ Kanäle der Schmerz-Sinnesfasern und wurde z.B. bei Bindehautentzündungen in Augentropfen verwendet. Subkutan appliziert hat es keine berauschende Wirkung. Nach oraler Einnahme oder nach Aufnahme über die Schleimhäute wirkt es im Gehirn – wie bereits erwähnt – als Psychostimulans. Konsumenten von Cocain waren verschiedene berühmte Persönlichkeiten, unter ihnen der Psychologe Sigmund Freud, der einen großen Teil seiner Abhandlungen unter dem Einfluss von Cocain geschrieben haben soll.
Schließlich fing man an, mit Cocain-Mixgetränken zu experimentieren. 1863 rührte der Italiener Angelo Mariani Cocain in den Wein. Sie werden es nicht glauben: das Getränk wurde ein Renner. Mariani erhielt hierfür sogar von Papst Leo XIII eine Auszeichnung. Liebhaber dieses Getränks waren u.a. Jules Verne, Hendrik Ibsen und Thomas Edison.
Wehmütig auf die alte Welt blickte die neue Welt, denn in Nordamerika war während der Alkoholprohibition der Konsum von Alkohol per Gesetz verboten. Also begann man, zu experimentieren. So kam der Apotheker George Pemperton auf die Idee, Cocain – um Gottes Willen nicht mit Alkohol, sondern – mit dem Colanin der Cola-Frucht zu mischen. Colanin stammt aus der Coffein-haltigen Nuss des Cola-Baums Cola nitida. Colanin hat verglichen mit dem Coffein der Kaffeebohne einen etwas anderen Wirkungsgrad; gerade in Verbindung mit Kohlensäure regt Colanin an, hat jedoch nicht die Nebeneffekte des Coffeins auf das vegetative Nervensystem wie Herzklopfen usw. Die Geburtsstunde von Coca Cola hatte geschlagen: 1892 gründete Asa Candler die Coca-Cola Company. Erst im Jahre 1903 wurde Cocain aus der Rezeptur gestrichen; der Name Coca-Cola und die erfrischend anregende Wirkung des Colanins blieben erhalten. Der Siegeszug des Getränks Coca-Cola war nicht mehr aufzuhalten. Hier sehen wir zwei Coca-Cola Reklamen, eine aus der Zeit und eine moderne mit Altkanzler Helmut Kohl wie er gerade eine neue Abfüllanlage einweiht.
Kommen wir zur Frage, wie Cocain auf das Belohnungssystem wirkt. Hier ist eine dopaminerge Synapse. Mit solchen schematischen Darstellungen werden wir uns jetzt häufiger beschäftigen. Die 2nd messenger vermittelte Signalkette ist stark verkürzt: Axonendknoten, Vesikel mit Dopamin, nach Exozytose dockt Dopamin an einen G-Protein gekoppelten Rezeptor der postsynaptischen Membran eines Neurons des Nucleus accumbens an, was letztlich über Aktivierung von PKA zur Öffnung von Na+ Kanälen und damit zur Signalübertragung führt, und das bedeutet: Glück. Unter dem Einfluss von Cocain geschieht folgendes: Cocain hat eine bestimmte chemische Struktur mit entsprechenden Valenzen, die dafür geeignet sind, sich an der präsynaptischen Membran fest zu hängen. Dadurch wird der Rücktransport von Dopamin mittels eines membranständigen Transporters durch die präsynaptische Membran gehindert und Dopamin kann erneut an Rezeptoren der postsynaptischen Membran andocken, wodurch die dopaminerge Wirkung potenziert wird.
Wir wollen jetzt die Drogensucht am Beispiel des Cocains erörtern. In der folgenden Folie sind verschiedene Stadien der Drogensucht dargestellt. Eine „Drogenkarriere“ beginnt mit der Phase der Toleranz, in der sich die Wirkung der Droge und die Gegenwirkung des Körpers etwa die Waage halten: es entsteht der Eindruck, als könne man mit der Droge „gut umgehen“. Auf die Phase der Toleranz folgt jedoch die Phase der Resistenz, d.h. die Gewöhnung an die Droge. Die Drogenwirkung lässt nach; folglich muss die Dosis erhöht werden, und dementsprechend stärker sind die Gegenwirkungen des Körpers. Damit besteht unter Umständen ein Drogenbeschaffungsproblem. Ist die Droge nicht erhältlich, dann tritt die Phase des Entzugs ein, in der die gegenregulatorischen Wirkungen des Körpers überwiegen, verbunden mit heftigen und qualvollen Entzugserscheinungen.
Diese Vorlesung ist ja sowohl für Diplom- als auch für Lehramtsstudierende ausgelegt. Folglich haben wir darüber nachgedacht, wie man Schülern das Phänomen der Drogen-Resistenz an einem Modell anschaulich vor Augen führen kann. In diesem Schlüssel-Schloss-Modell geht es um die Öffnung des „Tors zum Glück“. In der nun folgenden Animation steht der Schlüssel für Dopamin und das Schloss für den Dopaminrezeptor, d.h. die Andockstelle. Diesen Schlüssel muss man sich erst verdienen, um als Belohnung das Tor öffnen zu können. Sobald der Schlüssel dann im Schloss steckt, wird das Tor für einen kurzen Augenblick geöffnet, und der schöne Anblick dieses Paradiesvogels möge symbolisch Glück bedeuten. Sodann schließt sich das Tor und erhöht die Anzahl der Schlösser (dies möge der Gegenreaktion des Körpers entsprechen). Manche Menschen wollen das Glück anhalten und greifen zu Cocain, das den Dopaminspiegel erhöht und damit mehr passende Schlüssel bereitstellt. Hier sehen wir wieder das Tor mit mehreren Schlössern; die Schlüssel öffnen das Tor zum Glück, noch mehr Glück. Das Tor schließt sich wieder und hat noch mehr Schlösser gebildet. Der Drogensüchte, der das Glück wiederholen möchte, erhöht durch Cocain den Dopaminspiegel und damit die Anzahl der Schlüssel, er sagt sich: je mehr Schlüssel desto mehr Glück. Nun, die Hoffnung, dass durch mehrere Schlüssel das Glück erhöht wird, erfüllt sich nicht. Schließlich besteht das Tor nur noch aus Schlössern, so dass Gefahr besteht, dass das Tor perforiert wird. Durch weiteres Cocain erhöht sich der Dopaminspiegel und damit die Anzahl der Schlüssel; allein das Tor hält dem nicht mehr stand: es zerfällt, und, was zum Vorschein kommt, ist Unglück.
Wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, auf welchen biochemischen Veränderungen Drogensucht beruht: gibt es ein „Drogengedächtnis“? In Block5 haben wir bereits einiges über die Grundlagen der Gedächtnisfunktionen gehört. Als Beispiel wählen wir das Belohnungssystem. Zwischen den dopaminergen Neuronen der Ventralhaube und Neuronen des Nucleus accumbens („Glückszentrum“) besteht eine negative Rückkopplung, in die ein Gen-gesteuertes Gedächtnis des Accumbens integriert ist. Dopaminausschüttung aktiviert den Accumbens, der seinerseits über ein inhibitorische Interneuron die dopaminergen Neurone hemmt. Das wäre der Normalfall: man empfindet Glück (Dopaminstoß); die negative Rückkoppelung sorgt dafür, dass das Glück wieder aufhört, also nicht zum Dauerzustand wird.
Die Signalkette hierfür beginnt also im Neuron des ventralen Tegmentum (mesencephale Ventralhaube). Dieses Neuron bildet eine dopaminerge Synapse mit einem Neuron des Nucleus accumbens. Unter dem Einfluss von Dopamin wird im Accumbens-Neuroron via bekannte Signalkaskade über ein CREB-Protein ein bestimmtes CRE-Gen abgelesen; Endprodukt ist das Protein Dynorphin. Das Dynorphin wirkt via Axon des Accumbens-Neuron zum dopaminergen Neuron zurück, und zwar über ein inhibitorisches Interneuron, das das dopaminerge Neuron und damit die Dopaminausschüttung zum Accumbens normalerweise unterdrückt.
Der Cocain-Abhängige toleriert das nicht. Er wird also die Cocain-Zufuhr erhöhen, um damit die Dopaminwirkung zu verstärken. Das wiederum führt – via negative Rückkopplung – zu einer weiteren Abschwächung der Dopaminbildung. Dies wiederum führt zu weiterem „Hunger“(craving) nach Cocain. Diese Phase der Drogensucht entspricht der bereits erwähnten „Resistenz“ (Gewöhnung); sie gleicht einem Drogen-Kurzzeitgedächtnis mit den durch Steigerung des Drogenkonsums verbundenen Folgen.
Der Cocain-Abhängige kann dem Craving etwas entgegenwirken, indem er raucht, denn unter dem Einfluss von Nicotin – das werden wir nachher sehen – werden diese dopaminergen Neurone aktiviert und zur weiteren Dopaminausschüttung angeregt. Es besteht aber auch die Versuchung, dass der Süchtige zu Opiaten greift, denn Opiate hemmen das inhibitorische Interneuron und unterbrechen damit die soeben besprochene negative Rückkopplung vom Accumbens. Wir sehen hier also ein höchst komplexes Zusammenwirken, das einige Verhaltensweisen von Drogensüchtigen erklärt.
Jetzt zum Sucht-Langzeitgedächtnis. Während das Sucht-Kurzzeitgedächtnis etwas mit der Resistenz zu tun hat, beruht das Sucht-Langzeitgedächtnis auf zunehmender Sensitivität des Accumbens für Dopamin. Unter dem Einfluss der weiteren Aufnahme von Cocain werden nämlich dFosB Proteine als Transkriptionsfaktoren aktiviert, die die CRE-Gene ausschalten und Fos-Gene anschalten: Proteinprodukt ist u.a. CDK5. Damit entfällt schon mal die hemmende Rückkopplung. Bei CDK5 handelt es sich um eine cyclin dependent kinase, die dafür sorgt, dass mehr dendritische Strukturen mit Dopamin-Rezeptoren gebildet werden, so dass auf diese Art und Weise der Accumbens noch sensitiver für Dopamin wird. Auf der Zunahme dieser strukturellen Veränderung beruht das Sucht-Langzeitgedächtnis. Neue Therapieansätze diskutieren Möglichkeiten, diese Suchtgedächtnisse zu „löschen“ bzw. ihre Funktion zu beeinträchtigen; fraglich ist jedoch, um welchen Preis von Nebenwirkungen.
Betrachten wir abschließend zu diesem Themenkomplex einige chemische Grundlagen. Je schneller Cocain ans Ziel kommt (z.B. per Infusion), desto schneller ist der Effekt, d.h. das Rauscherlebnis (flash), und desto früher setzt das Verlangen (craving) nach mehr Cocain ein. Beachten Sie bitte die Zeitachse in Minuten. Noch bevor der Flash seinen Spitzenwert erreicht hat, setzen schon die Suchterscheinungen in Form des Craving – dem Verlangen nach mehr – ein. Noch bevor der Flash ganz ausgeklungen ist, erreicht das Craving sein Maximum. Dies erklärt, warum der Süchtige so schnell wieder zur Droge greift. Wir halten also an dieser Stelle fest: je schneller die Drogenwirkung einsetzt, desto schneller setzen die Entzugserscheinungen ein.
Betrachten wir jetzt die Aktivität der Transkriptionsfaktoren CREB und delta-FosB. Bitte beachten Sie wieder die Zeitachse, hier in Tagen. Unter dem Einfluss von Cocain steigt die Aktivität beider Transkriptionsfaktoren unterschiedlich stark an: von CREB stark und von delta-FosB schwächer. Nach dem Absetzen von Cocain fällt die Aktivität von CREB, während die von delta-FosB weiter steigt. Die durch delta-FosB bewirkten strukturellen Veränderungen bleiben auch nach dem Absetzen von Cocain lange Zeit erhalten.
Zu den synthetischen Drogen, die die Dopaminwirkung erhöhen, gehört seit 1887 das Amphetamin [Alpha-Methylphenethylamin] und dessen Abkömmlinge. Ab 1941 steht es unter dem Betäubungsmittelgesetz =“Opiumgesetz“. Die chemischen Strukturformeln von Cocain und Amphetamin haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede; das soll uns hier nicht näher interessieren. In früheren Zeiten – als diese Stoffe noch nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterlagen – fanden sie unterschiedliche Verwendung, z.B. zur Leistungssteigerung. Ähnlich wie Cocain erhöht es die Wachsamkeit, senkt den Appetit, nimmt die Müdigkeit, fördert die Reaktionsbereitschaft, aber es macht ebenso süchtig und endet mit zunehmender Dosierung in Größenwahn, Realitätsverlust und Zerbrechen der Persönlichkeit. Als Appetitzügler war das Amphetaminderivat Fenfluramin von 1960 bis 1997 im Handel. Im 2. Weltkrieg wurde Amphetamin in Armeen eingesetzt, um die Soldaten wach, motiviert und aggressiv zu halten.
In Anbetracht dessen, dass das Amphetaminderivat Methylamphetamin “Meth“ unter verschiedenen Bezeichnungen (Crank, Ice, Crystal, Glass, Ups, Mollies, Go fast, etc) bei Jugendlichen wieder an Bedeutung gewinnt, gibt es in den Vereinigten Staaten eine Kampagne, die Schülern zeigt, wie sich Menschen äußerlich (und innerlich) unter dem Einfluss von Meth verändern. Ich habe für Sie einige Beispiele – mit Erlaubnis – aus dem Internet herunter geladen. Wir sehen hier zunächst jemanden, der ein bisschen düster dreinblickt, aber fünf Jahre später völlig kaputt aussieht. Diese Dame hier sieht hübsch aus, nach drei Jahren war sie grotten hässlich: „Faces made by Meth“. Sollten Sie also einmal im Urlaub in einer harmlosen Bar sitzen und ein freundlich erscheinender Mensch sie fragen, ob Sie nicht Lust auf Ice, Glass oder Mollies haben, seien Sie bitte vorsichtig bei diesen verharmlosenden Bezeichnungen, die alle synonym für Methamphetamin stehen (können).
Wir kommen jetzt zu den so genannten Designerdrogen. Um es noch einmal hervorzuheben, Cocain und Amphetamin haben eine unterschiedliche Wirkungsweise, wie wir gleich noch sehen werden, aber im Enddefekt haben sie eine vergleichbare Wirkung. Designerdrogen haben eine Ursubstanz, nämlich das Amphetamin. Je nach dem, welche funktionellen Gruppen in dieses Ausgangsmolekül eingefügt wurden, oder, ob es sich um die links oder rechtsdrehende Form handelt, hat es unterschiedliche Wirkung: weitere Beispiele für Derivate sind Dexedrin, Pervitin, Ritalin oder Ecstasy.
Die Bezeichnung Designer-Drogen wird unterschiedlich verstanden. Eine geläufige Interpretation: vom Amphetamin abgeleitete Drogen, die abhängig von ihrem Design (chemische Struktur) ein unterschiedliches Wirkungsspektrum haben, indem sie die Monoamine Dopamin:Serotonin:Noradrenalin in unterschiedlichem Verhältnis ausschütten. Amphetamin z.B. kann in zwei Schritten agieren:
a) Eindringen in die membranständigen Vesikel und Entlassung des Neurotransmitters in das Zytoplasma des Axonendknotens bzw. in den synaptischen Spalt.
b) Bindung des Neurotransmitters an den membranständigen Transporter und Transport in den synaptischen Spalt mittels Richtungsumkehrung des Transporters (der ja normalerweise den Neurotransmitter bei der Endozytose in den Axonendknoten aufnimmt).
Demgegenüber hindert Ecstasy durch Anheften an die präsynaptische Membran serotonerger Synapsen den Serotonin-Rücktransporter, so dass die Serotoninwirkung an der postsynaptiaschen Membran verstärkt wird. Die psychische Wirkung von Ecstasy-Tabletten äußert sich nicht nur darin, dass man gut drauf ist, sondern auch in einem Zusammengehörigkeitsgefühl; daher der Name Liebespille. Noch bis zum Jahre 1941 haben Psychiater Ecstasy zerstrittenen Ehepaaren verschrieben.
Dies leitet zu einem Problemkreis über, der auch heute kontrovers diskutiert wird, nämlich der Einsatz von Drogen als Arzneimittel bei ganz bestimmten Indikationen, natürlich unter Aufsicht des Arztes. Hierbei handelt es sich z.B. um die Amphetamin-Abkömmlinge: Ritalin und Dexedrin. Ritalin kann zur Behandlung von hyperaktiven Kindern verwendet werden. Dexedrin kann bei Narkolepsie (anfallartiges Einschlafen), Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität verordnet werden (ADD=attention deficit disorder and hyperactivity).
Die Problematik werden wir gleich in einem Video-Clip sehen. Ich habe für Sie aus einem Drogen-Forum des Internet den Bericht einer Patientin heraus kopiert, der Dexedrin ärztlich verordnet wurde, weil sie an dem ADD-Syndrom leidet. Nach diesem Bericht muss man sich fragen, ob hier nicht der Teufel durch Belzebub vertrieben wird.
Wenden wir uns jetzt den erlaubten Substanzen zu, die anregende Wirkung haben, und beginnen mit dem Nicotin. Ist Nicotin eine Droge? Aus neurobiologischer und neuropharmazeutischer Sicht heißt die Antwort eindeutig „ja“: bei manchen Menschen genügt bereits ein Zug an der Zigarette, der sie lebenslang Nicotin-abhängig macht, bei anderen erfordert dies etwas längere „Erfahrung“; fast alle jedoch können nicht mehr aufhören, zu rauchen bzw. hören immer wieder auf; wenige schaffen es dauerhaft.
Ich möchte hier keine Raucher diskriminieren oder ihnen ins Gewissen reden, denn jahrelang war ich Kettenraucher und habe, vor allem in Zeiten intensiver Arbeit, gut und gern 60 Zigaretten pro Tag geraucht. Aus gesundheitlichen Gründen hörte ich von einem Tag zum anderen auf; seit etwa 45 Jahren bin ich Nichtraucher. Ich weiß also, was es bedeutet zu rauchen, wie schön es ist zu rauchen, ich weiß aber auch, wie schwierig es ist, mit dem Rauchen aufzuhören, denn bevor ich diesen Schuss vor den Bug bekommen habe, hatte ich ja „immer wieder aufgehört“.
Das Teuflische am Nicotin ist folgendes:
(1) Nicotin aktiviert das Belohnungssystem und macht süchtig nach Nicotin.
(2) Taback enthält Stoffe, die karzinogen sind.
(3) Dem Taback werden (aus verschiedenen Gründen) Stoffe zugesetzt, die die Sucht des Nicotin potenzieren.
Am 15. Mai 2005 fordert das Bundesverbraucherministerium ein Verbot Krebs erregender und Sucht potenzierender Zusatzstoffe.
Wenn man Nikotin inhaliert, wird es umgewandelt in S-Nicotin, und jenes bindet an Rezeptoren von Neuronen der Ventralhaube, die im Accumbens Dopamin freisetzen. Das Belohnungssystem wird aktiviert. Das Sucht bedingte Craving führt wieder zum Griff nach der Zigarette. Damit nicht genug, S-Nicotin hat noch zwei weitere Effekte, die als angenehm empfunden werden: durch Bindung an Neurone, die Noradrenalin freisetzen, wird der Antrieb gefördert; infolge Bindung an cholinerge nicotinische Acetylcholin-Rezeptoren wird die Wachheit und die Merkfähigkeit gefördert.
Kommen wir zu den Zusätzen; ich wähle nur zwei Zusätze aus von insgesamt ca. 30 000 Zusätzen lt. EU-Kommission:
1) Ammonium-Ionen aus Harnstoff beschleunigen die Nicotinwirkung
2) Zucker verbrennt u.a. zu Acetaldehyd, das seinerseits die Monoaminoxidase MAO-B hemmt (die Monoamine abbaut), wodurch zusätzlich der Spiegel an Monoaminen (Dopamin, Serotonin und Noradrenalin) erhöht wird.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Kombination von Rauchen und Alkohol. Als ich in meiner Studentenzeit in der Kneipe saß, machte das Rauchen eigentlich erst richtig Spaß. Dafür gibt es eine simple Erklärung: Ethanol blockiert nicotinische Acetylcholin-Rezeptoren, so dass beim Alkoholtrinken mehr geraucht werden muss, um wach und kreativ zu bleiben, d.h. sich zu entspannen ohne einzuschlafen.
Nicotin gehört zu den neuroaktiven Stoffen, die am schnellsten süchtig machen. Sie wollen das nicht glauben? Falls Sie rauchen, dann hören Sie doch einfach auf, und zwar für immer. Ich kenne einen Kollegen, der hat es zwei Jahre lang geschafft; dann fing er wieder an. Das zeigt, wie dauerhaft das Suchtgedächtnis ist. Ob jemand das Rauchen aufgibt, muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich erinnere mich in meiner Schulzeit an Filme, in denen gezeigt wurde, wie Teerlungen von Rauchern aussehen, wie Raucher unter Raucherkarzinomen leiden, – aber auch wie Raucher nach Amputation ihres Raucherbeins oder nach einer Kehlkopfoperation weiter rauchten. Als wir aus dem Kino kamen, steckten wir uns zur Beruhigung erst mal eine Zigarette an.
Lassen Sie mich abschließend zur Tabak-Problematik noch ein Paar informative Zahlen nennen. Vergleicht man die Todesursachen in Deutschland durch Straßenverkehr, Drogen, Totschlag, Mord (M) einerseits und Alkohol (A), Tabak (T) andererseits, so ergibt sich ein Verhältnis M:A:T (Stand 2004)
1 : 5 : 15
Etwa 5 Mio. Raucherinnen und Raucher sterben pro Jahr weltweit an den folgen ihrer Nikotinsucht. Diese Anzahl wird „kompensiert“, – und zwar am leichtesten durch Jugendliche. Für Jugendliche ist Rauchen Teil des Erwachsenseins; Mädchen und junge Frauen meinen, als Raucherinnen sich zu emanzipieren und durch Nikotin ihr Körpergewicht regulieren zu können. Das Einstiegsalter beträgt 11,6 Jahre (Hamburg 2005). Tabakzusätze wie Vanille und Kakao macht Zigaretten für Jugendliche schmackhafter und erleichtert die – für sie ungewohnt schmerzhaften – Lungenzüge. Alkalische Tabakzusätze aus Harnstoff bewirken, dass – infolge der pH-Wert-Erhöhung – das Nikotin von der Lunge leichter aufgenommen und somit die Wirkung im Gehirn beschleunigt und verstärkt wird. Dementsprechend schnell setzt die Entzugserscheinung ein und der „erlösende“ Griff zur nächsten Zigarette. Der sorglosere Umgang mit „leichten“ nikotinärmeren Zigaretten kann aufgrund von Harnstoffzusätzen ein gesteigertes Suchtpotenzial nach sich ziehen.
> Aus neurobiologischer Sicht ist für passionierte Raucherinnen und Raucher die Beseitigung der Nikotin-Entzugserscheinungen ein wesentlicher Teil ihres Tabakgenusses <
Ein paar Worte zum Passivrauchen. Nach einer Statistik des Deutschen Krebsforschungszentrums sterben in Deutschland über 3000 Menschen an den Folgen des Passivrauchens. Dazu sollte man über den Rauch folgendes wissen:
Hauptstromrauch entsteht während des Zuges an der Zigarettenspitze bei ca. 950°C und enthält 40-60 verschiedene karzinogene Substanzen, die primär der Raucher selbst sich einverleibt.
Nebenstromrauch entsteht – zwischen den Zügen – an der glimmenden Zigarette bei ca. 500°C und ist weitaus toxischer als der Hauptstromrauch, denn er entlässt höhere Mengen Formaldehyd und enthält mindestens 300fach mehr karzinogene Substanzen. Wissenschaftler haben im Urin von Säuglingen rauchender Eltern erhebliche Mengen karzinogener Stoffe nachgewiesen, die eindeutig aus Tabakrauch stammen. – Welche Konsequenzen werden daraus gezogen?
In der Gastronomie der EU bestehen die strengsten gesetzlichen Rauchverbote in:
- Norwegen (seit Juni 2004)
- Nord-Irland (seit April 2004)
- Schweden (seit Juni 2005)
- Italien (seit 2005)
- Schottland (seit März 2006)
- England (ab Mitte 2007)
In der Gastronomie der EU bestehen keine gesetzlichen Rauchverbote (Stand: 2006) in:
- Deutschland
- Estland
- Griechenland
- Österreich
- Polen
Wir kommen jetzt zu einem Stimulans ohne Suchtpotenzial, nämlich dem Coffein des Kaffees. Coffein greift in Abbauprodukte des Energiestoffwechsels ein. Wenn wir unseren Tag beginnen, wird Adenosintriphosphat ATP im Laufe des Tages gebraucht. Dabei entsteht unter anderem Adenosin, das sich bis zum Abend anhäuft. Man kann sagen, das Adenosin ist gewissermaßen der Sand des Sandmännchens. „Das Sandmännchen kommt“ und Adenosin geht mit Adenosin-Rezeptoren eine Bindung ein, woraufhin inhibitorisches Gi-Protein aktiviert wird, das seinerseits die Bildung von cAMP aus ATP hemmt. Durch das Absinken des cAMP Spiegels im Neuron sinkt die Erregbarkeit, und wir werden abends müde. Dem kann man mit einer Tasse starkem Bohnenkaffee entgegenwirken. Coffein dockt ebenfalls an Adenosin-Rezeptoren an, allerdings an solche, die mit einem stimulierenden Gs-Protein gekoppelt sind und durch Aktivierung der Adenylatcyclase die cAMP-Produktion ankurbeln. Das führt zum Anstieg der Erregbarkeit und fördert Wachheit.
Der Signalweg zur Aktivierung der Adenylatcyklase führt gleichzeitig zur Hemmung der Ausschüttung des „Schlafhormons“ Melatonin und zur Verstellung des zirkadianen Rhythmus z.B. bei Jetlag. Bitte fragen Sie mich nicht wie der verstellt wird – vor oder nach – ,aber Kaffee soll angeblich helfen. Die folgende Folie zeigt Ihnen in einer Zusammenfassung die vielfältigen Wirkungen des Coffein.
Wir kommen abschließend zum Joint; woraus besteht er? Bei Marihuana handelt es sich um getrocknete Blüten und Zweigspitzen des Indischen Hanf Cannabis sativa. Haschisch enthält getrocknete Blütenharze derselben Pflanze. Die chemisch wirksame Substanz ist das Cannabinoid delta9-Tetrahydrocannabinol, abgekürzt THC. Das THC wirkt im Gehirn mit Cannabinoid-Rezeptoren des Typs CB1. Wir alle besitzen also Cannabinoid-Rezeptoren, die allerdings nicht für Haschisch oder Marihuana vorgesehen sind; der natürliche Ligand ist ein ganz anderer Stoff und heißt Anandamid; es ist ein Metabolit der Arachidonsäure. Gelangt THC ins Gehrin, geht es eine Bindung ein mit einem GI-Protein, das über eine Hemmung der Adenylatcyclase den cAMP-Spiegel, und damit die Erregbarkeit, senkt: der Kiffer wirkt gelassen und stumpft nach außen ab. Weiterhin kommt es zur Muselrelaxation, Herabsetzung des Muskeltonus, Wahrnehmungstrübungen, – die als angenehm empfunden werden. Was das Suchtpotential anbetrifft, darüber wird kontrovers diskutiert.
THC kann auch an CB2-Rezeptoren von Makrophagen andocken; das führt zur Immunsuppression, d.h. zu einem Herunterfahren des Immunabwehr. Da diskutiert wird, Cannabis für AIDS-Patienten freizugeben, stellt sich die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist. Zur Gefährlichkeit von Cannabis gibt einen anderen Aspekt, der besonders kritisch erscheint, nämlich, dass etwa jeder 10. Mensch genetisch bedingt – man kann es ihm äußerlich nicht ansehen – nach Cannabis-Genuss unter Gedächtnisverlust leidet infolge einer Schädigung von Neuronen des Hippokampus. Das ist die schlechte Botschaft; die gute Botschaft ist vielleicht, dass der Hippokampus zu jenen wenigen Hirnstrukturen gehört, in denen Nachschub von Neuronen möglich ist, aber verlassen sollte man sich nicht darauf.
Das war’s für Block6, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
_________________________________________________________
Block7: Neurochemie der Emotionen (II)
Opiat-Sucht, Methadon; Schizophrenie; Depressionen; Angst, Tranquilizer; Ethanol; "Cheeseburger-Phänomen", Melatonin/Serotonin, Winterdepression
_________________________________________________________
vgl. Abbildungen Block 7
Fragen zu Block 7:
• Stadien der Drogensucht: Wie entsteht Sucht?
• End(ogene M)orphine: Wo im Gehirn sind Opiat-Rezeptoren lokalisiert?
• Wie konkurrieren Opiat-Rezeptoren mit Neurotransmitter-Rezeptoren?
• Auf welchen neurochemischen Prozessen basiert Opiatsucht?
• Worin unterscheiden sich die Wirkungen von Heroin und Methadon?
• Vorfreude und Freude. Wo liegt der zentrale Schalter für Sucht?
• Welche Folgen hat ein krankhafter Dopamin-Mangel bzw. Dopamin-Überschuss?
• Lässt sich Dopamin-Überschuss bei Schizophrenie im Gehirn sichtbar machen?
• Antischizophrenika: Wie wirken Reserpin und Chlorpromazin?
• Woraus wurde Reserpin gewonnen?
• Können emotionale Veränderungen krankheitsbedingt sein?
• Wie wirken Antidepressiva?
• Wie wird Angst kontrolliert? Gibt es einen Angst-Lautstärkeregler bzw. Angst-Ausschalter?
• Welche Wirkungen besitzen Benzodiazepine?
• Wo im Gehirn befinden sich Rezeptoren für Benzodiazepine?
• Warum wirkt Alkohol in zweifacher Weise beruhigend?
• Woher stammen die Neurotransmitter?
• Wie kann man Nahrung zusammensetzen, damit sie uns glücklich macht?
• Warum werden manche Menschen im Spätherbst/Winter depressiv und dick?
• Melatonin-Overhang: Warum sind Längschläfer nach dem Aufwachen häufig ärgerlich/depressiv?
• Hat Muttermilch auf Babies antidepressive Wirkung?
• Warum wikt sich Sekundenschlaf auf die Stimmung positiv aus?
.
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie zu Block7 Neurochemie der Emotionen Teil II. Wir haben in den letzten Blöcken festgestellt, dass Synapsen vielfältige Funktionen haben: Übertragung, Bahnung, Hemmung, Modulation, Verrechnung, Speicherung. Offenbar dienen Synapsen auch als Schalter für unsere Gefühle. Diese Schalter lassen sich – z.B. pharmakologisch – beeinflussen, so dass Gefühle oder Stimmungen ein und ausgeschaltet werden können.
Kommen wir zum Menü des heutigen Block7. Zunächst beschäftigen wir uns mit endogenen Morphinen, d.h. Endorphinen. In diesem Zusammenhang sind neurobiologische Grundlagen der Opiatsucht aufzuklären. Was versteht man unter Methadon-Substitution? Wir werden dann auf krankhafte Veränderungen unserer Emotionen eingehen und hier Schizophrenie, Depressionen und Angstneurosen besprechen sowie pharmakologische Behandlungsmöglichkeiten tangieren. Schließlich werden wir neuroaktive Stoffe des alltäglichen Lebens, einschließlich der Nahrung, kennen lernen, z.B. das Cheeseburger-Phänomen: wie kann man Nahrung zusammensetzen, damit sie uns fröhlich macht? Warum werden manche Menschen im Winter depressiv, und was hat das mit dem Melatonin- bzw. Serotoninspiegel zu tun?
Diese Folie zeigt unseren Fahrplan. Wir beginnen mit den Stadien der Drogensucht am Beispiel der Opiatsucht. Kurze Wiederholung: wir unterscheiden folgende Stadien der Drogensucht, die Phase der Toleranz (konstante Reaktionen und Gegenreaktionen), die Phase der Resistenz (Gewöhnung) und die Phase der Abstinenz (Entzug). Dass unser Zentralnervensystem überhaupt auf Opiate reagiert, hängt damit zusammen, dass es über eigene Morphine, Endorphine, verfügt. Für diese gibt es im ZNS Opiatrezeptoren. Es gibt verschiedene Arten von Endorphinen, die z.T. sehr unterschiedliche Funktionen haben, die in allen Einzelheiten noch keineswegs geklärt sind. Dementsprechend gibt es auch verschiedene Typen von Opiatrezeptoren. Endorphine werden z.B. in Ausnahmesituationen ausgeschüttet; sie dienen der Schmerzlinderung und der Entwicklung eines emotionalen Hochgefühls. Dieses Hochgefühl kennen Sie alle, z.B. nach dem Joggen oder anderem körperlichen Dauertraining: man ist für kurze Zeit „high“. Aus Feldzügen wird berichtet, dass Soldaten, deren Gliedmaßen abgetrennt worden waren, dies zunächst gar nicht bemerkt hatten. So stark war ihre Schmerzempfindung reduziert.
Wo im Gehirn befinden sich Opiatrezeptoren? Die folgende Folie zeigt dies am Beispiel eines Meerschweinchens. Wir stellen fest, dass Opiatrezeptoren nicht streng lokalisiert, sondern über weite Bereich des Gehirns verteilt sind, besonders dicht im Limbischen System.
Wo an den Synapsen befinden sich Opiatrezeptoren und wie interagieren sie mit normalen Neurotransmitter-Rezeptoren? Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die folgende Darstellung aus didaktischen Gründen sehr stark vereinfacht ist und lediglich zur groben Veranschaulichung der höchst komplexen Zusammenhänge dienen kann. Wir kennen diese Art der Kurzdarstellung von Synapsen bereits: hier wäre die präsynaptische Membran, hier der synaptische Spalt und dort die postsynaptische Membran. Betrachten wir eine postsynaptische Funktionseinheit: Neurotransmitter, z.B. Noradrenalin, dockt an einen Gs-Protein gekoppelten Rezeptor; das stimulierende Gs-Protein aktiviert daraufhin Adenylatcyclase, die wiederum die Bildung von cAMP aus ATP vermittelt. Das kennen wir. Dies führt u.a. zur Erregung der postsynatischen Membran.
Zu solch einer postsynaptischen Funktionseinheit können Opiatrezeptoren gehören. Jene korrespondieren nicht mit einem Gs-Protein sondern mit einem inhibitorischen Gi-Protein, das – nach Bindung von Opiat an den Opiatrezeptor – die Adenylatcyklase hemmt. So konkurrieren besetzte Neurotransmitter-Rezeptoren und besetzte Opiatrezeptoren um die Adenylatcyclase: die einen wollen sie aktivieren, die anderen inaktivieren. Lassen Sie uns das einwenig genauer verfolgen. Normalerweise geht der Weg – wie bekannt – über den Neurotransmitter. Solange keine Opiatmoleküle vorhanden sind, ist „die Welt in Ordnung“, d.h. cAMP wird produziert, das die Erregbarkeit des Neurons sichert. Wenn allerdings Opiate vorhanden sind, führen sie durch Hemmung der Adenylatcyklase zur Abnahme von cAMP, das heißt, die Erregbarkeit des Neurons wird herunter gefahren; gleichzeitig könnte der mit Opiat besetzte Opiatrezeptor den Neurotransmitter-Rezeptor blockieren. Diese Art der „neuronalen Abstumpfung“ wird vom Opiat-Konsument offenbar als angenehm empfunden.
Kommen wir jetzt zu den neurochemischen Prozessen, die der Opiatsucht zugrunde liegen (können). Sobald die cAMP Produktion sinkt, „wehrt“ sich das Neuron mit gegenregulatorischen Maßnahmen: es bildet neue Neurotransmitter/Rezeptor/Gs-Einheiten in der Erwartung, dass der Neurotransmitter wieder wirken kann. Das fatale ist jedoch, dass – flankierend – sich gleichzeitig die Opiatrezeptor/Gi-Einheiten vermehren und in Konkurrenz treten. Das Neuron antwortet mit der Bildung weiterer Neurotransmitter/Rezeptor/Gs-Einheiten mit dem Ergebnis, dass der Neurotransmitter mehr und mehr zum Zuge kommt und der cAMP-Spiegel wieder ansteigt. Es kommt zur Einstellung eines neuen Gleichgewichts zwischen Opiatreaktion und der Gegenreaktion des Neurons. Man kann sagen, dass das Ganze schon schlimm genug ist. Denn die Einstellung dieses Gleichgewichts erfordert immer mehr Opiatzufuhr mit den entsprechenden Beschaffungs- und Dosierungsproblemen.
Ist die Droge nicht verfügbar, kommt es zum Entzug: jetzt liegen alle Neurotransmitter-Rezeptoren buchstäblich blank und „schreien“ nach Neurotransmitter, der ausreichend verfügbar ist, denn er wurde zuvor kaum gebraucht. Dies führt zu einem immensen Anstieg der cAMP-Produktion und zu sehr starker Erregung der Neuronen. Das wiederum manifestiert sich in qualvollen Entzugserscheinungen und in der Gefahr eines Rückfalls, denn die Entzugserscheinungen lassen sofort nach, wenn eine entsprechend hohe Opiatdosis wieder zugeführt wird. Dann stellt sich wieder ein neues Gleichgewicht ein zwischen Opiatreaktion und der Gegenreaktion des Neurons.
Kommen wir zur Frage, wie man Opiatsüchtigen helfen kann. Eine Möglichkeit besteht in der Opiatsubstitution durch Methadon. Bevor wir auf die Methadonbehandlung näher eingehen, müssen wir zunächst folgendes festhalten. Das Hauptziel langjährig praktizierender Drogensüchtiger, besteht wohl weniger darin, sich ein angenehmes Gefühl zu verschaffen, sondern vor allem darin, die Entzugserscheinungen los zu werden. Die Entzugserscheinungen sind abhängig von der Drogenwirkung. Wirkt die Droge schnell, dann setzen starke Entzugserscheinungen schnell ein, verbunden mit einer starken Abhängigkeit von der Droge, ihrer Dosis und der Perspektive des Exitus. Wirkt die Droge dagegen langsam, kommt es zu relativ schwachen Entzugserscheinungen, und die Einstellung einer Drogen-Erhaltungsdosis unter ärztlicher Aufsicht ist möglich mit der Perspektive des Absetzens.
Hier greift z.B. die Substitution von Heroin durch Methadon an. Zunächst stellt sich die Frage: worin unterscheidet sich eigentlich Heroin von Methadon? Denn beide docken an Opiatrezeptoren, beide sind, wenn sie direkt d.h. intravenös appliziert werden, sofort im Gehirn wirksam. Genau genommen ist Methadon (L-Methadon =L-Polamidon), intravenös injiziert, in seiner Wirkung noch fataler als Heroin. L-Methadon erreicht dann die zweifache Wirkung von Morphium. Worauf beruht also die unter ärztlicher Aufsicht durchgeführte Methadon-Therapie? Dazu muss man etwas über den Applikationsmodus wissen. Opiate, intravenös injiziert, gelangen über den Blutkreislauf direkt in das Gehirn und wirken sofort. Therapeutisch wird Methadon, in einer auf das Individuum abzustimmenden Dosis oral verabreicht. Um Missbrauch zu verhindern, liegt es für Substitutionszwecke in dickflüssiger Sirupform vor. Nach oraler Verabreichung wird es im Verdauungssystem resorbiert, gelangt dann in geringer Dosis in den Blutkreislauf und wird – das ist jetzt der wichtige Effekt – in der Leber gespeichert. Nun, die Speicherung von Giften in der Leben sollte man tunlichst vermeiden; hier jedoch wird die Speicherung von Methadon genutzt. Aus der Leber entwickelt Methadon eine Art Depotwirkung, indem es in moderater Dosis über den Blutkreislauf in das Gehirn gelangt. Wenn Entzugserscheinungen drohen, wird immer gerade soviel nachgeliefert, dass sie gemildert werden. Mit schrittweiser Reduktion der Methadondosis und langsamen Ausschleichen der Dosis kann erreicht werden, dass der Opiatabhängige von der Droge loskommt.
In dieser Folie habe ich für Sie einige Informationen über die L-und D-Form von Methadon sowie das L-D Racemat zusammengestellt bezüglich Einsatzmöglichkeiten und Wirkungsspektren.
Dieses Thema abschließend lassen Sie uns noch einmal die Licht- und Schattenseiten des Nucleus accumbens betrachten. Auf der einen Seite stellt er eine Art „Schalter des Glücks“ dar, auf der anderen Seite ist er die „Wurzel der Sucht“. Auf der einen Seite die Dopamin-Rezeptor vermittelten positiven Aspekte: wir lachen gern, wir arbeiten gern, wir spielen gern. Auf der anderen Seite kann dies, übertriebenermaßen, zur Sucht führen: Lachanfall, Workaholic, Glücksspielsucht. Übrigens, Sie haben richtig gehört, auch beim Lachanfall ist der Accumbens sehr aktiv. Manche Menschen haben – wenn sie beginnen, auch nur etwas zu lachen – große Probleme, einen mittleren oder länger anhaltenden Lachanfall zu unterdrücken. Eigentlich bewirkt das Unterdrücken eher das Gegenteil. Ich erinnere mich an eine Situation im Europarat während wir über wichtige Forschungsfragen diskutierten. Auf einmal fing der Gesandte eines Landes an, zu lachen, und zwar ohne erkennbaren Grund, denn das Thema war absolut ernst. Er steigerte sich in einen Lachanfall so stark hinein, dass die Sitzung beinahe hätte unterbrochen werden müssen, hätte er es nicht selbst vorgezogen, sich schüttelnd vor lachend den Raum zu verlassen, um danach wieder, sich entschuldigend, tot ernst zurückzukehren.
Schlagen wir jetzt ein neues Kapitel auf: wir haben gesehen, wie neurochemische Gleichgewichte durch Drogen gestört werden können und wollen jetzt der Frage nachgehen, inwieweit Störungen solcher Gleichgewichte auf Krankheit beruhen können. Betrachten wir zunächst die dopaminergen Systeme; insgesamt gibt es zwei. Das eine ist das bereits vertraute mesolimbische System, dessen Neurone aus der mesencephalen Ventralhaube ihre Axone u.a. zum telencephalen Accumbens entsenden; das andere ist das nigrostriatale System, dessen Neurone aus dem mesencephalen Nucleus niger (Substantia nigra, Schwarzer Kern) ihre Axone zum telencephalen Corpus Striatum entsenden. Das Striatum ist u.a. an der Motorkoordination beteiligt. Dopamin-Mangel oder -Überschuss in diesen Systemen führt zu Krankheiten.
Bei Parkinsonismus, auch Schüttellähmung genannt, handelt es sich um eine Krankheit des motorischen Systems, die auf Dopaminmangel im Striatum zurückzuführen ist. Der Dopaminmagel beruht auf der Degeneration von Neuronen im Nucleus niger. Auf die Parkinsonsche Krankheit werden wir in einem späteren Vorlesungsblock näher eingehen.
Bei Schizophrenie besteht eine Überempfindlichkeit für Dopamin bzw. Dopaminüberschuss im limbischen System. Es ist möglich, mit Bild gebenden Verfahren die Dopaminverteilung im Belohnungssystem sichtbar zu machen. Hierbei zeigt sich, dass bei einer schizophrenen Person im Vergleich zu einer gesunden der Dopaminspiegel deutlich höher liegt. Ein charakteristisches Phänomen bei Schizophrenie sind Halluzinationen. Man versteht darunter das Unvermögen zwischen Realität und Einbildung unterscheiden zu können, dem übrigens auch Cocainsüchtige nach starken Dopaminausschüttungen ausgesetzt sein können. Ich möchte betonen, dass Schizophrenie ein komplexes Syndrom ist, das keineswegs allein auf erhöhter Dopaminwirkung beruht.
Die erhöhte Dopaminsensitivität der Schizophrenie lässt sich mit sog. Antischizophrenika behandeln. Diese zu der Gruppe der Neuroleptika gehörenden Pharmaka blockieren Dopamin-Rezeptoren (ohne weitere Signalwege zu aktivieren) und reduzieren damit die Dopaminwirkung. Ein klassisches Antischizophrenikum ist Chlorpromazin, das jedoch wegen seiner Nebenwirkungen heute durch bessere Medikamente ersetzt worden ist. Bei der Medikation muss besonders auf die Dosierung geachtet werden, denn überdosiert kann es – bei der systemischen Applikation – auch im Striatum wirken und folglich zu einem Parkinson ähnlichen Syndrom, dem „Parkinsonoid“, führen.
Parkinson kranken Menschen kann geholfen werden, indem der Dopaminspiegel durch orale Verabreichung von L-Dopa, einer Vorstufe von Dopamin, angehoben wird. Verabreichung von Dopamin wäre wirkungslos, weil Dopamin die Blut/Hirn-Schranke nicht passieren kann. Auch bei der Behandlung mit L-Dopa ist es manchmal schwierig, gerade so zu dosieren, dass der Dopaminspiegel im Belohnungssystem nicht zu stark ansteigt. Die Folgen wären Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit bis hin zu Halluzinationen.
Wir machen jetzt einen Exkurs zur Problematik „Pharmaka und ihre Nebenwirkungen“. Dies möchte ich am Beispiel des Reserpin erläutern. Reserpin ist ein Alkaloid aus den Wurzeln einiger Hundsgiftgewächse z.B. der indischen Rauwolfia serpentina , einer „Heilpflanze“, deren Anwendung erstmals 1931 in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erwähnt worden ist. Erst 1952 wurde die chemische Struktur aufgeklärt und 1956 gelang die Synthese. Für Reserpin gab es zwei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: als Antihypertonikum bei Bluthochdruck und als Antischizophrenikum bei Schizophrenie. Als Antischizophrenikum führte es zu einer sog. Entspeicherung dopaminerger Vesikel, also zur Dopaminabnahme in den Vesikeln. Reserpin dringt in den Axonendknoten ein und führt im Endeffekt zur Entspeicherung des monoaminergen Neurotransmitters. Bildlich – z.B. zur Veranschaulichung für Schüler – kann man sich das so vorstellen, dass Reserpin in den Vesikel schlüpft und Dopamin aus dem Vesikel in das Zytoplasma drängt, wo es zerfällt.
Um diese Entladung der Speicher genau zu verstehen, muss man zunächst etwas über die vesikuläre Speicherung von Monoaminen wissen. Ihre Speicherung im Vesikel erfolgt mittels eines Amin-Carriers und einer ATP-abhängigen Protonen-Pumpe, die im Vesikel zu einer Protonierung des monoaminergen Neurotransmitters führt. Reserpin inaktiviert diese Protonen-Pumpe durch Hemmung der Mg2+ abhängigen ATPase. Mangels Protonierung diffundiert der Neurotransmitter in das Zytoplasma, wo er von der Monoaminoxidase MAO desaminiert und damit abgebaut wird. Tierversuche weisen darauf hin, dass bei relativ hoher Dosierung von Reserpin eine irreversible Schädigung der betroffenen Vesikel angenommen werden muss.
Nach Verabreichung von Reserpin als Antihypertonikum bzw. Antischizophrenikum konnten sich gravierende Nebenwirkungen einstellen. Die behandelten Patienten wurden depressiv. Als in den 70er Jahren in den Vereinigten Staaten eine statistische Analyse ergab, dass eine positive Korrelation zwischen der Verabreichung von Reserpin und der Suizithäufigkeit sowie dem Auftreten von Parkinsonismus der behandelten Personen bestand, wurde Reserpin dort aus dem Handel genommen. Bereits 1956 hatte man sich über die Ursachen dieser Nebenwirkungen Gedanken gemacht. Wir erinnern uns an den Mechanismus der Entspeicherung der Vesikel: Reserpin attakiert die dopaminergen Vesikel und führt damit in monoaminergen Vesikeln allgemein zur Entspeicherung, also auch von Noradrenalin bzw. Serotonin, die jeweils im Zytoplasma durch MAO abgebaut werden. Ein Mangel dieser Neurotransmitter an noradrenergen bzw. serotonergen Synapsen stimmt Menschen depressiv, so dass Suizitgefahr besteht. Das Reserpin-Beispiel verdeutlicht zwei Aspekte:
(1) dass Pharmaka gegen Krankheiten Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen haben können, wobei abzuwägen ist, ob die Nebenwirkungen schädlicher sind als die zu behandelnde Krankheit; die Aufgabe der pharmazeutischen Industrie besteht darin, selektiv wirkende Mittel zu erforschen und deren Nebenwirkungen zu minimieren
(2) dass man gelegentlich hört: Natur ist gut, Chemie ist schlecht; die Chemie der Naturheilkräuter kann jedoch für den Menschen ebenfalls gefährlich sein; die chemische Erforschung neuer Medikamente hat zum Ziel, deren Risiken zu senken; diese Möglichkeit hat die Natur nicht
Was sagt
über gravierende Nebenwirkungen, die von Reserpin dosisabhängig ausgehen können?
____________________________________________________________
NATURHEILKUNDELEXIKON
Reserpin
Das Rauwolfia-Alkaloid entlädt die neuronalen Speicher für Noradrenalin und Serotonin. Dabei kommt es neben einer sedierenden Wirkung auch zur Senkung des Blutdrucks.
Rauwolfia serpentina
Schlangenwurz. Verwendet wird der Gesamtextrakt der Droge. Da es sich um ein Forte-Präparat handelt, sollten nur Fertigpräparate verwendet werden. Rauwolfia ist ein Parasympathikomimetikum und wird meistens zur Blutdrucksenkung verwendet.
Rauwolfia ist verschreibungspflichtig.
____________________________________________________________
Wir kommen jetzt zum Krankheitsbild der endogenen Depressionen. In der nächsten Folie ist noch einmal unser launischer Stimmungsverlauf dargestellt, in dem Phasen des Tiefs mit Phasen des Hochs – natürlich nicht so regelmäßig wie hier skizziert – abwechseln können.
Sie erinnern sich noch: ich freue mich eigentlich immer, wenn ich mich in einem Tief befinde, denn das nächste Hoch kommt bestimmt. Solche Stimmungsschwankungen sind normal.
Es gibt jedoch Menschen, die unter endogenen biopolaren Depressionen leiden, bei denen solche wiederkehrenden Höhen und Tiefen sehr stark ausgeprägt sind und krankhafte Ursachen haben. Die Betroffenen sind manisch depressiv. Die positiven Stimmungsphasen sind stark überhöht. In diesen Phasen der Manie erwecken die Betroffenen einen überaus fröhlichen Eindruck. Auf die Phase der Manie folgt eine Phase der Depression, der völligen Niedergeschlagenheit. Jene Phasen der Depression können so schwerwiegend sein, dass die Betroffenen Suizit gefährdet sind. Endogene Depressionen beruhen u.a. auf einem Mangel an Noradrenalin und Serotonin. Hierzu schauen wir uns in der Folie noch einmal an, wo im Gehirn Noradrenalin (Blauer Kern) bzw. Serotonin (Raphe-Kern) produziert werden. Lassen Sie uns verfolgen, wo sich im Gehirn ein etsprechender Mangel an diesen Neurotransmittern auswirken kann. Wir sehen, wie weitreichend ein einzelnes Neuron über zahlreiche verästelte Axonkollaterale weite Bereiche des Gehirns beeinflussen kann.
Den Betroffenen muss und kann – mit psychischer Unterstützung – medikamentös geholfen werden. Wir wollen jetzt sehen, wie Antidepressiva wirken können. Zu den klassischen Trizyklischen Antidepressiva gehört das Imipramin. Der Einfluss an noradrenergen Synapsen besteht darin, dass es an der präsynaptischen Membran den Rücktransport von Noradrenalin in den Axonendknoten verhindert, also den Rücktransporter inaktiviert. Dadurch wird die Wirkung von Noradrenalin an der postsynaptischen Membran verstärkt. Ein moderner Vertreter der Rücktransport-Hemmer ist Fluoxetin (Prozac).
Da ich von Studierenden häufig gefragt werde, warum man als Antidepressivum nicht Ecstasy verabreicht, zeige ich hier die Wirkung von Ecstasy. Ähnlich wie Imipramin verstärkt es an serotonergen Synapsen den Einfluss von Serotonin, was sich zweifellos antidepressiv auswirkt. Problematisch an Ecstasy sind seine diversen Nebenwirkungen als Designerdroge (Amphetamin-Derivat).
Es gibt weitere Antidepressiva, die wir nicht im Einzelnen besprechen wollen, z.B. solche, die die Monoaminoxidase hemmen: MAO-Hemmer. Problematisch ist bei diesen, dass hierdurch nicht nur die Noradrenalin -und Serotoninspiegel, sondern auch der Dopaminspiegel angehoben wird.
Wir wollen noch eine wichtige Ursache beleuchten, die zu Depressionen führen kann, nämlich Stress. Gemeint ist nicht der positive Stress, auch Eustress genannt, sondern der negative Distress, also Dauerstress. Unter dem Einfluss von Stress auslösenden Reizen, auch Stressoren genannt, werden zwei Stressachsen aktiviert. Ein wichtiger Stressor entsteht unter sozialem Stress wie Mobbing. Dies kann bei den Betroffenen zu schweren Depressionen führen. Der neurobiochemische Hintergrund ist der folgende. Durch Stressoren werden also zwei Stressachsen aktiviert. Auf der einen Seite das
Sympathikus-Nebennierenmark-System: durch Aktivierung des Sympathikus wird das Nebennierenmark angeregt, die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin auszuschütten, die den Organismus in Ausnahmesituationen fit halten. Gleichzeitig kommt es zur Aktivierung der anderen Stressachse dem
Hypophysen-Nebennierenrinden-System: durch Aktivierung des Hypothalamus wird das Corticotropin-Releasing-Hormon CRH als ein Stresshormon ausgelöst, das über Freisetzung des Hypophysenhormons ACTH in der Nebennierenrinde Cortisol freisetzt. Auch Cortisol hält den Organismus in Ausnahmesituationen fit. Aufgrund seiner immundepressiven Wirkung werden Entzündungsreaktionen heruntergefahren, wir können uns z.B. nicht erkälten, während wir uns im Stress befinden, was etwa während einer Examensvorbereitung durchaus positiv sein kann. Aber nach dem Examen, wenn der Stress vorbei ist, werden wir mit Sicherheit krank.
Unter dem Einfluss von Dauerstress, z.B. sozialem Stress, resultiert also eine übermäßige Ausschüttung der Stresshormone CRH und Cortisol, und jene können Depressionen auslösen. Wir wollen das am Beispiel von Tupajas (Spitzhörnchen) verfolgen, die, zu den Primaten zählend, uns stammesgeschichtlich nahe stehen. Schauen wir uns dazu einen Video-Clip an. Demnach führt Dauerstress zum Absterben von Neuronen im Hippocampus des limbischen Systems. Ursache dafür ist, dass Cortisol die Glucose-Aufnahme in die Hippokampuszellen unterdrückt. Wie schon mehrfach erwähnt, ist in dieser Hirnregion – nach Vermeidung von Stress – Nachschub von Neuronen möglich ist.
Mit der Entdeckung der hippokampalen Neurogenese im Erwachsenengehirn scheint sich eine neue Facette für die Ursachen der endogenen Depressionen abzuzeichnen. Als Folge des eingeschränkten Nachschubs von Neuronen durch den Hippokampus verliert das Gehirn an Plastizität und an der Fähigkeit, sich mit neuen Situationen des Alltags auseinander zu setzen, und dies führt bei den Betroffenen möglicherweise zum angstvollen Rückzug in die Abgeschiedenheit. Interessanterweise hat man herausgefunden, dass nach Verabreichung des Antidepressivum Prozac die hippokampale Zellteilungsrate signifikant anstieg. Prozac wirkt bei der ersten Einnahme erst nach 2-3 Wochen, also etwa jener Zeit, die neuronale Vorläuferzellen brauchen, um sich zu Neuronen zu differenzieren.
Wir schlagen jetzt ein weiteres Kapitel auf. Außer dem Belohnungssystem gibt es ein Bestrafungssystem, zu dem u.a. Teile des Nucleus amygdalae gehören. Bestrafung ist mit Angst verbunden. Angst ist zweifellos ein wichtiger Überlebensfaktor, denn Angst macht vorsichtig. Hätten wir keine Furcht oder Angst, würden wir gefahrvollen Situationen nicht ausweichen. Allerdings muss man mit der Angst auch umgehen können, um ihr nicht hilflos zu erliegen. Es gibt Menschen, die unter Angstneurosen leiden und hyperängstlich sind. Damit stellt sich die Frage, wie Angst zentralnervös kontrolliert werden kann. Gibt es Angst-Abschalter oder Angstlautstärke-Regler?
Es gibt sie. Wir veranschaulichen dies an einem groben Schema. Neurone des Angstsystems werden durch inhibitorische Synapsen kontrolliert. Neurotransmitter ist die Gamma-Aminobuttersäure GABA. Bei hyperängstlichen Menschen ist diese Angst-abschaltende GABA-Bremse ineffizient. Ihre Effezienz kann dann medikamentös durch Verabreichung von Tranquilizern verbessert werden; zu diesen gehören die Benzodiazepine, bekanntester Vertreter ist Valium. Lassen Sie uns solche eine Angst-abschaltende Synapse näher betrachten. Hier ist die postsynaptische Membran mit ihren GABA-Rezeptoren von einem Neuron aus dem Angstsystem, und dort ein kontrollierender Axonendknoten mit Vesikeln, die GABA enthalten. Flankiert wird ein GABA-Rezeptor von einem Benzodiazepin-Rezeptor an den – bei medikamentöser Indikation – z.B. Valium andocken und in Kooperation mit GABA den Clorid-Ionenkanal optimal öffnen kann. Damit stellt sich die bislang noch unbeantwortete Frage nach den natürlichen Liganden der Benzodiazepin-Rezeptoren, denn über eigene Benzodiazepine scheint das Gehirn nicht zu verfügen.
Das Problem ist, dass die Andockstellen für Benzodiazepine nicht nur an den Angst-Abschaltern, sondern in weiten verschiedenen Bereichen des Gehirns in unterschiedlicher Dichte verteilt sind. Ein Benzodiazepin wird daher nicht nur die gewünschte Wirkung, sondern auch Nebenwirkungen haben. Früher war Valium fast in aller Munde, sozusagen eine Art Volksnahrung. Heute weiß man, dass alle Benzodiazepine ein relativ hohes Suchtpotenzial haben. Die pharmazeutische Industrie forscht daher nach Wirkstoffen, die möglichst nur an die Benzodiazepin-Rezeptoren der Angst-Abschalter andocken.
Bekanntlich sollen Beruhigungstabletten, wie Tranquilizer, nicht zusammen mit Alhohol eingenommen werden, aufgrund der potenzierenden Kombi-Wirkung. Ein Blick auf die postsynaptische Membran der Angst-Abschaltenden Synapse erklärt dieses Phänomen. Neben den GABA-Rezeptoren befinden sich nämlich nicht nur Benzodiazepin-Rezeptoren, sondern auch Sedativa-Rezeptoren, an die Ethanol andocken und die GABA-Bremse zusätzlich verstärken helfen kann, mit unvorhersehbaren fatalen Folgen.
Wenn wir schon beim Alkohol sind, wollen wir sehen, wie er – unabhängig von Benzodiazepinen – wirkt. Zur Beruhigung oder Entspannung kann man sich wohl mal abends ein Gläschen genehmigen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Die beruhigende Wirkung wird auf zwei Wegen erreicht. Zum einen verstärkt Ethanol die GABA-Bremse, wie wir gesehen haben. Zum anderen hemmt Ethanol den Glutamat-Beschleuniger; d.h. Ethanol blockiert Glutamat-Rezeptoren, wodurch die Erregbarkeit im ZNS heruntergefahren wird. Wie gesagt, ein Bierchen in Ehren ist schon OK. Tägliches Saufen wirkt sich jedoch fatal aus. Auf die Blockade ihrer Glutamat-Rezeptoren antworten die Neurone mit der Bildung neuer Glutamat-Rezeptoren, was den Alkoholkonsum erhöht. Das ist schon schlimm genug. Bleibt der Alkohol jedoch aus, „schreien“ die Glutamat-Rezeptoren nach dem verfügbaren Glutamat, was – als Entzugserscheinung – zu exzessiver Erregung im ZNS führt mit dem einher gehenden Problem des Weitertrinkens.
Lassen Sie uns endlich dieses traurige Kapitel verlassen und uns mit einigen harmlosen Lebensgewohnheiten befassen, die uns fröhlich stimmen. Das „Cheeseburger-Phänomen. Zunächst die Frage, woher kommen die Neurotransmitter, die fallen doch nicht vom Himmel? Sie stammen natürlich aus der Nahrung. Proteine werden enzymatisch zu Aminosäuren abgebaut. Glycin und Glutamat fungieren als Neurotransmitter. Aus Tyrosin entstehen Dopamin und Noradrenalin, und aus Tryptophan entsteht Serotin.
Wenn das so ist – und wie könnte es anders sein –, sagten sich amerikanische Ernährungswissenschaftler, dann müsste man eine Mahlzeit so zusammensetzen können, dass möglichst viel Serotonin entsteht. Das erhöht den Frohsinn, und die – handlich kompakt verpackte – Mahlzeit wird ein Verkaufs-Renner. Die Rezeptur ist erschütternd simpel, die Theorie dahinter jedoch nicht ganz unkompliziert. Darauf muss man erst einmal kommen: man mische kohlenhydratreiche proteinhaltige Kost im Verhältnis von etwa 1:0,4. Das wär’s schon; was passiert dabei? Der starke Kohlenhydrat-Abbau führt zu einer starken Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Aus dem Protein-Abbau entstehen Aminosäuren, von denen Tryptophan an Albumin gebunden wird. Unter dem Einfluss der Glucose steigt der Insulinspiegel stark an; das führt zur Einschleusung von
- Glucose in die Leberzellen zwecks Bildung von Glycogen
- Aminosäuren (wenig Tryptophan) in Muskelzellen zwecks Bildung von Proteinen
Jetzt kommt der Pfiff: an der Blut/Hirn-Schranke zu den Neuronen besteht Konkurrenz zwischen Tryptophan und den übrigen Aminosäuren; Tryptophan, das sozusagen im Vordergrund steht, passiert bevorzugt und wird in den Neuronen des Raphe-Kerns umgewandelt in Serotonin.
Seit Jahrzehnten gibt es Handelsketten – eine fing damit an, andere machten es nach – die diese „handlich kompakt verpackten“ Nahrungseinheiten nach der gleichen Rezeptur (besser Prinzip) herstellen. Wenn ich mir vorstelle, wie viel Mühe sich die Köche in der Mensa geben, und versuchen, das Essen mundig und vielgestaltig zu zelebrieren und wie wenig positiv es oft angenommen wird, auf der einen Seite, und was für ein Renner diese simplen Buletten sind, dann kann es dafür nur eine Erklärung geben: S e r o t o n i n. Wenn man sich die Zusammensetzung von „Hamburgern“, „Cheesburgern“ und „Big Mac“ ansieht, dann ergibt sich in der Zusammensetzung von Kohlenhydrat:Protein ein Verhältnis von 1:0,3 bis 1:0,5.
Dies führt uns zu einer anderen Frage, nämlich, warum werden manche Menschen im Spätherbst und Winter depressiv und gleichzeitig dick? Nun, das hat etwas mit der Tageslänge zu tun, genau genommen mit der Hell-Dunkel-Periode, in der die Dunkelphase gegen Ende des Jahres zunehmend dominiert. Während im Hellen der Serotoninspiegel relativ hoch ist, dominiert im Dunkeln der Melatoninspiegel. Macht Melatonin depressiv?
Um diese Frage beantworten zu können, wollen wir grob schematisch verfolgen, wie Melatonin entsteht und welche Aufgabe es hat. Das Ganze hat nämlich etwas mit dem zirkadianen Rhythmus (auch Innere Uhr genannt) zu tun. Die Hell-Dunkel Phasen werden von der Retina perzipiert an den diencephalen Nucleus suprachiasmaticus weiter geleitet. In diesem Nucleus befinden sich Urzellen, die für den zirkadianen Rhytmus verantwortlich sind: sie generieren den Rhythmus autonom und werden durch den Hell-Dunkel-Wechsel synchronisiert. Diese Urzellen übermitteln ihre Information – auf Umwegen – an die Zirbeldrüse, die jeweils in der Dunkelphase aus Serotonin das Hormon Melatonin herstellt und dieses abgibt an die Organe des Körpers zwecks zirkadianer Abstimmung entsprechender Prozesse. Also, nicht Melatonin macht depressiv, sondern der mit der Melatoninproduktion sinkende Serotoninspiegel.
Gegen Winterdepression gibt es ein einfaches Mittel: essen, – aber das Richtige essen, denn nur durch kohlenhydratreiche proteinhaltige Kost wird die Aufnahme der Aminosäure Tryptophan und ihre Umwandlung in Serotonin im Gehirn gefördert. Zusätzlich, oder alternativ, empfiehlt sich eine Phototherapie mit Kunstlicht, das der spektralen Zusammensetzung des Sonnenlichts angepasst ist und die 10fache Intensität des Zimmerlichts hat. Zweifellos hat die Cheeseburger-Diät zwei Seiten: man ist fröhlich, wird aber dick und – wenn zusätzlich noch der Nucleus accumbens zu häufig als Glückszentrum angesprochen wird – fresssüchtig. Diese Folie hier zeigt die „Karriereleiter“ während der Winterdepression: ohne Worte.
Verlassen wir die Winterdepression und kommen zum Schlaf. Während des Schlafs ist der Melatoninspiegel relativ hoch. Es ist daher wohl kein Wunder, dass Säuglinge nach dem Aufwachen erst einmal schreien. Warum, weil sie Hunger haben? Das mag sein. Ich vermute jedoch, dass sie infolge des Melatonin-Overhang depressiv gestimmt sind. Sobald sie Muttermilch bekommen haben, sind sie beruhigt, denn diese Milch macht nicht nur satt, sondern wirkt aufgrund ihrer Zusammensetzung auch antideperessiv. In dieser Folie habe ich für Sie die Zusammensetzung der Mutter-Vormilch, Zwischenmilch und Reifer Milch bezüglich ihrer Kohlenhydrat/Protein-Zusammensetzung vergleichsweise dargestellt. Wir sehen, dass sich das Verhältnis bei der Reifen Milch stark in Richtung Kohlenhydrate verschoben hat, während bei der Kuhmilch dieses Verhältnis eher ausgeglichen ist.
Vielleicht sind deshalb Langschläfer, die zu spät das Tageslicht erblicken, schlecht gelaunte Morgenmuffel, im Vergleich zu den sog. Morgentypen. Daher noch ein paar Worte zum Sekundenschlaf. Wenn wir nach dem Mittagessen ein zu langes Nickerchen machen, sind wir nach dem Aufwachen gereizt und ärgerlich, – warum? Na, Sie wissen schon. Solche Disharmonie konnten sich die alten Mönche nicht leisten. Sie hatten folgenden Trick parat. Nach der Mahlzeit stellten sie ihren Blechteller neben sich auf den Boden und hielten, vor dem Einnicken, ihr Schlüsselbund über den Teller. Sobald sie eingenickt waren, glitt das Schlüsselbund aus ihrer Hand lärmend auf den Teller und weckte sie. Dieser Sekundenschlaf hatte gerade jene Dauer, die nicht depressiv stimmt. Diese Folie zeigt Politiker, unter ihnen Altkanzler Kohl, wie sie vom Sekundenschlaf profitieren.
Ich schließe mit einer Zusammenfassung. Unsere Lebensgewohnheiten, wachen, schlafen, essen, lieben usw. bedingen unsere Gefühle und unsere Gefühle wiederum sind abhängig von einem chemischen Gleichgewicht der Neurotransmitter – unter ihnen Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, Gamma-Amino-Buttersäure . Diese können wir durch unsere Lebensweise beeinflussen. Jene Gleichgewichte können durch Krankheit gestört sein. Durch Medikamente lassen sie sich korrigieren. Durch Drogen werden diese Gleichgewichte verschoben. Drogen verändern das Gehirn und damit die Persönlichkeit; das meine Damen und Herren, brauche ich nicht näher zu erklären, ist ein Irrweg.
Das wa’s für Block7, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
________________________________________________
Block8: Sinne (I) Chemorezeption
Geruchssinn (Insekten, Säuger), Geschmackssinn (Mensch); Rezeptor-Spezialisten/-Generalisten, Reiz/Erregungs-Transduktionen, Signalkaskaden
_______________________________________________
vgl. Abbildungen Block 8
Fragen zu Block 8:
• Was ist Sinnesphysiologie? Worin unterscheiden sich Geruchs -und Geschmackssinn?
• Wo befinden sich Duft-Rezeptoren bei Insekten?
• Wie lassen sich die Duft-Antworten von Duft-Rezeptoren messen?
• Wie sieht die Versuchsanordnung für solche Messungen aus?
• Was macht Düfte so spezifisch? Ein Beispiel aus dem Reich der Insekten
• Geruchssinn der Insekten: Gibt es spezifische Duft-Detektoren?
• Zwei Hauptgruppen von Duft-Rezeptoren: Was unterscheidet Duft-Spezialisten von Duft-Generalisten?
• Pheromonwirkungen bei Insekten: Wie erkennen sich die Geschlechtspartner und worauf kann Artentrennung beruhen?
• Wie ist die Riechschleimhaut der Säuger aufgebaut?
• Wie wird Duft in Erregung umgesetzt?
• Reiz/Erregungs-Transduktion: Wie wird die hohe Empfindlichkeit bei der Duftrezeption erreicht?
• Welche Signaltransduktionen führen bei der Duftrezeption zur Steuerung der Ionenkanäle, und welche Prozesse führen zu deren Inaktivierung?
• Worauf könnte es beruhen, dass manche Menschen sich sprichwörtlich "nicht riechen können"?
• Geschmackssinn des Menschen: Worauf beruhen die Geschmacksempfindungen "salzig", "sauer", "süß", "bitter", "fleischig" ?
• Was macht Tütensuppen und Hot-Dogs so schmackhaft?
.
Meine Damen und Herren,
mit den Blöcken8, 9 und 10 betreten wir in dieser Vorlesungsreihe einen neuen Themenkreis: die Sinnesphysiologie. Sinneszellen haben als neurogene Zellen mit Neuronen wesentliche Eigenschaften gemeinsam. Das besondere an ihnen sind Reiz-Rezeptoren, mit denen sie, je nach Sinneszelltyp, verschiedene physikalisch/chemische Veränderungen der Umwelt bzw. der Innenwelt als Reize aufnehmen, in der Zelle umsetzen und in Form von bestimmten Signalen weiter geben.
Bezüglich der Sinneszelltypen unterscheiden wir primäre Sinneszellen – die ein Axon besitzen – von sekundären Sinneszellen, die kein Axon besitzen. Bezüglich der Sinne unterscheiden wir Sinnes-Modalitäten – z.B. akustisch, optisch, chemisch – und innerhalb einer Sinnes-Modalität, z.B. optisch, unterscheiden wir Reiz-Qualitäten, z.B. Farbe, und Reiz-Quantitäten, z.B. Helligkeit.
Diese Folie gibt einen Überblick über Sinnesmodalitäten ausgehend von der Chemorezeption bis hin zur Magnetfeldrezeption, und die nächste Folie orientiert über die in den kommenden drei Vorlesungsblöcken zu behandelnden Themen.
Zum Menü des heutigen Block8: Chemorezeption. Wir werden uns mit dem Geruchssinn der Insekten und Säuger sowie dem Geschmackssinn des Menschen beschäftigen. In diesem Zusammenhang wollen wir Rezeptor-Generalisten und Rezeptor-Spezialisten kennen lernen. Grundlegende Fragen betreffen die Reiz/Erregungs-Transduktionen; darunter verstehen wir jene Prozesse, die sich zwischen einem Reiz und der Antwort der zugeordneten Sinneszelle abspielen. In diesem Zusammenhang werden wir die Bedeutung von Signalkaskaden beleuchten, die für die hohe Reizempfindlichkeit von Sinneszellen verantwortlich sind.
Beginnen wir mit der einfachen Frage: worin unterscheiden sich Geruchs- und Geschmackssinn? Es gibt folgende Unterscheidungskriterien: Entfernung der Reizquelle, Wasser/Fett-Löslichkeit der Reizstoffe, Nah/Fern-Information, Funktion für das Verhalten, Zusatzinformation. Die Lokalisation des Geschmackssinns und des Geruchssinns ist bei Insekten und Wirbeltieren unterschiedlich: Riechhaare (Insekten), Riechschleimhaut (Wirbeltiere); Schmeckhaare/-borsten (Insekten); Geschmacksknospen (Wirbeltiere). Lediglich die Geschmacksknospen enthalten sekundäre Sinneszellen.
Wenden wir uns zunächst dem Geruchssinn der Insekten zu. Insekten nehmen Düfte gewöhnlich mit Hilfe bestimmter Haare wahr, den Riechhaaren. Sie enthalten primäre Sinneszellen. Riechhaare befinden sich meist auf den Antennen. Die Folie zeigt hier ein schönes Beispiel für eine Antenne beim Seidenspinner Bombyx mori und dort ein weniger imposantes Beispiel bei der Wanderheuschrecke Schistocerca gregaria. Riechhaare können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Formal lassen sie sich vom Sensillum trichodeum ableiten. Solch ein langes Haar besteht aus einer Chitin-Cuticula. Beim Sensillum basiconicum handelt es sich um die gestauchte Version. Von dieser ausgehend müssen wir uns vorstellen, dass die seitliche Cuticula um das Haar herum eine Art Grube mit einer Öffnung bildet, und fertig ist das Sensillum coeloconicum. Alle drei Riechhaar-Typen finden wir ausgebildet beim Augenspinner Antheraea polyphemus. Nun werden Sie sich fragen, wie der Duft durch die Cuticula zu den Rezeptoren der Riechzellen gelangt. Ganz einfach, die Cuticula ist durch ein porentubuläres System systematisch – von Röhren durchsetzt – perforiert. Duftstoffe diffundieren über die Poren durch die Kanäle der Cuticula zu den Rezeptoren der Sinneszell-Dendriten, docken dort an und lösen eine Signalkaskade aus, die zur Veränderung des Ruhepotenzials der Riechzelle führt, dem Rezeptorpotenzial.
Wie kann man die Duft-Antworten von Riechzellen messen, und wie sieht eine entsprechende Versuchsanordnung aus? Zunächst einmal kann man die Summe der Antworten aller Riechhaare und ihrer Riechzellen insgesamt messen und zwar als Summenpotential. Es handelt sich dabei um die summierten Rezeptorpotenziale, genannt Elektro-Antenno-Gramm, EAG; dieses wird mit Hilfe von zwei Elektroden abgegriffen, d.h. abgeleitet, und auf einem Oszilloskop aufgezeichnet. Der Duft wird in einem Luftstrom mit Hilfe einer Kanüle appliziert. Thermistoren erlauben eine Messung der Geschwindigkeit des Duftstroms: ein Thermistor ist ein Temperatur-Sensor, dessen Widerstand sich in Abhängigkeit von der Temperatur – und damit abhängig von der Duftstrom-Geschwindigkeit – ändert. Um die Antworten von einzelnen Riechzellen zu erfassen, stülpt man eine zu einer feinen Öffnung ausgezogene Mikrokapillare über ein einzelnes Riechhaar, oder sticht sie (entsprechend dünn ausgezogen) in eine Pore des Riechhaars. Auf diese Art und Weise lassen sich Rezeptorpotenziale einzelner Riechzellen sowie ihre Aktionspotenziale extrazellulär ableiten. Jetzt werden Sie fragen, warum Aktionspotentiale? An den Membranen von Dendriten entstehen doch keine APs. Das ist wohl richtig. Aber am Axonhügel der primären Sinneszellen entstehen – durch das Rezeptorpotenzial generiert – APs, die sich anterograd in Richtung ZNS ausbreiten; die Dendritenmembran leitet APs, die sich vom Axonhügel retrograd ausbreiten.
Betrachten wir die Versuchsanordnung in einem Schema. Dies ist ein Riechhaar der Wanderheuschrecke; das Sensillum besteht aus zwei bis mehreren primären Sinneszellen=Riechzellen, auch Gras-Rezeptoren genannt, denn jene Zellen antworten bevorzugt auf den Duft von frischem Gras. Mit Hilfe einer Mikrokapillare können Rezeptor- bzw. Aktionspotenziale gegen Erde abgeleitet werden, sobald die Dendriten beduftet werden. Ich hatte die Frage vorhin schon angeschnitten: wie kommt der Duft zu den Dendriten? Hier ist ein vergrößerter Ausschnitt aus der Cuticula-Wand des Riechhaars. Der Duftstoff tritt durch die Pore in das sich aufgabelnde Röhrensystem und von dort zu den Rezeptoren eines Dendriten. Jetzt wollen wir uns das Ganze in einem histologischen Schnittpräparat anschauen: sie sehen, das Schema deckt sich mit der Wirklichkeit weitgehend.
Jetzt prüfen wir die Antworten eines Gras-Rezeptors auf drei verschiedene (chemisch reine) Duftmoleküle: Hexenal, Hexan und Nelkenöl. Nach der Applikation von Hexenal erhöht sich die Ruheaktivität des Rezeptors, nach Hexan bleibt sie unverändert und nach Nelkenöl setzt die Ruheaktivität aus. Gras-Rezeptoren besitzen somit die Fähigkeit, Düfte nach einem ternären Plus(Erregung)/Minus(Hemmung)/Null(kein Einfluss) Code zu verschlüsseln. „Plus“ bedeutet in diesem Falle ein verhaltensrelevantes Signal, nämlich die in frischem Gras enthaltene Komponente Hexenal. Gras-Rezeptoren helfen der Heuschrecke, Gras olfaktorisch zu erkennen.
Damit verbunden ist die Frage: was macht Duftstoffe für den Gras-Rezeptor spezifisch? Prüfen wir zunächst einmal, welche wirksamen Moleküle in frischem Gras enthalten sind: Hexanol, Hexenol, Hexenal und Hexensäure. Es sind alles C6-Kohlenwasserstoffe. Wir greifen das Hexenol heraus und variieren jetzt die Kettenlänge von C4 bis C10. In der Tat, der C6-Körper wirkt maximal. Betrachten wir nun die funktionelle Gruppe, den C-Terminus. Mit dem ungesättigten Charakter des Kohlenwasserstoffs und dem Oxidationsgrad des C-Terminus (ausgehend von Hydroxigruppe) steigt die Wirksamkeit des Moleküls. Stünde eine Aminogruppe anstelle der Hydroxigruppe, so würde die Wirksamkeit des Moleküls erlöschen.
Mit den Augen eines Ethologen gesehen, handelt es sich hierbei um ein schönes Beispiel für Schlüsselreize – besser: Signalreize – aus dem Bereich der Chemorezeption. „Schlüssel“ bzw. „Signal“ stehen für verschiedene Wirksamkeits-Kriterien, die in Kombination effektiv sind: C-Kettenlänge, C=C-Doppelbindung, C-Terminus.
Damit stellt sich die Frage nach Duft-Detektoren für verhaltensrelevante Signalreize. Wie die Tabelle von zwei verschiedenen Nahrungsspezialisten zeigt, gibt es diese offensichtlich. Schmeißfliegen Calliphora vicina besitzen Aas-Rezeptoren, die auf Aas und auf das in ihm enthaltene Mercaptan bevorzugt antworten, während Wanderheuschrecken Locusta migratoria Gras-Rezeptoren besitzen, die auf Gras und auf das in ihm enthaltene Hexenol und Hexenal bevorzugt antworten. Überschneidungen zwischen diesen beiden Präferenzen gibt es nicht.
Neurophysiologische Untersuchungen zeigten, dass es unter den Duft-Rezeptoren der Wanderheuschrecke sowohl Rezeptor-Spezialisten als auch Rezeptor-Generalisten gibt. Unter den Spezialisten, z.B. Gras-Rezeptoren, zeigen auf eine Auswahl verschiedener Duftstoffe alle Vertreter dasselbe Antwortspektrum, wobei die Spezialität, z.B. Hexenol, am stärksten beantwortet wird. Aus ethologischer Sicht sind Rezeptor-Spezialisten wichtige Komponenten eines (angeborenen)Auslösemechanismus.
Demgegenüber zeigen verschiedene Vertreter der Rezeptor-Generalisten auf eine Auswahl verschiedener Duftstoffe alle ein unterschiedliches Antwortspektrum. Es wird vermutet, dass die Generalisten für das Erlernen neuer Düfte eine wichtige Funktion erfüllen.
Bleiben wir bei den Rezeptor-Spezialisten und widmen uns der Artenerkennung mit Hilfe von Pheromonen. Viele Insekten orientieren sich durch Aussendung von Pheromonen, vor allem zur Paarung, aber auch zwecks Artentrennung. Lassen Sie uns dies am Beispiel verschiedener Insekten näher beleuchten. Wir beginnen mit dem Seidenspinner Bombyx mori. Die Weibchen senden einen spezifischen Lockstoff aus, das Sexualpheromon Bombykol. Das Männchen besitzt Rezeptor-Spezialisten – Bombykol-Rezeptoren B-R –, die vor allem auf Bombykol reagieren und die Information an weitere Interneurone IN weiterleiten, die der Pheromon-Erkennung dienen. Die Empfindlichkeitsschwelle der Bombyx-Männchen für Bombykol ist extrem hoch. Man hat herausgefunden, dass ein Molekül Bombykol in einer Rezeptorzelle des Männchens, die für den Lockstoff spezialisiert ist, ein Aktionspotenzial auslöst: das bedeutet eine Eintrefferreaktion. Das ist fast unglaublich und mit der Frage verbunden, welche Verstärkungsmechanismen es in der Riechzelle gibt, die es ermöglichen, dass ein Duftmoleküle ein Aktionspotenzial auslöst. Wir kommen darauf später noch zu sprechen. Fraglos, dieses eine Aktionspotenzial löst noch keine Verhaltensreaktion aus, sondern ganze 40 Molekültreffer pro Sekunde auf 40 der 40.000 Bombykol-Rezeptoren signalisieren dem Seidenspinnermann in der Windrichtung sitzt ein Weibchen, und jenes kleine molekulare Bombardement löst dann die Wanderung des Spinnenmännchens zum Spinnerweibchen aus.
Während der Seidenspinner Bombyx mori sich mit einem Lockstoff-Typ, nämlich Bombykol, „zufrieden“ gibt, um sein Weibchen zu erkennen und aufzusuchen, braucht der Obstbaumroller Archips argyrospilus eine Kombination von zwei verschiedenen Diastereoisomeren des Lockstoffmoleküls 11-Tetradecenylacetat, und zwar die Z- und E-Form in bestimmter Konzentration. Die verschiedenen Nordamerikanischen Arten Archips spec können sich sogar an diesem Mischungsverhältnis unterscheiden: [Z]60:[E]40 steht für den Duft von Archips argyrospilus, während z.B. [Z]17:[E]83 Archips cerasivoranus signalisiert. Die Z- und E-Signale werden in den betreffenden Intensitäten von entsprechend spezialisierten Rezeptoren [Z]11T-R bzw. [E]11T-R erfasst und an Neurone weitergeleitet, die nur auf die Kombination der beiden Signaleingänge zu [Z] und [E], dem spezifischen Mischungsverhältnis entsprechend, reagieren.
Eine andere Möglichkeit, zu verhindern, dass sich Weibchen mit Männchen einer anderen Art paaren, besteht in der Aussendung interspezifischer Inhibitoren, wie sie z.B. den männlichen Schwammspinner Lymantria dispar von der Nonne Lymantria monacha fernhalten. Die Weibchen der Nonne und des Schwammspinners senden beide den Lockstoff [+]-Disparlure aus, für den die Männchen beider Arten Rezeptorspezialisten [+]-R besitzen. Das Nonnenweibchen sendet gleichzeitig noch [-]-Disparlure aus – im Verhältnis [+]10:[-]90 – auf das die [-]-R Rezeptorspezialisten des Schwammspinnermännchens ansprechen, jedoch dessen Verhaltensantwort auf [+]-Disparlure hemmen. Das Nonnenmännchen besitzt keine [-]-R Rezeptorspezialisten.
Betrachtet man dieses Prinzip der Artentrennung könnte man einwenden, dass es nur in einer Richtung wirkt, nämlich Schwammspinnermännchen davon abzuhalten, Nonnenweibchen aufzusuchen. Warum aber paaren sich Nonnenmännchen nicht mit Schwammspinnerweibchen? Vermutlich sind letztere für sie unattraktiv, weil sie einfach zu stark nach [+]-Disparlure riechen, nämlich etwa 10fach stärker als ihre Weibchen.
Wir kommen jetzt zum Geruchssinn der Wirbeltiere, speziell der Säuger, und fragen uns zunächst wie die Riechschleimhaut aufgebaut ist. Vieles kennen Sie vermutlich noch aus ihrer Schulzeit. Ich fasse mich daher kurz. In der Riechschleimhaut unterscheiden wir verschiedene Zelltypen: Rezeptorzellen, Stützzellen und Basalzellen. Wir beginnen mit den Rezeptorzellen; es sind primäre Sinneszellen bestehend aus einem Soma und einer dicken dendritischen Struktur, an der sich sog. Mikrovilli und Cilien befinden, die die Duftrezeptoren tragen. Die Cilien halten den Schleim der Riechschleimhaut etwas in Bewegung, so dass eintreffende Duftstoffmoleküle mit den Rezeptoren leichter in Kontakt treten können.
Ich habe hier für Sie einen Ausschnitt aus einer Cilie mit einem Rezeptor stark vergrößert herausgezeichnet. Bei diesen Rezeptoren handelt es sich um G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Das Rezeptormolekül selbst, ein sog. Antennenmolekül, besteht aus einer Polypeptidkette, die die Außenmembran genau siebenmal durchquert und daher 7-Transmembran-Domäne (7 TDM) heißt. Ein Abschnitt der Polypepdidkette, nahe der terminalen Carboboxi-Gruppe, steht dem G-Protein zwecks Interaktion zur Verfügung.
Ein paar Zahlen: die Regio olfactoria des Menschen verfügt über ca. 3 Mio Sinneszellen. Die Lebensdauer einer Riechzelle beträgt jedoch nur etwa 30 Tage. Nachschub kommt von den Basalzellen, die sich als Vorläuferzellen zu Riechzellen differenzieren: der dendritische Fortsatz in Richtung Riechschleimhaut und der axonische Fortsatz – im Nervus olfactorius verlaufend – in Richtung Gehirn. Damit stellt sich die Frage, wie die uns bereits bekannte axonale „Spürnase“ ihre nachgeschalteten Neurone im Bulbus olfactorius des Vorderhirns findet. Einiges hierüber haben wir ja bereits in Block1 kennen gelernt. Die adulte Neurogenese von olfactorischen Sinnesnervenzellen ist seit langem bekannt. Weiterhin ist von Interesse, dass es ca. 1000 Geruchsrezeptor-Typen gibt, verglichen mit nur 4 Photorezeptor-Typen der Retina. Das erklärt, dass die Geruchsrezeption unter allen Sinnesmodalitäten am aufwendigsten am Genpool partizipiert. Das könnte bedeuten, dass ein beträchtliches Ausmaß der Geruchserkennung bereits in der Peripherie, nämlich in der Riechschleimhaut, stattfindet. Der Geruch spielt natürlich bei Säugern eine sehr große Rolle; dennoch, wenn ich tauschen müsste, würde ich lieber sehen als riechen können. Mäuse und Ratten würden sich vermutlich anders entscheiden. Phylogenetisch betrachtet ist der Geruchssinn eine archaische Grundsinnesmodalität.
Wenden wir uns jetzt der Frage zu, wie Duft in Erregung umgesetzt wird. Betrachten wir dazu jenes Blockschema:
(1) Ein Duftmolekül dockt an einen Geruchsrezeptor 7TDM an.
(2) Sodann findet über molekulare Transduktionen eine Signalverstärkung statt im Verhältnis 1:1000 bis 1:2000. Dies ermöglicht Hunden, Düfte in geringsten Konzentrationen wahrzunehmen: ihre Riechschwelle für Buttersäure liegt bei 1000 Molekülen pro cm3, entsprechend einer Konzentration von 1,7x10-16 mol pro Liter. Eine derart geringe Konzentration könnte heutzutage nur mit hohem technischem Aufwand gemessen werden.
(3) Auf diese Art und Weise ist es möglich, dass ein Duftstoffmolekül zur Öffnung von Kationenkanälen und zur Bildung eines Rezeptorpotenzials führt. Dieses generiert als Generatorpotential am Axonhügel ein Aktionspotenzial, das sich längs des Axon im Riechnerv zum Gehirn ausbreitet.
Kommen wir zur Frage der Signal-Transduktion, genauer der Reiz-Erregungs-Transduktion, die für fruchtige und faulige Duftstoffe unterschiedlich zu verlaufen scheint. Die folgenden Schemata zeigen einige uns bereits bekannte molekulare Bausteine: Duftstoff (fruchtig) dockt an den Rezeptor an und löst über G und AC die Bildung von cAMP aus, das seinerseits Na+ Kanäle öffnet. Für faulige Düfte gibt es wohl einen anderen Weg, bei dem das G-Protein als Adressaten PLC hat, das die Bildung von IP3 vermittelt, das seinerseits Kationenkanäle (z.B. für Ca2+ Ionen) reguliert.
Wir wollen jetzt auf das Kaskadenprinzip der Signalverstärkung näher eingehen. Hierbei ist es möglich, dass ein Duftstoffmolekül nach Bindung an den Rezeptor mehrere G-Proteine aktiviert, von denen jedes G-Protein mehrere AC Moleküle aktiviert, von denen wiederum jedes AC Molekül die Bildung mehrerer cAMP Moleküle vermittelt: ein Duftstoffmolekül löst die Bildung von bis zu 2000 cAMP Molekülen aus.
Das wäre eine chemische Signal-Verstärkung. Lassen Sie uns diese mit einer neuronalen Signal-Vervielfachung vergleichen: ein Neuron kann ein am Axonhügel generiertes Aktionspotenzial durch starke Verzweigung seines Axons (Diverzenz) immens vervielfachen.
Wir verlassen dieses Thema und wenden uns jetzt der Inaktivierung der Duftrezeption zu. Etwas Vergleichbares kennen wir ja schon von den Synapsen: nachdem der Neurotransmitter an der postsynaptischen Membran gewirkt hat, wird er entweder enzymatisch zerlegt oder als Ganzes zurück durch die präsynaptische Membran in den vorgeschalteten Axonendknoten transportiert. Was geschieht mit den Duftmolekülen? Wir gewöhnen uns relativ schnell an einen Duft, zum Beispiel an unseren eigenen Schweiß im Fitness-Studio; den Schweiß des trainierenden Nachbarn nehmen wir aber sofort wahr. Worauf beruht die Geruchs-Adaptation? Zum Teil ist sie auf Inaktivierungsreaktionen in der Signalkaskade zurückzuführen:
- Nachdem cAMP den Ionenkanal reguliert hat, aktiviert cAMP die PKA, die ihrerseits den Geruchs-Rezeptor inaktiviert.
- Aus dem Endoplasmatischen Reticulum ER treten Hydrolasen aus, die den Duftstoff zerlegen.
- Phosphodiesterase PDE tritt in Aktion und inaktiviert cAMP, wodurch sicher gestellt ist, dass Ionenkanäle nicht mehr offen gehalten werden.
Im Anschluss daran werden die Rezeptoren neu gebildet, das geht relativ schnell, und neue Duftstoffe können wieder wahrgenommen werden.
Das soeben behandelte Thema leitet zu einem interessanten Phänomen über verbunden mit der Frage, woran es liegen kann, dass bestimmte Menschen sich offenbar nicht „riechen“ können. Manche Leute mag man gleich bei der ersten Begegnung, andere dagegen überhaupt nicht: mit den einen „stimmt die Chemie“, mit den anderen stimmt sie nicht. Bevor wir auf mögliche Ursachen zu sprechen kommen, wollen wir uns mit Untersuchungen an Mäusen beschäftigen. Mäuse oder Ratten leben in Kolonien z.T. in großer Populationsdichte. Somit besteht das Problem der Inzucht. Äußerlich, etwa an Gesichtszügen, Haartracht oder Schnurrbart, können sie ihre Verwandten kaum persönlich kennen. Woran erkennen sie also einen genetisch geeigneten Geschlechtspartner? Sie riechen das. Um das zu verstehen, betrachten wir den Hauptgewebe-Veträglichkeits-Komplex MHC (major histocompatibility complex). Dessen Aufgabe besteht darin, dem Organismus zu ermöglichen, zwischen eigenen und fremden Zellen zu unterscheiden; darauf stützt sich seine Immunabwehr. Bei der Maus befindet sich der MHC in der H-2 Region auf Chromosom 17 und verleiht persönlichen Zellen ihre immunologische Schutzmarke. Interessanterweise codiert dieselbe Region die persönliche Duftmarke, d.h. eine spezifische Komposition bestehend aus: Schweiß, Urin und dergleichen.
Da die individuelle Duftmarke einer Maus „genetisch codiert“ ist, kann ein interessierter sexueller Partner anhand ihres Duftes beurteilen, inwieweit zwischen ihm und ihr ausreichende genetische Ähnlichkeiten oder Unterschiede vorliegen. Das erfordert zweifellos einen nicht unerheblichen Aufwand an geruchlichen Sinnesleistungen und erklärt, warum die Geruchsrezeption der Säuger von allen Sinnesmodalitäten am aufwendigsten genetisch codiert wird. Übrigens konnte man mit Hilfe von Knochenmarks-Transplantationen bei Mäusen zeigen, dass vom Spender nicht nur die immunologische Schutzmarke, sondern auch die persönliche Duftmarke auf den Empfänger übertragen wurde. Schauen wir uns zum Abschluss einen kurzen Video-Clip an.
Zurück zur „Chemie des Menschen“. Klappt das mit der persönlichen Duftmarke bei uns genauso wie bei Mäusen? Man hat in einem Großversuch 43 männliche Studenten zwei Tage und zwei Nächte dasselbe T-Shirt tragen lassen (ohne es zu waschen). Diese getragenen T-Shirts, die durch Nummern ihren Trägern zugeordnet werden konnten, wurden Studentinnen zwecks Duftprobe überreicht mit der Bitte, zu entscheiden, welche T-Shirts ihnen vom Duft her sympathisch oder unsympathisch waren. Von den männlichen und weiblichen Studierenden wurden die MHC ermittelt; bei uns ist für die immunologische Schutzmarke die HLA Region auf Chromosom 6 zuständig. Ergebnis: Studentinnen fanden den Duft der T-Shirts jener Studenten am sympathischsten, deren MHC von ihrem eigenen MHC am meisten abwich, und umgekehrt. Das funktionierte allerdings nur außerhalb der Menstruationsperiode, was hormonelle Einflüsse auf die olfaktorische Unterscheidungs- und Zuordnungsfähigkeit (im vorliegenden Zusammenhang) vermuten lässt.
Schlagen wir jetzt das letzte Kapitel der Chemorezeption auf und kommen zum Geschmackssinn des Menschen. Für Geschmacksempfindungen ist vor allem die Oberfläche der Zunge zuständig. Dort befinden sich verschiedene Typen von Papillen:
- Fadenpapillen, Papillae filiformes
- Pilzpapillen, Papillae fungiformis
- Blattpapillen, Papillae foliatae
- Wallpapillen, Papillae vallatae
Von diesen sind die Wallpapillen mit den eigentlichen Geschmacksknospen ausgestattet: becherförmige Organe voll stabförmiger sekundärer Sinneszellen (Schmeckzellen), die mit den Dentriten der Geschmacksnerven in synaptischem Kontakt stehen. Die Geschmacksknospen des vorderen Zungenbereichs werden von einem Ast des VII. Hirnnerven (Nervus facialis) und die des hinteren Zungenbereichs vom IX. Hirnnerv (Nervus glossopharyngeus) innerviert. Die Lebensdauer einer Schmeckzelle beträgt nur 5-20 Stunden. Nachschub erfolgt durch Vorläuferzellen, den Basalzellen. Insgesamt besitzen wir 7000-9000 Geschmacksknospen.
Die vier unterschiedlichen Reizqualitäten für die Haupt-Geschmacksempfindungen sind auf der Zungenoberfläche zum Teil überlappend vertreten: süß:distal; bitter:proximal; salzig:lateroproximal; sauer:lateral. Wie kommen diese Empfindungen zustande?
salzig – Für die Empfindung „salzig“ sind vor allem Na+ Ionen verantwortlich. Grundelement der Zellmembran ist ein offener Na+ Kanal. Erhöht sich außerhalb der Schmeckzelle die Na+ Konzentration, so strömen Na+ Ionen ein, die Membran wird depolarisiert und antwortet mit Aktionspotentialen, die ihrerseits spannungsgesteuerte Ca2+ Kanäle öffnen; Ca2+ Ionen strömen im Austausch gegen Mg2+ Ionen in die Zelle und geben den Vesikeln das Signal zur Exozytose.
sauer – Die Empfindung „sauer“ wird vor allem durch H+ Ionen bestimmt. Grundelement der Zellmembran ist ein Protonen-Rezeptor gesteuerter offener K+ Kanal. Das Andocken von H+ Ionen an die Protonen-Rezeptoren führt zur Schließung der K+ Kanäle; die resultierende Membran-Depolarisation löst Aktionspotentiale aus, die wiederum über Ca2+ Einstrom die Vesikel zur Exozytose veranlassen.
süß – An der die Empfindung „süß“ sind vor allem Hydroxigruppen –OH beteiligt. Der Weg, der zur Empfindung führt, ist kompliziert, er enthält jedoch chemische Bausteine, die wir bereits kennen. Grundelement der Zellmembran ist ein G-Protein gekoppelter Hydroxigruppen-Rezeptor. Adressat des G-Proteins ist AC, die über cAMP die Bildung von PKA vermittelt, welche ihrerseits zur Schließung von K+ Kanälen führt; die resultierende Membran-Depolarisation löst Aktionspotentiale aus, die wiederum über Ca2+ Einstrom die Vesikel zur Exozytose veranlassen.
bitter – Für die Empfindung „bitter“ sind verschiedene funktionelle Gruppen zuständig, wie –S-S– , >C=S, –N-C=S . Der Weg zur Empfindung „bitter“ ist ebenso kompliziert, enthält jedoch chemische Bausteine, die wir ebenfalls kennen. Interessant ist die Tatsache, dass hier keine Ionenkanäle und keine Membranpotenzial-Änderungen involviert sind. Grundelement der Zellmembran ist ein G-Protein gekoppelter Rezeptor. Adressat des G-Proteins ist PLC, die über IP3 aus dem Endoplasmatischen Reticulum (ER) Ca2+ Ionen (im Austausch gegen Mg2+ Ionen) in das Zytoplasma strömen lässt, welche ihrerseits die Vesikel zur Exozytose veranlassen.
Es gibt unter Menschen eine genetisch bedingte selektive Geschmacksblindheit für Verbindungen mit –N-C=S Gruppen. Dies betrifft z.B. Phenylthiocarbamid (PTC), das von den betroffenen Personen – im Gegensatz zum Chinin – nicht der Qualität „bitter“ zugeordnet wird.
umami – Es scheint wohl noch eine 5. Reizqualität zu geben, verbunden mit der Frage: was macht Nahrung schmackhaft? Lassen Sie uns kurz auf die Geschichte eingehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte ein japanischer Geschmacksforscher die Geschmacksrichtung „umami“. Das steht im Japanischen für „Köstlichkeit“ und beschreibt das vom Geschmacksverstärker Glutamat vermittelte Geschmacksempfinden, insbesondere für eiweißhaltige Nahrung. Die umami-Empfindung könnte demnach der Proteinaufnahme dienen. Milchfette, Butte, Sahne wirken aufgrund ihres Glutamatgehalts als Geschmacksverstärker. Beim Mechanismus der Rezeption scheint es sich um eine cAMP vermittelte Signalkaskade (wie bei der Geschmacksempfindung „süß“) zu handeln, allerdings mit anderen Rezeptoren.
Das wa’s für Block8, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
_________________________________________________________
Block9: Sinne (II), Photorezeption
Linsenauge Säuger, Bau, Entwicklung; Reiz/Erregungs-Transduktion; Kodierung von Reizparametern, on/off Antworten, Laterale Inhibition; Optik; zentrales Visuelles System
_______________________________________________
vgl. Abbildungen Block 9
Fragen zu Block 9:
• Wie ist das Linsenauge der Vertebraten aufgebaut?
• Warum würde ein Ingenieur einen optischen Prozessor anders bauen?
• Entwicklung des Wirbeltier-Auges: Warum muss das Licht die Neuronenschichten der Retina erst durchdringen, um die Fotorezeptoren zu erreichen?
• Licht-gesteuerte Ionenkanäle: Wie lösen Lichtreize neuronale Aktivität aus?
• Welches sind die fotochemischen Primärreaktionen?
• Welche fotochemischen Folgereaktionen induziert Licht?
• Welchen Verstärkungseffekt hat die Foto-Signalkaskade?
• Perzeptive Einheiten der Retina: Aus welcher Neuronenschaltung resultiert das visuelle rezeptive Feld einer Ganglienzelle? Größe, Bewegung, Bewegungsrichtung, Orientierung eines Objekts: Wie detektieren retinale Ganglienzellen visuelle Reizparameter?
• Sehen Sie "grau" wo kein "grau" ist?
• Wie reagieren on-bzw. off-Zentrum-Neurone auf optische on-bzw. off-Reize?
• Laterale Inhibition als Erklärung: Wie kommen die "virtuellen" grauen Streifen zustande?
• Wo liegen im Gehirn des Menschen die Verarbeitungszentren für Sehen, Hören, Tasten, Sich-Bewegen, Sprechen?
• Werden auch beim Sich-Vorstellen eines Bildes die Sehzentren aktiv?
• Werden auch beim Sich-Vorstellen einer Körperbewegung die Bewegungszentern aktiv?
• Wo und wie wird das binokulare Gesichtsfeld des Menschen im Gehirn abgebildet?
• Parallele, stufenweise Verarbeitung von visueller Information im Primatengehirn: Gibt es getrennte Verarbeitungswege für "wo" und "was"?
• Was versteht man unter Re-Mapping und sensiorischer Substitution? Regelt im zerebralen Cortex die Nachfrage das Angebot an neuraler Struktur?
.
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie zu Block 9: Sinnesphysiologie II, Photorezeption. Einiges hierzu werden Sie aus Ihrer Schulzeit kennen. Dort werde ich mich entsprechend kurz fassen, um dann in speziellen Bereichen Akzente zu setzen.
Zunächst zum Menü von Block9. Wir beginnen mit dem Linsenauge der Säugetiere, das uns bezüglich Bau und Funktion aus nahe liegenden Gründen am nächsten liegt. Grundbauplan und Entwicklung sind bei Wirbeltieren gleich, vom Fisch bis zum Menschen. Schließlich kommen wir auf die Reiz/Erregungs-Transformation zu sprechen und damit zur Frage, wie die Lichtsteuerung von Ionenkanälen funktioniert. Dann werden wir fragen, wie die verschiedenen Reizparameter — Licht-an/-aus, Größe eines Objekts, dessen Bewegung und Bewegungsrichtung, Farbe und Kontrast — durch die Netzhaut=Retina vorverarbeitet und im Gehirn zu Wahrnehmungen weiterverarbeitet werden.
Lassen Sie mich das Thema Photorezeption mit einem Video-Clip einführen. Dieser Film ist insofern etwas provokativ, weil er zeigt, wie und was Tiere sehen können, wo es eigentlich kaum etwas zu sehen gibt, nämlich in der Tiefsee. Um sich in einer nahezu dunklen Umwelt zu behaupten, hätten Tiefseetiere eigentlich andere Sinnesorgane einsetzen sollen, wie z.B. Strömungssinn und Sonar. Ihr „optischer Trick“, sich dennoch des Gesichtssinns zu bedienen, scheint vor allem darin zu bestehen, andere Tiere zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden und daraus Überlebensstrategien zu entwickeln. Einige Tiere sind durchsichtig, oder sie besitzen Rotlichtscheinwerfer (Photophoren), die andere nicht sehen können, oder sie besitzen Augen mit Restlichtverstärkung, oder sie verspritzen explosive Flüssigkeit mit verzögerter Bioluminiszenz, um Feinden einen Ort vorzutäuschen, an dem sie sich nicht mehr befinden, oder sie angeln mit bioluminizierenden Körperanhängen als Beuteattrappen.
Nachdem wir einen kleinen Einblick gewonnen haben über Besonderheiten der Photorezeption, wollen wir uns dem eher Alltäglichen zuwenden und beginnen mit dem Wirbeltierauge. Diese Folie zeigt den Aufbau, den Sie aus jedem Lehrbuch kennen. Wir fassen uns kurz. Augapfel teilweise eingehüllt in funktionell unterschiedliche Schichten, von außen nach innen: Lederhaut für den mechanischen Schutz, Aderhaut für die Durchblutung, Pigmentschicht für die optische Abschirmung der Netzhaut, Netzhaut für die Informations-Aufnahme -und Vorverarbeitung, Regenbogenhaut für die Regulierung des Lichteinfalls, Hornhaut als transparentes Fenster zur Außenwelt, Linse für die Scharfeinstellung und die Nah/Fern-Akkommodation.
Bleiben wir bei der Netzhaut, bestehend aus Photorezeptoren (1 Typ Stäbchen und 3 Typen Zapfen), Bipolarzellen, Horizontalzellen, Amakrine Zellen, und Ganglienzellen; Gelber Fleck=Fovea centralis als Bereich des schärfsten Sehens; Blinder Fleck als Austrittsstelle des Serhnerv=Nervus opticus. Das Wirbeltier-Linsenauge ist demnach invers gebaut, was bedeutet, dass das Licht zunächst die Informations-verarbeitenden Zellschichten durchdringen muss, um zu den Photorezeptoren zu gelangen. Das ist, auf den ersten Blick, eine Kuriosität, denn kein Ingenieur käme auf die Idee, solch einen Bild-verarbeitenden Photoapparat zu bauen. Er würde folgende Anordnung wählen
Lichtquelle —> Photosensor —> Prozessor (Computer) —>
die im eversen Auge des Tintenfischs verwirklicht ist. Bestimmt nicht würde er die Anordnung des inversen Wirbeltierauges wählen, in dem der Lichtstrahl zunächst den Prozessor (Neuronenschicht) durchdringen muss, um zu den Photosensoren (Rezeptoren) zu gelangen, die ihre Signale sodann an den Prozessor weitergeben, dessen Ausgangskabel (Sehnerv) dann den Prozessor und die Photosensoren durchqueren muss, um schließlich zum Hauptprozessor (Gehirn) zu gelangen; und das alles mit dem Nachteil, dass ein Loch (Blinder Fleck) im Gesichtsfeld entsteht. Wohl bemerkt, es geht hier nicht um den Informationsfluss — der in der Anordnung des Ingenieurs und dem Wirbeltierauge gleich wäre —, sondern um die Anordnung der Funktionsstrukturen relativ zum Lichteinfall.
Vor dem Hintergrund der stellenweise aufflammenden Diskussion „Evolution oder Intelligent Design“ könnte man schon fragen, ob der Bau des inversen Wirbeltierauges wirklich das Werk eines intelligenten Designers sein kann.
Nun wollen wir fragen, wie es zum inversen Wirbeltierauge gekommen ist. Schuld daran ist die Entwicklungsgeschichte, beginnend mit der Blastula bestehend aus Entoderm und Ektoderm. Durch Invagination der Neuralplatte entsteht nach Abschnürung das Neuralrohr. Im Neuralrohr kommt dadurch das Entoderm außen und das Ektoderm innen zu liegen. Betrachten wir das im Querschnitt, dann entstehen aus den beiden seitlichen Aussackungen der Zwischenhirnanlage die Retinae beider Augen. Dazu stülpen sich diese Aussackungen ein und bilden die Augenanlage. Dabei liegt die ektodermale Schicht, aus der die Photorezeptoren entstehen, wieder außen, dem Lichtstrahlengang sozusagen abgewandt, und die angrenzende Schicht, aus der die Neuronen entstehen, innen dem Lichtstrahlengang zugewandt. Der Bau des inversen Wirbeltierauges beruht demnach entwicklungsgeschichtlich auf dem Prinzip einer Umkehrjacke.
Hierbei handelt es sich wohl nicht um „intelligentes Design“, sondern um entwicklungsgeschichtlich bedingte Kausalzusammenhänge bezüglich Bau und Funktion. Gleichzeitig lehrt uns die Entwicklungsgeschichte, dass es sich bei der Wirbeltier-Retina um einen vorgeschobenen Teil des Zwischenhirns und um kein simples Photorezeptororgan handelt. Das bedeutet, dass im Auge bereits eine Vorverarbeitung visueller Informationen stattfindet. Damit werden wir uns nachher befassen.
Zunächst zur Frage, wie lösen Lichtreize neuronale Aktivität aus bzw. wie kann Licht in Photorezeptoren eine Regulierung von Ionenkanälen bewirken? Dazu schauen wir uns zunächst einen Photorezeptor näher an. Er besteht aus einem Außenglied und einem Innenglied. Im Außenglied befinden sich diskusförmige Membranscheiben, sog. Disks. In diesen wiederum befindet sich der Sehfarbstoff Rhodopsin. Das Rhodopsin absorbiert Licht ändert seine Molekülgestalt und zerfällt daraufhin. Hierdurch wird eine Signalkaskade ausgelöst, die letztlich zur Veränderung des Ruhepotenzials und zur Änderung der Neurotransmitter-Freisetzung führt. Auf diese Weise gelangt Lichtinformation in die Neuronenschicht der Netzhaut und von dort über den Sehnerv ins Gehirn. Das war die Kurzantwort auf die eingangs gestellte Frage. Kommen wir jetzt zu den Details.
Im Dunkeln besteht ein sog. Dunkelstrom. Er kommt dadurch zustande, dass die Na+ Kanäle ständig offen stehen; daraus resultiert eine Membran-Dauerdepolarisation. Diese führt zu ständigen Vesikel-Exozytosen und Ausschüttungen des Neurotransmitters Glutamat, der die postsynaptische Membran des nachgeschalteten Neurons hyperpolarisiert.
Im Hellen, unter dem Einfluss von Licht, sind die Na+ Kanäle geschlossen. Dann besteht eine Membranhyperpolarisation und es folgt keine Neurotransmitter-Ausschüttung. Wie aber ist es möglich, dass im Hellen – gegenüber Dunkeln – die nachgeschalteten Neurone aktiviert werden. Das erscheint zunächst ein wenig merkwürdig, denn im Dunkeln wird Neurotransmitter ausgeschüttet, und das nachgeschaltete Neuron ist nicht aktiviert; im Hellen wird kein Neurotransmitter ausgeschüttet, und das nachgeschaltete Neuron ist aktiv. Dieses Rätsel lässt sich leicht auflösen: das nachgeschaltete Folgeneuron besitzt eine Daueraktivität. Diese Daueraktivität des wird im Dunkeln durch den inhibitorisch wirkenden Neurotransmitter unterdrückt; im Hellen wird kein inhibitorischer Neurotransmitter ausgeschüttet, und die Daueraktivität des Folgeneurons kommt dann voll zur Geltung. Wir sprechen im einen Falle von einer off-Hemmung und im anderen Falle von einer on-Aktivierung. [Anmerkung: je nach Rezeptorart kann Glutamat entweder erregend oder hemmend wirken, in diesem Falle hemmend].
Jetzt wollen wir die vorhin gestellte Frage präzisieren: wie können durch Dunkelheit Na+ Kanäle offen gehalten und durch Licht geschlossen werden? Dazu schauen wir uns die Dunkel -und Lichtreaktionen zunächst in einem groben Schema an. Im Dunkeln werden Na+ Kanäle durch Bindung an cGMP offen gehalten; das führt zur Membrandepolarisation. Jene bewirkt Ausschüttung des inhibitorischen Neurotransmitters, der die Daueraktivität des nachgeschalteten Folgeneurons zum Erlöschen bringt: off-Hemmung. Unter dem Einfluss von Licht werden die Na+ Kanäle durch Hydrolyse von cGMP geschlossen; daraus resultiert eine Membranhyperpolarisation, die die Neurotransmitter-Ausschüttung unterdrückt, so dass die Daueraktivität des nachgeschalteten Folgeneurons ungehemmt zur Geltung kommt.
Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und fragen nach den speziellen photochemischen Primärreaktionen, die zur Hydrolyse von cGMP führen. Hier ist ein Photorezeptor, ein Stäbchen, in dessen Außenglied – hauptsächlich in den Diskmembranen – Sehpurpur=Rhodopsin verpackt ist
Rhodopsin=11-cis-Retinal+Opsin
Diese Folie zeigt das ca. 8 um dicke Außenglied mit Disks in einer rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme. Im Dunkeln befindet sich das Photopigment – gebunden an das Eiweiß Opsin – in der energiearmen „geknickten“ Form als 11-cis Retinal. Im Hellen geht es unter Aufnahme von Lichtenergie h.v über in die „gestreckte“ energiereiche Form des all-trans Retinal. Woher kommt das Photopigment? Es wird als Vitamin A (=all-trans Retinol) aus ß-Carotin mit der Nahrung aufgenommen.
Jetzt fragen wir weiter nach den photochemischen Folgereaktionen. Dieser Kasten möge schematisch eine Diskmembran symbolisieren. Im Dunkeln befindet sich das Sehpigment als 11-cis-Retinal an Opsin gebunden. Unter dem Einfluss von Licht streckt sich das 11-cis-Retinal zum das all-trans-Retinal, genannt Meta-Rhodopsin. Dieses zerfällt unter Ablösung des Opsin und gibt die in der Konfiguration des all-trans-Retinal gespeicherte Energie ab (wird zum 11-cis-Retinal), wodurch G-Proteine aktiviert werden, die ihrerseits Phosphodiesterase PDE aktiveren, welche in Anwesenheit von Calzium-Ionen das cGMP hydrolysiert, woraufhin sich der Na+ Kanal schließt. In Dunkelheit regeneriert das Rhodopsin, d.h. die 11-cis-Konfiguration wird wieder an Opsin gebunden.
Die Funktion dieser Photo-Signalkaskade besteht darin, dass Augen in der Dämmerung sehen können: unter dem Einfluss von einem Photon resultiert all-trans Retinal, das sich vom Opsin löst und in 11-cis-Retinal übergeht (Zerfall des Rhodopsin Rh). Daraus resultiert ein Prozess, der ca. 100 G-Proteine aktiviert, von denen jedes ca. 100 PDE-Moleküle aktiviert, von denen jedes wiederum ca. 200 cGMP-Moleküle hydrolysiert; zusammengefasst ergibt sich eine Verstärkung von
1 hv : 1 Rh : 1.000.000 cGMP
Wir widmen uns nun einem neuen Thema verbunden mit der Frage, wie das retinale Netzwerk – bestehend aus Photorezeptoren und Neuronen – visuelle Information (vor-)verarbeitet. Dazu muss man wissen, dass sich die Netzhaut aus, zum Teil überlappenden, untereinander vernetzten Funktionseinheiten zusammensetzt. Solch eine Funktionseinheit heißt „Perzeptive Einheit“. In solch einer Einheit steht ein Areal von Photorezeptoren über zwischengeschaltete Neurone (Bipolarzellen, Horizontalzellen und Amakrine Zellen) mit einer Ganglienzelle in Verbindung. Mit anderen Worten kurz: Photorezeptoren konvergieren über Interneurone auf eine Ganglienzelle. Letztere besitzt somit einen individuellen Gesichtsfeldausschnitt: das Rezeptive Feld, RF. Einem RF von beispielsweise 3° Sehwinkel entsprechen ca. 20 Rezeptoren in einer Reihe bzw. etwa 350 Rezeptoren in der Fläche.
Die Ganglienzelle sendet das Ergebnis der visuellen Informationsverarbeitung einer Perzeptiven Einheit längs ihres Axon im Sehnerv zum Gehirn. Es gibt verschiedene Ganglienzell-Typen mit unterschiedlichen Antwortcharakteristika, die es erlauben, unterschiedliche Parameter eines visuellen Reizes zu kodieren. Diese Eigenschaften beruhen auf unterschiedlichen Verschaltungen in der Perzeptiven Einheit zwischen den Interneuronen und der Ganglienzelle. Somit können verschiedene Reizparameter (Größe, Bewegung, Bewegungsrichtung, Orientierung) durch verschiedene Perzeptive Einheiten (Typen a-d) kodiert werden. Wir erläutern dies an verschiedenen grobschematischen Modellen.
Typ(a): Größe eines Objekts. Hierzu besteht das RF aus einem zentralen erregenden RF=ERF und einem dieses umgebenden inhibitorischen RF=IRF: visuelle Reize, die im ERF abgebildet werden, erregen die Ganglienzelle; visuelle Reize, die im IRF abgebildet werden, hemmen die Ganglienzelle. Das bedeutet: in diesem stark vereinfachten Modell führen benachbarte Signalwege jeweils von einem Rezeptor über Interneurone zur Ganglienzelle. In den Signalwegen, die dem ERF zugeordnet sind, erregen die Interneurone die Ganglienzelle; in den Signalwegen, die dem IRF zugeordnet sind, hemmen die Interneurone die Ganglienzelle. Werden unterschiedlich große Objekte auf dem RF abgebildet, dann wird ein kleines Objekt die Ganglienzelle schwächer aktivieren als ein größeres; die Ganglienzelle ist maximal aktiviert, wenn das Objekt so groß ist wie das ERF; ist das Objekt größer, so dass es zusätzlich im IRF abgebildet wird, dann sinkt die Antwort der Ganglienzelle.
Typ(b): Bewegung eines Objekts. Das RF besteht aus einem ERF. In den Signalwegen, die den Rezeptoren des ERF zugeordnet sind, erregen die Interneurone die Ganglienzelle und adaptieren anschließend. Was heißt das? Wenn ein Signalweg erregt worden ist, kann er ein zweites Mal sobald nicht erregt werden; d.h., wenn sich ein Objekt am Ort befindet, also steht, dann wird der zugeordnete Signalweg zuerst erregt; bleibt das Objekt jedoch stehen, verstummt der Signalweg. Wie müsste sich das Objekt verhalten, damit die Ganglienzelle erregt wird? Antwort: es muss den Ort wechseln, d.h. sich bewegen. Bewegung des Objekts ist die Voraussetzung dafür, dass die Ganglienzelle über einen Signalweg aktiviert werden kann.
Typ(c): Bewegungsrichtung eines Objekts. Wie kann die Richtung einer Bewegung kodiert werden? Zwecks Kodierung der Bewegung behalten wir im Modell die adaptierenden Verbindungen der Interneurone zur Ganglienzelle bei. Neu sind in diesem Modell einseitige (unilaterale) hemmende Verbindungen jedes Signalwegs zum benachbarten Signalweg. Wenn das Objekt in Richtung der unilateralen Hemmung bewegt wird, ist die Ganglienzelle stumm, bei Bewegung in Gegenrichtung ist die Ganglienzelle dagegen erregt.
Typ(d): Orientierung eines streifenförmigen Objekts. In diesem Modell besteht das RF aus einem schmalen länglichen ERF, das auf Belichtung hin die Ganglienzelle erregt: on-Feld. An beiden Seiten flankiert wird dieses on-Feld von je einem IRF, das auf Belichtung hin die Ganglienzelle hemmt: off-Feld. [Die Frage, wie on- bzw. off-Reaktionen zustande kommen, wollen wir zunächst zurückstellen]. Werden nun unterschiedlich orientierte Streifen (Lichtbalken) auf dem RF abgebildet, dann wird die Ganglienzelle maximal erregt sein, wenn der Lichtbalken das längliche on-Feld ausfüllt, also die Balken-Achse sich mit der on-Feld-Achse deckt. Die Ganglienzelle wird dagegen am schwächsten erregt sein, wenn Balkenachse und on-Feld-Achse rechtwinklig zu einander orientiert sind.
Wir wechseln jetzt das Thema und widmen uns einigen interessanten Phänomen optischer Täuschung, interessant deshalb, weil das, was wir hierbei physiologisch wahrnehmen physikalisch in der Außenwelt nicht existiert, – und uns darüber hinaus wichtige Prinzipien visueller Informationsverarbeitung buchstäblich vor Augen hält. Kompliziert ausgedrückt? Sie werden gleich sehen, was sich dahinter verbirgt. Wir beginnen mit einem Experiment, nicht sehr aufwendig aber eindrucksvoll, – also auch bestens für die Schule geeignet. Die folgende Folie zeigt ein Karomuster bestehend aus schwarzen großen Quadraten, dazwischen befinden sich gleichabständige weiße Streifen; das ganze Muster heißt Herrmann/Hering-Gitter. Das linke Gitter ist kleiner als das rechte: je nachdem, in welcher Reihe Sie sitzen, werden Sie in den Kreuzungspunkten der weißen Gitterstreifen verschwommene dunkle Punkte sehen, die in Wirklichkeit nicht existieren, also eine optische Täuschung darstellen. [Die Täuschung ist besonders auffällig, wenn Sie die Kreuzungspunkte nicht direkt fixieren, sondern extrafoveal betrachten]. Wie kommt diese Wahrnehmung zustande?
Das hängt damit zusammen, dass es in unserer Retina spezielle on-Zentrum-Neurone (sprich Ganglienzellen) vom Grund-Typ(a) gibt, die erregt sind, wenn das RF-Zentrum belichtet wird (on-Antwort) oder die das Zentrum umgebende Peripherie verdunkelt wird (off-Antwort). Bevor wir hierauf näher eingehen, wollen wir zunächst klären, aufgrund welchen neuronalen Verschaltungsprinzips eine on- bzw. off-Antwort zustande kommen kann:
on-Antwort. Der direkte Signalweg R-B-G von den Photorezeptoren (R) über Bipolarzellen (B) zur Ganglienzelle (G) führt zur Erregung von G. Der indirekte Signalweg R-B-A-G verläuft über eine A-Schleife vermittelt durch Amakrine Zellen, die G hemmen. Durch die A-Schleife treten synaptische Verzögerungen auf. Dann wird ein Lichtreiz die Ganglienzelle zunächst erregen (on-Antwort) und mit einer Verzögerung die Ganglienzelle hemmen. G antwortet also nur beim Licht-Einschalten und ist dann stumm, und zwar aufgrund einer „postexzitatorischen Inhibition“ [= nach der Erregung folgenden Hemmung, wobei Hemmung>Erregung].
off-Antwort: Der direkte Signalweg R-B-G führt zur Hemmung von G. Der indirekte Signalweg R-B-A-G verläuft über eine A-Schleife vermittelt durch Amakrine Zellen, die G erregen. In der A-Schleife wird Erregung gespeichert. Dann wird ein Lichtreiz die Ganglienzelle hemmen. Beim Licht-Ausschalten kommt die in der A-Schleife gespeicherte Erregung als off-Antwort zur Geltung. G antwortet also nur beim Licht-Ausschalten, und zwar aufgrund einer „postinhibitorischen Exzitation“ [=nach der Hemmung folgenden Erregung, wobei Hemmung>Erregung].
Damit haben wir die Grundlagen gelegt, um die Antworten von on-Zentrum-Ganglienzellen zu verstehen. Das RF besteht aus einem zentralen on-Feld, und einem peripheren off-Feld. Durch Belichtung des on-Feldes ist die Ganglienzelle erregt, durch Belichtung des off-Feldes ist sie gehemmt. Umgekehrt ist sie durch Verdunklung on-Feldes gehemmt und durch Verdunklung des off-Feldes erregt. (Die Antwortcharakteristik von off-Zentrum-Ganglienzellen ist dementsprechend umgekehrt).
Nun zur „Ent-Täuschung“: nachdem wir die Eigenschaften der on-Zentrum-Ganglienzellen verstanden haben, können wir die „Herrmannsche Täuschung“ aufklären. Die on-Zentrum-Ganglienzelle fungiert als Kontrast-Detektor. Sie vergleicht die Belichtung im on-RF-Zentrum mit der Verdunklung in der off-RF-Peripherie: die Ganglienzelle ist folglich maximal erregt, wenn das on-Zentrum belichtet und die off-Peripherie gleichzeitig verdunkelt wird. Je stärker die Ganglienzelle aktiviert ist, desto stärker ist unser Helligkeitseindruck. Betrachten wir noch einmal das Karomuster mit dem weißen Gitter. Dann sind die on-Zentrum-Ganglienzellen – deren on-Zentren der Streifenbreite entsprechen – im Bereich der Streifen stärker erregt als im Bereich der Kreuzungspunkte, und daraus resultieren in unserer Wahrnehmung die punktförmigen dunklen Schatten.
Auch innerhalb eines solchen weißen Streifens – flankiert von zwei schwarzen Flächen – gibt es eine optische Täuschung, bekannt als „Machscher Streifen“. Ich projiziere zwei Kontrastkanten an die Wand, und hoffe, dass Sie mir keinen Korb geben und sagen, dass Sie nicht das sehen, was ich möchte, dass Sie sehen. Betrachten Sie bitte diesen weißen Streifen, wenn die großen schwarzen Flächen auf einander zugehen bzw. von einander weichen; dann nehmen Sie, abhängig in welcher Reihe Sie sitzen, irgendwann eine oder mehrere dunkle Streifen wahr, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind.
Dieses Kontrast-Phänomen lässt sich durch sog. Laterale Inhibition erklären. Wir veranschaulichen das Prinzip an einem groben Schema: von den Photorezeptoren aus bestehen parallele Signalwege über nachgeschaltete Neurone, von denen hier nur eins dargestellt ist [die Ausschnittsvergrößerung erläutert dies]. Wichtig ist, dass jeder Signalweg Erregung leitet und überträgt, gleichzeitig aber auch einen Prozentsatz der eigenen Erregung von der Erregung des jeweils lateral benachbarten Signalwegs subtrahiert; daher der Name „Laterale Inhibition“. Das klingt etwas kompliziert. Ich veranschauliche dies daher an einem Rechenbeispiel: 25% der eigenen Erregung eines Signalwegs möge von der Erregung des jeweils lateral benachbarten Signalwegs subtrahiert werden. Die Eingangserregung der Photorezeptoren sei im schwarzen Bereich 4 und im weißen Bereich 8:
4 4 4 4 8 8 8 8 8 4 4 4 4
Dann ist nach 25%iger lateraler Inhibition im schwarzen Bereich die Erregung 2 und im weißen Bereich 4. An der Kontrastgrenze jedoch ist die Erregung zum schwarzen hin 1 und zum weißen hin 5:
2 2 2 1 5 4 4 4 5 1 2 2 2
Das bedeutet: durch laterale Inhibition wird die Gesamterregung in den Signalwegen gesenkt, während die Kontraste an den Kontrastkanten überhöht werden. Der Kontrast-Sprung vor der Einwirkung der lateralen Inhibition ist 1:2, nach lateraler Inhibition 1:5. Die Intensität 4 in der Mitte gegenüber den überhöhten Rändern (5) erklärt die Machschen Streifen. -- Das Prinzip der Kontrastverstärkung durch laterale Inhibition spielt in fast allen sensorischen Systemen eine wichtige Rolle.
Wir verlassen damit den retinalen Aspekt visueller Informations-Aufnahme -und Verarbeitung. Themen wie trichromatisches Sehen, Lokaladaptation, räumliches Auflösungsvermögen, zeitliches Auflösungsvermögen, Akkommodation, etc – die Sie hinreichend aus Ihrer Schulzeit kennen – finden Sie zusammengefasst in einem Glossar zu diesem Block, bestehend aus drei Info-Tafeln.
Lassen Sie uns jetzt ein paar mir wichtig erscheinende Aspekte der zentralen visuellen Informationsverarbeitung im Gehirn beleuchten. Wo liegen in der Großhirnrinde der Säuger die Zentren für Sehen, Hören, Tasten, Sich-Bewegen, Sprechen. Diese Folie zeigt die Großhirnrinde des Menschen; sie gliedert sich in verschiedene Bereiche, so genannte Lappen. Jene Abschnitte, die uns hier interessieren, sind zuständig für: Sprechen, Sich-Bewegen, Tasten, Sehen, Hören. Hier eine grobschematische Darstellung, dort die genaue Topographie basierend auf PET-Analysen. Bei den PET-Studien werden die Probanden in die „CT-Röhre“ geschoben; anschließend wird ihnen z.B. Musik vorgespielt und das Positronen-Emissions-Tomogramm (PET) aufgezeichnet.
Ähnliche Untersuchungen, allerdings mit Hilfe einer anderen Technik, hat Frau Dr. Schürg-Pfeiffer an Studierenden in unserer Abteilung Neurobiologie durchgeführt. Sie wandte hierzu die Elektro-Enzephalo-Graphie (EEG) an. Dazu werden Hirnströme als Summenpotenziale der Großhirnrinde von der Schädeloberfläche abgeleitet und mit Hilfe eines Computers ausgewertet. Diese Folie zeigt die Abteitorte, und die nächste Folie zeigt das Ergebnis von drei visuellen Aufgaben aufgezeichnet im EEG:
- Lokalisationsaufgabe: Der Proband blickte auf ein Landschaftsbild und wurde gefragt, ob das Bild genau in den Rahmen passt. Daraufhin waren in seinem EEG bestimmte Bereiche des parietalen Cortex maximal aktiviert.
- Erkennungsaufgabe: Der Proband blickte auf ein anderes Landschaftsbild und wurde jetzt gefragt, was das Bild zeigt. Daraufhin waren in seinem EEG bestimmte Bereiche des temporalen Cortex und visuellen Cortex maximal aktiviert.
- Erinnerungsaufgabe: Das letzte Bild wurde entfernt. Der Proband wurde aufgefordert, sich jenes Bild vorzustellen. Interessanterweise waren in seinem EEG Bereiche stark aktiviert, die während der Ansicht des Bildes aktiv waren, d.h. während der Erinnerung werden jene Neurone aktiv, die sich an der Analyse des Bildes beteiligten.
Schließlich hat Frau Dr. Schürg-Pfeiffer (mit anderen Probanden) drei entsprechende motorische Aufgaben im EEG untersucht.
- Entspannte Ruhe: Der Proband saß im Dunkeln auf einem Stuhl und dachte an nichts Böses. Die Hauptaktivität des EEG lag im frontalen Cortex.
- Däumchendrehen: Jetzt wurde der Proband aufgefordert, die Däumchen umeinander zu drehen. Die EEG Aktivität verlagerte sich in den motorischen Cortex.
- Däumchendrehen sich vorstellen: Der Proband wird nun aufgefordert, sich vorzustellen, dass er seine Däumchen umeinander dreht. Es entsteht im EEG ein ähnliches Aktivitätsmuster wie während der Bewegung. Während ich mir meine Bewegung vorstelle werden also die gleichen Hirnregionen aktiviert, die für die Ausführung dieser Bewegung verantwortlich sind.
Wir lernen daraus, dass das eine physiologische Grundlage hat, was Sportler – denken Sie an Boris Becker – schon lange wussten, nämlich mentales Training. Es ist wichtig für Sportler, vor einem Wettkampf motorische Muster und Bewegungsabfolgen mental noch einmal durchzugehen. Man hat festgestellt, dass während des Sich-Vorstellens einer solchen Übung sogar Neurone des Rückenmarks aktiviert werden. Durch mentales Training werden jene Signalwege im Gehirn gebahnt, die später für die Durchführung der Motorik gebraucht werden. Dies gilt sowohl für den sensorischen als auch für den motorischen Bereich.
Bevor ich zum nächsten Thema überleite, nämlich zur Frage, wie werden bestimmte Merkmale eines Objekts (Farbe, Form, Kontrast, Bewegung) stufenweise im Sehsystem verarbeitet, um dann zum Erkennungsprozess („was ist das für ein Objekt“) und zum Lokalisationsprozess („wo befindet sich das Objekt“, „wie kann ich es ergreifen“) zu führen, wollen wir zunächst verfolgen, wie das binokulare Gesichtsfeld in der Retina und im Gehirn abgebildet wird. Hier ist das binokulare rechte und linke Gesichtsfeld. Das rechte Gesichtsfeld wird von den Augen über das linke Corpus geniculatum laterale (Seitlicher Kniehöcker) jeweils im linken visuellen Cortex abgebildet, und zwar in den Arealen V1, V2, V3. Das linke Gesichtsfeld wird in diesen Hirnregionen entsprechend in der rechten Hirnhälfte abgebildet.
Jetzt wiederholen wir die Frage: wie werden bestimmte Merkmale eines Objekts (Farbe, Form, Kontrast, Bewegung) stufenweise im Sehsystem verarbeitet, um dann zum Erkennungsprozess und zum Lokalisationsprozess zu führen. Die nächste Folie zeigt das Ergebnis in einem groben Übersichtsschema, das auf den ersten Blick ziemlich unübersichtlich ist. Wir bauen das Schema daher stufenweise in einer Animation auf.
Das „was“-System. Wir beginnen mit der Retina. Parvozelluläre (kleine) Ganglienzellen entsenden Infos über die Attribute Form, Farbe und Kontrast eines Objekts zum Corpus geniculatum laterale und von dort zum corticalen Areal V1 und von diesem zu V2 und von jenem zu V3 und V4, wo diese Attribute in verschiedenen Schichten weiter verarbeitet werden. In V4 findet bereits eine Zuordnung zwischen Farbe und Form statt, z.B. „rund“+„orange“. Im inferioren temporalen Cortex ITC erfolgt die Erkennung, d.h. die Zuordnung zur Bedeutungsklasse, hier = „Apfelsine“.
Das „wo-wie“-System. Wir beginnen wieder mit der Retina. Magnozelluläre (große) Ganglienzellen entsenden Infos über das Attribut Bewegung eines Objekts zum Corpus geniculatum laterale und von dort zu corticalen Arealen V1, V2, V3, V4 und V5, wo diese Attribute in verschiedenen Schichten weiter verarbeitet werden. Die Auswertung mündet in den posterioren parietalen Cortex PPT, der die Frage nach dem „wo befindet sich das Objekt“ und „wie kann ich es ergreifen“ beantwortet.
Ob diese beiden Info-Verarbeitungswege bezüglich der Frage nach dem „was“ und „wo-wie“ wirklich so getrennt von einander verlaufen, hat die Wissenschaftler stets beschäftigt. Schließlich hat man eine Patientin gefunden, die einen Schaden in V4 hatte, d.h. sie konnte Objekte nicht erkennen, z.B. einen Bierkrug. Wenn man ihr den Bierkrug zeigte, konnte sie das unerkannte Objekt lokalisieren. Wurde sie jedoch aufgefordert, nach dem Bierkrug zu greifen, was aufgrund des intakten „wo-wie“-Systems hätte funktionieren müssen, war sie dazu nicht in der Lage. Sie konnte ihre Hand nicht so bewegen, dass sie den Henkel des Bierkrugs ergreifen konnte. Das beweist, dass die Frage „wo“ und „wie“ Informationen über die Erkennung voraussetzt, z.B. durch Verbindungen von V4 nach V5. Denn nur, wenn man die Form des Bierkrugs erkennt, kann man ihn greifen.
Die „was“ und „wo-wie“ Systeme sind nicht nur bei Primaten, sondern auch bei anderen Säugern ausgebildet, z.B. bei irischen Hochlandschafen. In ihrem der Objekterkennung dienenden ITC hat man Aktionspotenziale von Neuronen abgeleitet, die beim Anblick eines gehörnten Artgenossen maximal aktiviert waren, aber auch beim Anblick des Experimentators sofern er Hörner trug. Ohne Hörner blieben die neuronalen Antworten stets aus.
Zum Abschluss wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob corticale Areale für Fingerbewegen, Sehen etc. ein für allemal vorbestimmt sind, oder, ob sie sich funktionell gegenseitig ergänzen können. Letzteres ist tatsächlich der Fall. Unter Re-mapping versteht man die Eigenschaft des Cortex plastisch zu sein, nämlich seine Funktion dem jeweiligen Bedarf anzupassen. Man hat durch PET-Studien bei Violinenvirtuosen festgestellt, dass im motorischen Cortex, der für die Bewegung der Finger relevant ist, jene Bereiche, die die aktiven Finger repräsentieren, wesentlich größer sind als beim normalen Menschen, und dass der weniger aktive Daumen unterrepräsentiert ist. In anderen Fällen hat man gefunden, dass es nach Amputation von Gliedmaßen zu einer corticalen Invasion kommen kann: angenommen jemandem wurde bei einem Unfall der Daumen abgetrennt, dann war die „Daumenrepräsentanz“ in seinem Cortex – die normalerweise die Daumenbewegung ansteuert – sozusagen arbeitslos. Aber die ehemalige Daumenrepräsentanz liegt nicht brach. Da der Betroffene versucht, die Funktion des Daumen von den anderen Fingern übernehmen zu lassen, übernimmt die alte corticale „Daumenrepräsentanz“ die Funktion für die hilfreichen Finger, wodurch sich die Fingerrepräsentanz in der betroffenen Cortexseite vergrößert.
Nach heutigem Erkenntnisstand ist es in der Tat wichtig, sich mit Dingen unterschiedlichster Art zu beschäftigen. Je nach dem, wie intensiv diese Beschäftigung ist, kommt es zu entsprechend spezialisierten Ausdehnungen im Cortex. Auf diese Art und Weise erklären sich Höchstleistungen, die von Begabungen zu unterscheiden sind.
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein anderes Phänomen erwähnen, und zwar die sensorische Substitution. Man versteht darunter die Fähigkeit eine corticalen Areals, das z.B. dem Sehen gewidmet ist, Funktionen einer anderen Sinnesmodalität wie z.B. Tasten zu übernehmen. Blinde Katzen können mit ihrem visuellen Cortex hören, blinde Menschen können mit ihrem visuellen Cortex Blindenschrift ertasten. Wie hat man das bei blinden Menschen herausgefunden?
Man hat bei einer Gruppe von sehenden Menschen den visuellen Cortex durch Transkraniale Magnetfeldstimulation reversibel inaktiviert; jene Probanden konnten daraufhin vorübergehend nichts sehen. Sodann hat man dieselben Probanden, die Blindenschrift beherrschten, aufgefordert, Blindenschrift zu ertasten. Das klappte problemlos. Den entsprechenden Versuch wiederholte man mit blinden Menschen. Interessanterweise zeigten diese nach Ausschaltung ihres visuellen Cortex große Defizite im Erfassen der Blindenschrift. Das ist der Beweis dafür, dass der visuelle Cortex von blinden Menschen für andere sensorische Aufgaben herangezogen werden kann. Und dies zeigt umso mehr, dass unser Gehirn über ein enormes Funktions-Potenzial verfügt, das durch entsprechende Aktivitäten genutzt werden kann, oder, wenn die Aktivitäten fehlen, verkümmert d.h. degeneriert.
Das war’s für Block 9. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
______________________________________________
Block10: Sinne (III) Haut, Seitenlinie, Innenohr
Mechanorezeptoren,Thermorezeptoren, Nozizeptoren, Schmerz-Mediatoren, Anästhetika; Haarzellen, Labyrinth, Utriculus, Cortisches Organ, Bioakustik
______________________________________________
vgl. Abbildungen Block 10
Fragen zu Bock 10
• Welche Sinnesmodalitäten erfassen wir mit der Körperhaut? Wo liegen die Somata der Sinnesnervenzellen?
• Welche Reizqualitäten erfassen die Mechanorezeptoren unserer Körperhaut?
• Wie misst die Haut die Umgebungstemperatur? Ist eine absolute Messung möglich?
• Wie entsteht Schmerzempfindung?
• Analgesie, Anästhesie, Narkose: Wie lässt sich Schmerzempfindung unterdrücken bzw. ausschalten?
• Wie funktioniert eine Haarzelle?
• Strömungssinn: Wie funktioniert das Seitenliniensystem der Fische?
• Wie werden bei Wirbeltieren Lage-, Dreh- und Hörsinn vermittelt?
• Wie entsteht labyrinthärer Nystagmus? Was ist Nachnystagmus?
• Wodurch wird aufrechte Körperhaltung beim Kippen der Standfläche gesichert?
• Hörsinn der Säugetiere: Welche Strukturen dienen der Schallaufnahme?
• Cortisches Organ: Was besagt die Wanderwellen-Theorie gegenüber der Resonator-Hypothese? Wie verläuft eine Wanderwelle?
• Welche Funktionen erfüllen die inneren und äußeren Haarzellen?
• Gehörknöchelchen vs Webersche Knöchelchen: Welche Möglichkeiten der Schallübertragung gibt es?
• Bioakustik: Worauf beruht die Detektion artspezifischer Paarungsrufe bei Fröschen?
• Wie orientieren sich Fledermäuse mit Hilfe von Ultraschall? Wie ist ihr Hörsystem daran angepasst?
.
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie zu Block10: Sinne (III). Zum Menü. Wir werden uns heute mit z.T. sehr unterschiedlichen Themen beschäftigen. Das erste Haupt-Thema befasst sich mit den Sinnesnervenzellen der Körperhaut der Wirbeltiere, speziell der Säuger: Mechanorezeptoren, Thermorezeptoren, Schmerz- bzw. Nozizeptoren. In diesem Zusammenhang werden wir Schmerz-Mediatoren und die verschiedenen Angriffspunkte von Anästetika kennen lernen. Das zweite Haupt-Thema befasst sich mit Haarzellensinnesorganen. Hierzu gehören alle Sinnesorgane, die Haarzellen als sekundäre Sinneszellen besitzen. Dazu gehört das Seitenliniensystem der Fische und der aquatischen Amphibien sowie die Sinnesorgane des Innenohrs der Wirbeltiere: Labyrinth, Utrikulus, Cortisches Organ. Schließlich werden wir ausgewählte Kapitel der Bioakustik beleuchten, die uns zeigen, wie Tiere durch Schall mit ihrer Umwelt kommunizieren können.
Zweifellos werden auch hier wieder einige Abschnitte der Sinnesphysiologie für Sie Erinnerungen an den Grundstoff Ihres Biologieunterrichts wecken. Dort werde ich mich, wie gewöhnlich, kurz fassen, um in jenen Bereichen Schwerpunkte zu setzen, in denen die jüngste Wissenschaft weiter vorgedrungen ist.
Diese Einführungs-Folie orientiert noch einmal übersichtlich über das heutige Programm. Wir beginnen mit den Hautrezeptoren, gegliedert nach drei Sinnesmodalitäten: Mechano-R, Thermo-R und Schmerz-R. Innerhalb der Modalität Mechano-R unterscheiden wir drei Rezeptortypen für die Reizqualitäten Druck, Berührung und Vibration. In der Modalität Thermo-R unterscheiden wir zwei Rezeptortypen für die Reizqualitäten Wärme und Kälte.
Die Haarzellen-Sinnesorgane sind der Sinnesmodalität nach alle für Mechano-R zuständig, differenziert nach drei Reizqualitäten: Strömungssinn (Seitenlinienorgan und Drehsinnesorgan), Lagesinn, Hörsinn.
Mit den Hautrezeptoren beginnend, stellen wir zunächst die Frage: wie sind sie gebaut und wo liegen ihre Zellkörper, also die den Zellkern umgebenden Somata? Das wäre z.B. eine Prüfungsfrage, denn sie wird häufig falsch beantwortet, z.T. deshalb, weil der Sachverhalt in (älteren) Schulbüchern unzutreffend dargestellt wird. Die Antwort muss lauten: bei Hautrezeptoren handelt es sich um Sinnesnervenzellen, deren Zellkörper (Somata) in Spinalganglien lokalisiert sind; ihre dendritischen Reiz aufnehmenden Endigungen reichen (je nach Typ) in unterschiedliche Tiefen der Haut und stehen dort (je nach Typ) mit unterschiedlichen Körpern in Kontakt; bei diesen Körpern handelt es sich nicht etwa um Produkte der Sinneszelle, sondern um verschiedene mechanische Reize übertragende Transducer-Strukturen. Man nennt diese Rezeptoren (R) daher auch korpuskuläre Rezeptoren; in der behaarten Haut sind es mehrere Scheiben (Pinkus-Iggo-R) bzw. ein Haar (Haarfollikel-R); in der unbehaarten Haut ist es eine Scheibe (Merkel-R), eine zwiebelhüllenartige Lamellenhaube (Vater-Pacini-R) bzw. mehrere Scheiben in bestimmter Anordnung (Meißner-R). Weiterhin gibt es nicht-korpuskuläre Rezeptoren, die mit keinem Körperchen oder Haar in Kontakt stehen, sondern frei in der Haut endigen; dazu gehören die Schmerz-, Kälte- und Wärme-R.
Die Somata dieser Sinnesnervenzellen entsenden ihre Neuriten in das Rückenmark, wo die zugeordneten Signale auf nachgeschaltete Neurone übertragen bzw. umgeleitet und dem Gehirn zugeführt werden können. Alle Sinnesnervenzellen haben also den gleichen Grundaufbau: Neurit, Soma, Dendrit. Sie unterscheiden sich, je nach dem, ob bzw. mit welcher Art Körperchen ihre dendritischen rezeptiven Endigungen in Kontakt stehen. Noch einmal: dies sind keine neurogenen Körper, auch keine neuronalen Körper; sie haben Reiz übertragende, jedoch keine neuronale Funktion.
Interessant ist die Axoncharakteristik sowie die Art der Myelinisierung der neuritischen bzw. dentritischen Fortsätze jener Sinnesnervenzellen. Beide Fortsätze haben definitionsgemäß Axonfunktion, denn sie leiten Aktionspotenziale. Die Markscheide des dem ZNS zugeordneten neuritischen Abschnitts wird jedoch von Oligodendrogliazellen gebildet, während die Markscheide des dem PNS zugeordneten dendritischen Abschnitts von Schwannzellen gebildet wird.
Kommen wir jetzt zur Frage, auf welche Weise die drei verschiedenen Reizqualitäten von den Mechanorezeptoren der Haut erfasst werden. Die Tabelle orientiert über das Wichtigste: Druck (Merkel-R, Pinkus-Iggo-R), Berührung (Meißner-R), Vibration (Vater-Pacini-R, Haarfollikel-R). Diese drei Rezeptortypen verdanken ihre unterschiedliche Empfindlichkeit in erster Linie ihrer unterschiedlich starke Adaptation auf mechanische Reizung: schwach [Druck], stark [Berührung], sehr stark [Vibration].
Der schwach adaptierende Merkel-R antwortet auf die Eindrucktiefe; je tiefer, je höher die Entladungsrate. Für den schneller adaptierenden Meißner-R muss der mechanische Reiz auf der Haut seinen Ort verändern, um bei ihm Entladungen auszulösen; nicht die Drucktiefe, sondern die Änderung des Drucks ist hier ausschlaggebend. Der sehr stark adaptierende Vater-Pacini-R reagiert auf Druckänderung nur mit einer einzigen Entladung und antwortet folglich auf Vibrationsreize unterschiedlicher Frequenz mit Entladungen entsprechender Sequenz.
Also, mit der Fingerkuppe – in Verbindung mit dem Fingernagel – Vibrationen (=Substratschall) erfassen, das wollen wir uns einmal in einem Video-Clip anschauen: „Wetten, dass“ jemand mit seinem Fingernagel als Tonabnehmer von einer Schallplatte Vibrationen erfassen, in einer Art Fingerhörkette seinem Ohr zuführen und somit Musik erkennen kann? Wir lernen, dass dies möglich ist. Es gibt auch Menschen – mit absolutem Gehör –, die durch Handkontakt mit der Verkleidung von Motoren (Phöne, Ventilatoren, Rasierapparate, Nasentrimmer etc) deren Drehzahl erfassen können.
Wenden wir uns jetzt kurz der Thermo-R der Körperhaut zu. Einfacher Versuch: die Körperhaut wird abgekühlt und sodann erwärmt. Die Entladungsrate der Kältefaser steigt bei Abkühlung, sinkt dann adaptierend auf ein konstantes Niveau und erlischt bei anschließender Erwärmung kurzfristig. Die Wärmefaser verhält sich bei diesem Temperaturverlauf genau entgegengesetzt. Das bedeutet, dass wir keine absoluten Temperaturen, sondern lediglich deren Veränderungen wahrnehmen können. Hierfür gibt es einen instruktiven Schülerversuch, genannt der Webersche Drei-Schalenversuch, bestehend aus Wasserschalen mit 15°C, 25°C und 30°C. Linke Hand in 15° und rechte Hand in 30° halten, anschließend beide Hände gleichzeitig in 25°: die linke Hand empfindet das Wasser als relativ warm und die rechte empfindet dasselbe Wasser als relativ kalt. Abschließend vergleichen wir die Kennlinien für Kälte- und Wärme-R. Interessant ist hier die paradoxe Kälteempfindung der Kältefasern bei relativ hohen Temperaturen, wovon man sich in der Badewanne mit der großen Zehe am Warmwasserhan leicht überzeugen kann.
Jetzt wechseln wir zu einem vertrauten Thema, das zunächst ganz einfach klingt: wie funktioniert die Schmerzempfindung? Schmerzen zu empfinden, ist lebensnotwendig; Schmerzempfindung schützt uns u.a. vor Selbstzerstörung; bedenken Sie, welche Lebenschance unsere Zunge während einer ausgiebigen Mahlzeit hätte, wäre sie nicht mit Schmerzrezeptoren ausgestattet. Offensichtlich gehört es aber auch zur Signalfunktion des Schmerzes, dass Schmerz nach seiner Einwirkung nicht sofort abklingt, sondern häufig über das Schmerzereignis hinaus als Entzündung anhält. Schmerz hat damit Erinnerungswert. Das ist sicherlich sinnvoll, das kann aber auch, wenn Entzündungsprozesse als Selbstläufer eine Eigendynamik entwickeln, unerträglich werden. Wie wir heute wissen, sind allein die peripheren Prozesse, die zur Schmerzrezeption führen, recht kompliziert.
Zunächst ein paar Begriffe: Noxe leitet sich von Noxa, lt. = der Schaden ab und bedeutet Schmerzreiz, also ein Gewebe schädigender polymodaler Reiz (extremer thermischer, mechanischer bzw. chemischer Natur). Nozizeption bedeutet Schmerzrezeption. Ein wichtiger Schmerz-Mediator und Neurotransmitter ist die „Substanz P“, P stehend für engl. = „pain“. Ferner gibt es verschiedene Entzündungs-Mediatoren, die den Schmerzreiz oder das Ereignis im Gewebe dauerhaft vermitteln. Dazu gehören die Prostaglandine, Leukotrine, Bradykinin, Histamin und Serotonin. Nun, wie dieses „Schmerzorchester“ zusammenspielt, das wollen wir jetzt näher verfolgen.
Wir fassen auf eine heiße Herdplatte: polymodale Noxe extremer thermischer, mechanischer bzw. chemischer Natur. Es kommt zu einer lokalen Zerstörung des Gewebes im Bereich der Schmerznervenendigungen. Als Folge der Zerstörung werden Prostaglandine und Leukotrine als Entzündungsmediatoren synthetisiert. Diese führen gleichzeitig zur Entzündung des Gewebes und induzieren damit einen lokalen Krankheitsprozess. Weiterhin kommt es im Gewebe zur Freisetzung der Mediatoren Bradykinin, Serotonin und Histamin. Diese wirken auf die Schmerzfaser sensibilisierend ein und sorgen dafür, dass ihre Empfindlichkeitsschwelle von hoch auf niedrig gesetzt wird. Die Zellmembran wird depolarisiert und antwortet mit Aktionspotenzialen. Damit nicht genug, aus der Faser wird jetzt Substanz P abgesondert, die ihrerseits synergistisch die Empfindlichkeitsschwelle weiter senkt. Im Verlaufe dieser Prozesse wird aus dem Axonendknoten der Schmerzfaser Substanz P als Neurotransmitter ausgeschüttet, die synaptisch der Signalübertragung auf Neurone des Rückenmarks dient. Wie Sie inzwischen wissen, kann die Freisetzung von Substanz P ihrerseits durch eine an den Axonendknoten ansetzende axo-axonische Synapse aus dem ZNS moduliert werden z.B. durch Methionin-Enkephalin. Auf diese Weise kann die Schmerzübertragung unterdrückt werden.
An die Schmerzmodulation anknüpfend wollen wir uns jetzt speziell mit den Möglichkeiten der Analgesie, Anästhesie und Narkose beschäftigen. Unter Analgesie versteht man die Ausschaltung von Schmerzen. Anästhesie hat gleichzeitig etwas mit Narkose zu tun. Narkose selbst dient lediglich der Ausschaltung des Bewusstseins. Da während der Narkose die Schmerzleitung nicht unterbrochen ist, sondern freien unbewussten Zugang zum Gehirn hat, und sich Schmerz somit unbewusst in das Schmerzgedächtnis „einbrennen“ kann, sollte Narkose nicht ohne analgetische Versorgung des Patienten erfolgen.
(1) Angenommen, wir haben Kopfschmerzen und greifen zum Medikament Paracetamol, dann werden die Schmerzen durch Blockierung der Prostaglandin-Synthese gelindert.
(2) Der Zahnarzt bereitet eine Zahnextraktion vor und verabreicht uns zuvor eine Injektion von Meaverin oder Lidokain. Hierbei handelt es sich um analgetische Lokalanästhesie. Jene Substanzen bewirken einen Verschluss von Na+ Kanälen in Membranen der Sinnesnervenfasern.
(3) Für leichtere Eingriffe im Bereich der Körperhaut gibt/gab es eine klassische Methode, die lokale Vereisung. Durch Vereisung der Haut wird die ATP-abhängige K+/Na+ Pumpe beeinträchtigt und damit das Ruhepotenzial soweit abgesenkt, dass keine Aktionspotenziale geleitet werden können.
(4) Für eine schwere Operation wird das Bewusstsein des Patienten durch Narkose ausgeschaltet. Dazu dient z.B. Lachgas (Distickstoffoxid). Lachgas spielt heutzutage, gerade in Verbindung mit modernen Zusätzen, eine große Rolle. Distickstoffoxid blockiert im ZNS die Na+ Ionenkanäle, und zwar durch Eindringen in lipophile Bereiche der Membran. Diese drücken die Na+ Ionenkanäle gleichsam zusammen, d.h. sie verschließen diese indirekt.
(5) Eine andere Möglichkeit der Bewusstseinsausschaltung bietet die Ketamin-Narkose. Ketamin blockiert Glutamatrezeptoren und setzt damit die Erregbarkeit im ZNS herab. Die alten Cowboys blockierten die Glutamatrezeptoren vor einem chirurgischen Eingriff durch Trinken von Alkohol, wozu sich z.B. Whisky bestens eignete.
(6) In speziellen Fällen können zur Schmerzausschaltung Opiate eingesetzt werden, deren Wirkungen und Nebenwirkungen wir in BlockVII bereits kennen gelernt haben.
Wir wollen dieses Kapitel nicht verlassen, ohne uns noch einmal der Problematik der Bewusstseinsausschaltung zuzuwenden. Hierzu ein Video-Clip. Was lernen wir daraus? Es gibt Dosierungsprobleme. So berichten Patienten, dass sie trotz angeblicher Ausschaltung ihres Bewusstseins ihre Operation bewusst wahrnehmen konnten. Kritische Forscher betonen daher, solange die neurobiologischen Grundlagen des Bewusstseins nicht geklärt sind, ist jede Methode der Bewusstseinsausschaltung in der Medizin problematisch.
Jetzt wenden wir uns der großen Gruppe der Haarzellen-Rrezeptor-Organe zu. Haarzellen, sekundäre Sinneszellen, sind für Strömungssinn (Seitenlinienorgan, Labyrinth), Lagesinn und Hörsinn zuständig. Wir wollen nun schauen, wie Haarzellen in unterschiedliche Sinnesorgane eingebaut sind, um verschiedene Sinnesempfindungen – wie Strömung, Drehung, Lage oder Hören – zu vermitteln. Zunächst: wie ist eine solche Haarzelle aufgebaut und wie funktioniert sie? Eine Haarzelle (bitte nicht zu verwechseln mit der Haarfollikelzelle der behaarten Körperhaut) besteht aus einem Soma und besitzt als sekundäre Sinneszelle kein Axon; d.h. ein Neuron aus dem ZNS holt sich mit seinem Dendriten das Signal der Haarzelle ab. Bei den rezeptiven Strukturen handelt es sich um haarähnliche Anhänge, besser: Cilien oder Mikrovilli. Die Mehrheit der Mikrovilli hat eine bestimmte räumliche (sterische) Anordnung; daher der Name Stereovilli. Ein bestimmtes Haar kommt in der Einzahl vor und heißt Kinocilium. Früher vermutete man, dass das Kinocilium ausschlaggebend ist auf die Erregung bzw. Hemmung der Haarzelle. Das Konzept ist inzwischen widerlegt, denn man kann das Kinocilium zerstören, ohne, dass die Funktion der Haarzelle beeinträchtigt wird. Das Kinocilium hat unterstützende Transducer-Funktion; die wirksamen Elemente sind die Stereocilien oder Stereovilli. Je nach dem, in welche Richtung sie gebogen, d.h. geschert, werden, resultiert daraus eine Erregung (Membrandepolarisation) mit vermehrter Neurotransmitter-Ausschüttung oder eine Hemmung (Membranhyperpolarisation) mit reduzierter Neurotransmitter-Ausschüttung. Dementsprechend ändert sich die Frequenz der APs in der abgreifenden Nervenfaser mit Axoncharakteristik. Stehen alle Stereovilli senkrecht, so entspricht dies der Ruheaktivität der Haarzelle mit moderater Neurotransmitter-Ausschüttung.
Die effektive Auslenkung einer Stereocilie beträgt 0,3 nm, also 3 Angström. Daraus resultiert eine Membrandepolarisation von 0,1 mV und – über entsprechende Neurotransmitter-Ausschüttung – eine Änderung der Impulsrate in der abgreifenden Nervenfaser. Dazu muss die Stereocilie um einen Winkel von 0,0003° geschert werden; dies entspricht, um ein Beispiel zu nennen, der Auslenkung der Eifelturmspitze etwa um Daumenbreite; dies macht zugleich deutlich, wie empfindlich biologischen Systeme – nicht nur im chemosensorischen, sondern auch im mechanosensorischen Nanobereich – messen können. Entsprechend gering ist auch die Latenzzeit zwischen Reiz und Reaktion dieser Mechanorezeptoren (<1ms), verglichen mit den Latenzzeiten von Photorezeptoren Zapfen (ca. 15ms) bzw. Stäbchen (ca. 40ms).
Lassen Sie uns nun verfolgen, wie solch eine Haarzelle funktioniert. Hier sind zwei Stereovilli herausgezeichnet. Sie sind von einer Flüssigkeit umgeben. In dieser Endolymphe ist das Verhältnis zwischen K+ und Na+ genau umgekehrt zur Neuronenmembran:
K+[außen] >> K+[innen]
Na+[außen] << Na+[innen]
Wenn die Stereovilli geschert werden, öffnet sich mechanisch bedingt ein K+ Transducerkanal. Diese Öffnung erfolgt durch mechanischen Zug eines Proteinfadens, genannt Tip-Link, der die Stereovilli untereinander verlinkt. Der K+ Einstrom in die Haarzelle führt zu einer Membrandepolarisation und diese wiederum zu einem Kalziumionen-Einstrom (Magnesiumionen-Ausstrom) und zur Ausschüttung von Neurotransmitter. Die Aktivität der Haarzelle kann vom ZNS aus (efferent) über eine inhibitorische Synapse moduliert werden. – In dieser Folie erkennen Sie die Stereovilli in Aufsicht mit dem randständigen separaten Kinocilium.
Nachdem wir Bau und Funktion der Haarzellen verstanden haben, wollen wir Sinnesorgane kennen lernen, in denen sie integriert sind. Beginnen wir mit dem Seitenlinienorgan der Fische. Seitlich finden wir eine Löcherkette als Perforation in der Körperhaut, grob vergleichbar der Fensterreihe eines Jumbos. Das umgebende Wasser kommuniziert über diese Löcher mit einem Kanalsystem unter der Haut, in dem jeweils paarweise Haarzellen angeordnet sind, deren Stereovilli durch eine Gallertkappe (Cupula) zusammengehalten werden. Sobald sich der Fisch einem Gegenstand nähert, entsteht durch den Wasserstaudruck eine Strömung, die sich durch die Hautporen in das Kanalsystem fortpflanzt und die Cupulae samt der Stereovilli der Haarzellen auslenkt. Das daraus resultierende Erregungsmuster der verschiedenen Cupulae/Haarzellen wird dem ZNS zur Auswertung zugeführt. Auf diese Weise können Fische im trüben Wasser fischen und sich orientieren.
Von Seitenlinienorganen des Kopfbereichs leiten sich phylogenetisch die Bogengänge des Labyrinths ab. Das Labyrinth enthält drei verschiedene Sinnesorgane: Bogengänge für Drehsinn (Strömungssinn, Winkelbeschleunigung), Utrikulus für Lagesinn (Schweresinn, Linearbeschleunigung) und Cortisches Organ für Hörsinn (Schallwellen); sie gehören zum Innenohr. Die drei mit Endolymphe gefüllten, untereinander kommunizierenden Bogengänge haben eine bestimmte räumliche Anordnung, entsprechend einer Zimmerecke: zwei rechtwinklig zu einander stehende vertikale und ein horizontaler. Jeder Bogengang mündet in eine Ampulle bestehend aus Haarzellen und einer Gallert-Cupula, deren spezifisches Gewicht (1,0) dem der Endolymphe entspricht. Aufgrund der Trägheit der Endolymphe orientiert dieses Ampullensystem das ZNS über Passivbewegungen (Winkelbeschleunigungen) innerhalb der drei Raumebenen. Die Folie erläutert das Prinzip der horizontalen Bogengangreaktionen: labyrinthärer Nystagmus und Nachnystagmus; ampullopetaler vs ampullofugaler Endolymphstrom.
Zum Lagesinnesorgan: die Haarzellen befinden sich an der Basis des Utrikulus; ihre Stereovilli ragen in eine Gallertplatte, auf der als Schwerekörper sog. Otolithen aus Kalziumcarbonat lokalisiert sind mit einem spezifischen Gewicht 2,8 von dem der Umgebung (1,0) abweichen. Befindet sich das System in der Schräglage, dann wird sich die wabbelige Gallertplatte verschieben und damit die Haarzellen reizen. Die Folie erläutert das Prinzip der Lagereaktionen. Auch in Ruhe auf waagerechter Ebene sendet der Utrikulus Muskel-tonisierende Daueraktivität; fällt eines der paarigen Organe aus, gerät der Körper in die Schräglage; fallen beide aus, liegt er platt am Boden.
Zum Hörsinnesorgan: die Haarzellen sind im Cortischen Organ auf der Basilarmembran angeordnet; die Spitzen der Stereovilli stehen mechanisch in Kontakt mit der Tektorialmembran. Hierdurch wird verhindert, dass Stereovilli durch Braunsche Bewegung bewegt werden. Wird die Tektorialmembran während eines Schallereignisses gegenüber der Basilarmembran verschoben, dann kommt es dort zur Reizung der Haarzellen. Das Corti-Organ befindet sich in der zur Schnecke aufgerollten Cochlea, und zwar in der mit Endolymphe gefüllten Scala media. Der obere Raum der Cochlea heißt Scala vestibuli und der untere Raum heißt Scala tympani; beide sind mit Perilymphe gefüllt.
Betrachten wir zunächst das Mittelohr; zwischen dem Trommelfell einerseits und dem ovalem Fenster der Cochlea an der Scala vestibuli andererseits vermitteln die Gehörknöchelchen: Hammer, Amboß und Steigbügel. Warum? 98% der Schallenergie werden beim Übergang von Luft in Flüssigkeit (Perilymphe) reflektiert. Die Gehörknöchelchen dienen einer Kompensation des Verlustes an Schallenergie. Insgesamt werden 44% dieses Verlustes kompensiert durch das Flächenverhältnis und die Hebelwirkung der Knöchelchen.
Die Funktion des Corti-Organs kann man sich am besten an einer schematisch entrollten Schnecke klarmachen. Die Basilarmembran hat beim Menschen eine Länge von 22-30 mm. Ihre mechanische Nachgiebigkeit nimmt vom Helikotrema in Richtung ovalem Fenster stetig ab. Diese besonderen physikalischen Eigenschaften führten zur Aufstellung von zwei Hör-Hypothesen:
Resonator-Hypothese. Hermann von Helmholtz (1863) postulierte, dass die Basilarmembran Eigenschaften unterschiedlicher Resonatoren besitzt; jene schwingen, einer Saite ähnlich, wenn die Schallfrequenz der Eigenfrequenz des Resonators entspricht. Damit würden Töne unterschiedlicher Höhe die Haarzellen der Basilarmembran an unterschiedlichen Stellen reizen: hohe Töne in Richtung ovales Fenster (Mensch: 16 Hz) und tiefe in Richtung Helikotrema (20kHz). Diese Hypothese musste jedoch abgelehnt werden, weil die Phasenverschiebung zwischen Schall und Resonatorschwingung theoretisch 1 pi ist, empirisch jedoch zwischen Schall und Schwingungsmaximum der Basilarmembran bis zu 3 pi gemessen wurden.
Wanderwellen-Theorie. Georg von Bekesy (1954) konnte nachweisen, dass die Basilarmembran aufgrund ihrer erwähnten physikalischen Eigenschaften durch Schall angeregt wird, nicht zu vibrieren, sondern in Form einer Wanderwelle zu schwingen, deren Amplitudenmaximum – abhängig von der Tonfrequenz – auf der Basilarmembran „wandert“: für hohe Töne in Richtung ovales Fenster, für tiefe in Richtung Helikotrema. Im Bereich des Wellenmaximums werden die Stereovilli zwischen Basilarmembran und Tektorialmembran optimal geschert. Solange man sich diese Wanderwellen im Schema veranschaulicht, sieht das ganze ja recht plausibel aus. Wenn man jedoch bedenkt, dass die maximale Amplitude der Wanderwelle im Bereich der Hörschwelle nur 0,1 nm beträgt [zum Vergleich: Durmesser eines H-Atoms: 0,1 nm = 1 Angström], dann wächst auch hier wieder der Respekt vor biomechanischen Präzisions-Systemen im Nanobereich.
Schnell noch zwei Worte zu den Haarzelltypen, die für das Hören eine Rolle spielen. Es gibt beim Menschen ca. 3500 Innere Haarzellen und 12000 Äußere Haarzellen. Die Inneren zeichnen sich durch starke Divergenz aus, d.h. von einer Haarzelle greifen zahlreiche Dendriten verschiedener Neurone die Signale ab; diese Haarzellen dienen vermutlich der Schallmusteranalyse. Die Äußeren Haarzellen zeichnen sich durch starke Konvergenz aus, d.h. der Dendritenbaum eines Neurons greift Signale von zahlreichen Haarzellen ab; diese Haarzellen sind für die Schallempfindlichkeit geeignet.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zum Thema Homologie und Analogie von Schall-übertragenden Strukturen (wobei es sich also im wahrsten Sinne des Wortes um eine „Reizleitung“ handelt). Da bietet sich zunächst ein Vergleich an zwischen den Gehörknöchelchen der Säuger und der Amphibien. Hammer, Amboss und Steigbügel der Säuger, sowie die Columella der Amphibien erweisen sich als Abkömmlinge von Schädelknochen und sind diesen damit homolog. Der Steigbügel der Säuger und die Columella der Amphibien sind Abkömmlinge des Hyomandibulare und damit einander homolog. – Es gibt ein analoges System für Schallübertragung bei Fischen unter den Ostariophysi (z.B. Elrizen), in dem mangels Trommelfell von der Schwimmblase aus Schallwellen zum Innenohr mittels drei Paar Weberscher Knöchelchen (Hebel, Regulator, Deckel) geleitet werden. Diese Knöchelchen sind Abkömmlinge der ersten drei Halswirbel und damit jenen homolog. Gehörknöchelchen und Webersche Knöchelchen sind einander analog.
Der letzte Themenkomplex des heutigen Blocks ist ausgewählten Beispielen der Bioakustik gewidmet. Woran erkennen weibliche Frösche die Paarungsrufe ihrer Männchen? In den vom Männchen ausgesandten Quaklauten spielen bestimmte hochfrequente und niederfrequente Töne eine kritische Rolle, die den Sacculus des Innenohrs ansprechen: relativ tiefe Töne erregen die Papilla amphibiorum und relativ hohe Töne erregen die Papilla basilaris. Für die Paarungsruf-Erkennung kommt es auf die Kombination (Koinzidenz) der nieder-und höherfrequenten Töne an, beim Ochsenfrosch sind es 250Hz & 1450Hz. Entsprechende Empfindlichkeiten zeigen die Tuning-Kurven der Hörneurone der Papilla amphibiorum bzw. der Papilla basilaris. Hier ist ein entsprechender Genus- bzw. Spezies-Vergleich:
- Ochsenfrosch Rana catesbeiana: 250Hz & 1450Hz
- Leopardenfrosch Rana pipiens: 300Hz & 1700Hz
- Baumfrosch Hyla cinerea: 900Hz & 3000Hz
- Grillenfrosch Acris crepitans: 500Hz & 2500Hz [South Dakota]
- 500Hz & 3000Hz [Texas]
- 500Hz & 3550Hz [New Yersey]
- 500Hz & 4100Hz [Georgia]
Interessanterweise unterscheiden sich die Paarungsrufe von Grillenfröschen in der Hochtonkomponente je nach geographischer Rasse.
Ein anderes Kapitel der Bioakustik beschäftigt sich mit der Frage: wie orientieren sich Fledermäuse mit Hilfe von Ultraschall? Angenommen, eine Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum sitzt vor einem Objekt, das sie anfliegen will. Dazu sendet sie mit ihrer Nase Ultraschall aus von 83,3 kHz; in ihrem Hörsystem befinden sich Filter, die an diese Frequenz angepasst sind, denn die reflektierte Echofrequenz entspricht genau 83,3 kHz. Jetzt möchte sie zum Ziel hinfliegen; das ist akustisch gesehen prinzipiell nicht unproblematisch, denn infolge des Doppler-Effektes würde die Echofrequenz beim Zielanflug ansteigen und von ihrem 83,3Hz-Hörfilter nicht mehr wahrgenommen werden können.
_______________________________________________________________
Kennen Sie den Doppler-Effekt? Doppler-Effekt entdeckt von Christian Doppler (1842):
Eine mit der Geschwindigkeit v bewegte Schallquelle sendet Schallwellen der Frequenz f aus (Schallgeschwindigkeit v*). Dann ist die von einem Empfänger registrierte Frequenz F
F= f/(1+v/v*) erhöht bei Annäherung zum Empfänger
F= f/(1–v/v*) verringert bei Entfernung vom Empfänger
(a) Beispiel aus der Mechanik: Rudern auf einem Surfbrett: Wellen treffen das Surfbrett während des Ruderns gegen den Strom in höherer Frequenz als in Ruhe.
(b)Beispiel aus der Akustik: Martinshorn nimmt in der Tonhöhe zu, wenn der Wagen naht und nimmt in der Tonhöhe ab, wenn der Wagen sich entfernt.
(c) Beispiel aus der Optik: Das Licht eines sich vom Sonnensystem entfernenden Sterns ist zu längeren Wellenbereichen (rot) und eines sich nähernden Sterns zu kürzeren (blau) verschoben.
_______________________________________________________________
Unsere Fledermaus kennt den Doppler-Effekt und senkt daher – zwecks Dopplereffekt-Kompensation – die Frequenz ihrer Ortungslaute während ihres Ziel-Anflugs jeweils gerade soweit, dass die Echofrequenz im schmalbandigen Bereich ihres 83,3kHz-Filters empfangen werden kann. Aus eventuellen Abweichungen kann sie sogar ihre eigene Fluggeschwindigkeit messen. Die nächste Folie zeigt, dass sowohl die mechanischen Eigenschaften ihrer Basilarmembran als auch die neuronale Empfindlichkeit ihres Hörsystems auf die 83,3kHz Ortungsfrequenz angepasst sind. Abschließend erleben wir in einer Animation wie eine Fledermaus mit – im Anflug – erheblicher Flügelspannweite ein 14cm-Maschennetz aus Nylonfäden von 80 um Stärke erkennen und – mit zusammengefalteten Flügeln – problemlos durchfliegen kann.
Das wa’s für Block10, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
______________________________________________
Block11: Muskelphysiologie
Querstreifung, Myosin/Aktin-Interaktion; IP3, Ca2+ Starter, ATP; Typ I/II-Myosine; Motorische Endplatte; Tetanus; Reflexbögen (vegetativ/somatisch)
______________________________________________
vgl. Abbildungen Block 11
Fragen zu Block 11:
• Skelettmuskel: Aus welchen Funktionsstrukturen besteht er?
• Sarkomer: Wie erklärt sich die Querstreifung?
• Wie werden die Interaktionen zwischen Myosin und Aktin gestartet?
• Wie verändert Ca2+ als Starter die räumliche Zuordnung zwischen Myosin und Aktin?
• Welche Rolle spielt ATP bei den Greif/Loslass-Zyklen zwischen Myosin und Aktin?
• Was versteht man unter elektro-mechanischer Kopplung? Woher stammen die Ca2+ Ionen?
• Wie funktioniert die motorische Endplatte (Muskelsynapse)?
• Motorische Endplatte: Wie lässt sich die neuro-muskuläre Übertragung pharmakologisch blockieren?
• Nervengifte: Welche Substanzen - und deren Wirkungen - sollte man kennen?
• Zusammenfassung: Welche Prozesse im Muskel sind von ATP abhängig?
• Vergleichende Betrachtung: Bei welchen Zelltypen - beispielsweise - kann Ca2+ als Mediator in unterschiedliche Funktionen eingebunden sein?
• Krafttraining: Wozu ist die Muskelfaser vielkernig, und worauf beruht Muskelaufbau?
• Sportarten: Worauf beruht das Verhältnis zwischen langsamen und schnellen Muskelfasern?
• Zwei Muskel-Typen im Vergleich: Worin unterscheiden sich Skelett- und Herzmuskel im Kontraktionsverhalten?
• Muskelzuckung vs Muskelbewegung: Was versteht man unter tetanischer Kontraktionsweise?
• Fremreflex vs Eigenreflex: Wie sind Rezeptoren und Effektoren miteinander verschaltet?
• Eigenreflex: Welche Aufgaben haben Sollwert-Regelung und Sollwert-Verstellung?
• Vergleich: Worin unterscheiden sich somatische und vegetative Reflexbögen?
• Vergleich: Worin unterscheiden sich die drei Muskel-Haupttypen?
• Elektrisches Organ von Hochspannungs-Fischen: Wie leitet sich dieses Organ von quergestreifter Muskulatur ab?
.
Meine Damen und Herren,
Sinneszellen sind neurogene Zellen, die auf Außenreize hin ihr Membranpotenzial ändern und zugeordnete Signale an Neurone weiter geben: auf diese Weise gelangt Information in das Nervensystem. Heute begrüße ich Sie zu Block11: Muskelphysiologie. Muskelzellen/fasern sind neurogene Zellen, bei denen eine Depolarisation ihrer Zellmembran zur Gestaltänderung der Zelle/Faser führt, sprich „Kontraktion“: Muskelkontraktionen, und die damit einhergehenden Bewegungen, stellen eine Möglichkeit dar, wie Information das Nervensystem verlässt.
Zum Menü. Im Mittelpunkt unseres Interesses steht wieder die Wirbeltiermuskulatur: Quergestreifter Skelettmuskel, glatter Muskel, Herzmuskel. Wie kommt die Querstreifung zustande? Wie ist sie morphologisch begründet? Welchen Bezug hat sie zur Funktion? Welche Rolle spielen die Motorproteine Aktin und Myosin? Was bewirken die verschiedenen Myosin-Typen? Warum ist die Muskelfaser vielkernig? Gibt es einen Bezug zu Body Building? Worin bestehen die Besonderheiten der motorischen Endplatte? Was versteht man unter tetanischer Kontraktionsweise? Wozu gibt es verschiedene Reflexbögen?
Wir beginnen mit dem quergestreiften Skelettmuskel und fragen zunächst: wie ist er aufgebaut? Aus welchen Funktionseinheiten besteht er? Oben in der Folie ist grobschematisch ein Stück Muskelfleisch skizziert, bestehend aus Muskelfaserbündeln. Ein solches Muskelfaserbündel besteht aus Muskelfasern, also den zellulären Grundeinheiten. Eine Muskelfaser stellt morphologisch ein Syncytium dar: dies bezeichnet eine mehrkernige (polyenergide) Zelle. Syncytien können durch Verschmelzung von mehreren Einzelzellen entstehen. Diese Vielkernigkeit spielt, wie wir später sehen werden, beim Muskelaufbau durch Training eine wichtige Rolle. Eine Muskelfaser ihrerseits besteht aus Myofibrillen. Dies sind kompakte Einheiten, die sich aus Myofilamenten, den Proteinsträngen Aktin und Myosin, zusammensetzen. Muskelkontraktion beruht auf der Interaktion zwischen Myosin und Aktin, – in Anwesenheit von Calzium-Ionen und ATP. Bevor wir uns den funktionellen Aspekten zuwenden, noch ein paar Worte zur geordneten Feinstruktur. Wir sehen hier ein der Histologie real nachempfundenes Bild. Die Myofibrillen sind in der Vertikalen periodisch gegliedert in sog. Sarkomere, die ihrerseits systematische Querstreifungen aufweisen.
Die Feinstruktur eines Sarkomers lässt sich am besten anhand eines Schemas erläutern. Sarkomere, durch Z-Scheiben begrenzt, sind morphologische und funktionelle Einheiten, bestehend aus achsenparallelen Myofilamenten Aktin und Myosin. An den Z-Scheiben sind die Aktinfilamente befestigt, gleichsam die achsenparallele, gleichabständige Anordnung des Aktins gewährleistend. Zwischen den Aktinsträngen befinden sich die insgesamt dickeren Myosinfilamente. Auf diesem Ordnungsprinzip – sich teilweise überlappender Filamente –beruht also die Querstreifung: A-Band, H-Band, I-Band. Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen im Längs- bzw. Querschnitt vermitteln uns einen Einblick über die tatsächlichen Verhältnisse, die mit dem Schema im Prinzip gut übereinstimmen.
An den schematischen Bau des Sarkomers anknüpfend, wollen wir jetzt die molekularen Substrukturen der Myofilamente näher betrachten, denn diese bilden die Basis für die Myosin-Aktin Interaktion. Aktinfilamente bestehen aus einer Art Doppelperlenschnur. Dazwischen liegen die insgesamt dickeren Myosinfilamente, deren Elementarstrukturen jeweils aus einem Doppeleierkopf und einem Schwanz bzw. Stiel bestehen. Stellen Sie sich vor, eine im Nano-Bereich geschickt arbeitende Floristin, würde diese Myosineinheiten – wie einen Strauß aus Weizenähren – kunstvoll binden, dann käme etwa solch ein Geflecht zustande. Hinzu kommt ein zweiter Strauß und zwar so orientiert, dass die Stiele beider Sträuße aufeinander stoßen: dort, käme es zu einer Verdickung, die im Myosinstrang den Namen Titin trägt. Im elektronenmikroskopischen Bild lassen sich jene Verdickungen, die Myosindoppelköpfe und die Aktinperlschnüre gut erkennen.
Bereits jetzt sei erwähnt, dass die Myosin-Eierköpfe beweglich sind, sich – durch Vermittlung von Calzium-Ionen – an die Aktinkugeln anheften und durch ihre Beweglichkeit die Aktinmolekülkette jeweils ein Stück weit über sich hinweg ziehen können: so kommt es zu einer teleskopartigen Gleitbewegung zwischen Aktin und Myosin und damit zur Verkürzung der Sarkomere als Grundlage für die Kontraktion der Muskelfaser. Darauf werden wir später noch näher eingehen.
Vorerst die Frage: welche Rolle spielen denn die Calzium-Ionen für die Anheftung von Myosin an Aktin? Diese Frage ist gleichbedeutend mit: wie wird die Myosin-Aktin Interaktion durch Calzium-Ionen gestartet? Dazu muss man sich den Aufbau der Aktinperlenschnur genauer anschauen. Diese windet sich nämlich um ein lang gestrecktes Stück Regulator-Protein, genannt Tropomyosin. An jenen Stellen, wo die Tropomyosine zusammenstoßen, sitzt ein kürzeres Schalt-Protein, genannt Troponin. Nun müssen Sie sich vorstellen, dass Myosin zum Aktin ein hohes Bindungsbestreben hat, d.h. Myosin möchte an Aktin „liebend gern“ andocken. Das wird jedoch durch Tropomyosin sterisch verhindert. Erst durch die Bindung von Calzium-Ionen an den Troponin-Schalter wird eine sphärische Konfiguration geschaffen, die das Tropomyosin in eine räumliche Lage bringt, die das Andocken ermöglicht. Das lässt sich besonders gut im Querschnitt verfolgen. Calzium-Ionen binden an den Troponin-Schalter, woraufhin die Tropomoysine zwischen die Aktinkugeln rutschen und das Andocken von Myosin an Aktin erlauben. Der Vorgang ist reversibel.
Mit Hilfe von ATP kommt jetzt Bewegung ins Spiel, in deren Verlauf Myosin das Aktin um 10 nm über sich hinweg zieht. Während dieses Greif-Loslass-Zyklus findet folgendes statt:
- ATP-Aufnahme durch Myosin, Loslassen
- Kopfaufrichten; unter der ATPase-Wirkung des Myosinkopfes wird die freiwerde Energie dazu genutzt, den Myosin-Kopf aus seiner energiearmen 45°-Stellung in die aufrechte energiereiche 90°-Stellung zu bringen. ATP ist gespalten, die Spaltprodukte bleiben aber noch am Kopf.
- Sodann kommt es zum Greifen: Myosin dockt an Aktin an.
- Nach dem Greifen wird die in der 90°-Stellung gespeicherte Energie – durch Übergang in die 45°-Stellung – dazu verwendet, das Aktin um 10 nm über das Myosin hinweg zu ziehen. Der Zyklus wiederholt sich von neuem.
Unter dieser Internetadresse (Stand: 2006) finden Sie eine instruktive Animation der an den Greif-Loslass-Zyklen beteiligten Komponenten:
http://www.tekonline.org/c-o-n-t-e-n-t-s/SCIENCE_WORLD/science_world.html
Nur am Rande sei vermerkt, dass Muskel-Nanostruktur-Forscher immer wieder staunen, wie klar und eindeutig in Büchern und Vorlesungen dieser nanomotorische Mechanismus dargestellt wird, wobei Wiedergaben in Lehrbüchern durchaus von einander abweichen. Niemand kann heute beweisen, dass sich dieser Prozess genauso in der hier beschriebenen logisch erscheinenden Sequenz abspielt. Mit Sicherheit kann man lediglich sagen, dass es im Verlaufe eines solchen Greif-Loslass-Zyklus zu einem Wechsel zwischen schwacher Myosin/Aktin-Affinität und starker Myosin/Aktin-Affinität kommt.
Nun aber endlich zur Frage: woher stammen die Calzium-Ionen? Diese dürfen sich ja nicht immer im Bereich der Myofilamente aufhalten. Dann käme es zu Dauerkontraktionen, sprich Muskelkrämpfen. Im schlaffen Muskel sind die Calzium-Ionen in ein Hohlraumsystem eingesperrt, das Sarkoplasmatische Retikulum, SR (dem ER der Neurone homolog); wer lässt die Calzium-Ionen aus diesem intrazellulären SR-System heraus?
Soll Muskulatur kontrahiert werden, etwa „bewege deinen Arm“, dann werden über den motorischen Nerven (Motoraxon) Aktionspotenziale zur Muskelsynapse (motorische Endplatte), geleitet: es folgen Vesikelexozytose –> Ausschüttung des Neurotransmitters Acetylcholin –> EPSP (=Endplattenpotenzial) –> Muskel-Aktionspotenzial, AP.
Frage: wie können Muskel APs dazu führen, dass die Membran des SR für Calzium-Ionen permeabel wird? Dazu muss man etwas über den Bau der Muskelfaser wissen. Die Muskelfasermembran setzt sich nämlich jeweils auf der Höhe der Z-Scheiben röhren- bzw. tubenförmig in das innere der Muskelfaser fort, um dort an die Membran des SR-Systems zu grenzen (transversaltubuläres System). Zur Beantwortung der oben gestellten Frage: die Muskel APs pflanzen sich entlang der Muskelfasermembran über das transversaltubuläres System bis zum SR-System fort und führen dort zur Freisetzung von IP3. Dieser Mediator dockt an die SR-Membran und öffnet Calzium-Ionenkanäle, so dass Calzium-Ionen im Austausch gegen Magnesium-Ionen das SR verlassen, zu den Myofilamenten diffundieren und die Myosin-Aktin Interaktion starten: die Muskelfaser geht dann aus dem Zustand der Erschlaffung in den Zustand der Kontraktion über.
Die nächste Folie zeigt in einer Übersicht die Funktion einer motorischen Endplatte; die synaptische Übertragung wird vermittelt durch Acetylcholin, ACh. Bei der motorischen Endplatte handelt es sich durch Aus- bzw. Einstülpungen der prä- bzw. postsynaptischen Membran um eine Riesensynapse mit enormer synaptischer Oberfächenvergrößerung. Wir verfolgen dies in einer EM-Aufnahme. Diese Oberfläche gewährleistet, dass ein im Motor-Axon geleitetes AP zu einem Muskel-AP führt und über IP3 soviel Calzium-Ionen aus dem SR mobilisiert, dass die Muskelfaser mit einer Einzelzuckung reagiert (gemäß der alles-oder-nichts Regel). In dieser elektromechanischen Ankoppelung besteht zwischen Motor-AP und Einzelzuckung eine 1:1 Beziehung.
Wie kann die neuromuskuläre Übertragung blockiert werden? Sie werden sich sagen, bitte nur nicht das, dann können wir uns nicht mehr bewegen und auch nicht mehr atmen, denn die Atmungsmuskulatur ist ja ebenfalls quergestreift. Die alten Indianer kannten den Effekt ihres Pfeilgifts bestehend aus Curare, gewonnen aus Chondodendron-Blättern. Gelangt Curare über den Blutkreislauf zu den motorischen Endplatten, dann blockiert es dort die Ach- Rezeptoren, so dass keine Na+ Kanäle durch Ach geöffnet werden können. Infolgedessen kann die Endplattenmembran nicht mehr depolarisiert werden: Lähmung und Tod durch Ersticken sind die Folge.
Übrigens Agatha Cristie beschreibt in einem ihrer Romane eine Szene, in der der betrogene Ehemann seine wohlhabende Gattin mit einem Curare enthaltenen Schlummertrunk umgebracht hat. Hier hat Frau Cristie neuropharmakologisch nicht korrekt recherchiert, denn Curare wirkt effektiv nur über die Blutbahn, kaum dagegen per Os. Dennoch rate ich niemanden, dies auszuprobieren.
Curare spielt eine wichtige Rolle in der Medizin. Stellen Sie sich vor, der Chirurg soll eine Operation am Bein eines Patienten durchführen, die relativ kompliziert ist, und daher unter Narkose durchzuführen ist. Der Patient wird dann zunächst narkotisiert. Sodann erhält er ein Analgetikum. Da in diesem Zustand die Reflexe funktionieren, wäre es für den Chirurg unangenehm, wenn der Patient während der Operation reflektorisch mit den Beinen ausschlägt. Folglich muss der Patient stillgelegt, d.h. seine Muskulatur relaxiert werden, und das geschieht durch Injektion von Curare. Vorher muss der Patient künstlich beatmet werden, denn Curare lähmt auch die Atmungsmuskulatur. Nach der Operation soll der Patient möglichst schnell wieder zu sich kommen und mobil werden. Die Curarewirkung hält aber ziemlich lange an. Also spritzt man als indirekten Antagonisten eine Substanz namens Prostigmin. Die Aufgabe von Prostigmin besteht nun darin, die Ach-Esterase zu inaktivieren, auf diese Weise die ACh Wirkung zu stimulieren und somit Curare durch kompetitive Hemmung von den Ach-Rezeptorplätzen zu vertreiben.
In diesem Zusammenhang ist eine Liste über Nervengifte informativ; eine Auswahl habe ich für Sie in dieser Folie zusammengestellt nach den Kriterien: Gift, Vorkommen, Wirkung Bedeutung und Wirkungsort.
Die folgende Übersicht zeigt, wo ATP überall bei der Muskelkontraktion eine Rolle spielt:
- Energielieferant für das Aufrichten bzw. Ziehen des Myosinkopfes.
- Weichmacherwirkung bei der Trennung zwischen Aktin und Myosin für die Muskelerschlaffung.
- Kombinierte Calzium/Magnesium-Pumpe für den Rücktransport von Calziumionen in das SR-System.
- Kombinierte K+/Na+ Pumpe für die Aufrechterhaltung des Muskelmembran- Ruhepotenzials.
Wie aber verhält sich die Muskulatur bei ATP-Mangel?
(a) Wadenkrampf: rel. hohe Calziumionen-Konzentration infolge eines ATP-Defizits bei Durchblutungsstörungen; rel. starke Aktin-Myosin Affinität; ineffiziente Calzium/Magnesium-Pumpe; gestörte Weichmacherwirkung [Therapie: Massieren, Dehnen, Magnesium-Präparat einnehmen].
(b)Totenstarre: sehr hohe Calziumionen-Konzentration mangels ATP; kombinierte Calzium/Magnesium-Pumpe funktioniert nicht; sehr starke Aktin-Myosin Affinität; keine Weichmacherwirkung.
(c) Catch-Mechanismus: z.B. Sperrtonus der Schalen bei der Miesmuschel. Hierbei handelt es sich um einen stoffwechselphysiologisch ökonomische Verschluss der Muschelschalen für Stunden durch starke Aktin-Myosin Affinität infolge hoher Calziumionen-Konzentration und wenig ATP. Hier wird also die ATP-Defizit bedingte Aktin-Myosin Bindung biologisch genutzt. – Weinbergschnecken setzen solch einen Catch-Mechanismus für die Kontraktion ihres Penis bei der Paarung ein. Calziumionen wären demnach für impotente Weinbergschnecken wie „Viagra“ (;–) [von den verschiedenen Erektionsmechanismen einmal abgesehen].
_______________________________________________________________
Bevor wir uns gleich dem Kraftsport widmen, möchte ich Sie noch mit einer vergleichenden Übersicht erfreuen, die Ihnen zeigt, wo und wie Calziumionen als Mediatoren für ganz unterschiedliche Funktionen eine Rolle spielen können:
(1) Einstrom extrazellulärer Calziumionen in das Zytoplasma für die Vesikel-Exozytose im Neuron.
(2) Ausstrom intrazellulärer Calziumionen aus dem ER in das Zytoplasma für die Vesikel-Exozytose in einer primären Sinneszelle (Schmeckzelle für die Empfindung „bitter“).
(3) Ausstrom intrazellulärer Calziumionen aus dem SR in das Zytoplasma für den Start der Aktin-Myosin Interaktion in der Muskelfaser.
_______________________________________________________________
Jetzt wollen wir uns endlich mit Krafttraining, Body Building und Sportarten beschäftigen. Worauf beruht der Muskelaufbau? Zur Einstimmung zeige ich Ihnen einen kurzen Video-Clip: Waschbrettbauch ist schon OK, man(n) kann es aber auch beim Muskelaufbau übertreiben.
Zum Verständnis des Folgenden müssen wir etwas mehr über den Bau der Muskelfaser wissen. Zunächst ein paar Zahlen: Muskelfasern können 100 um dick werden und können bei solcher Dicke etwa 30cm lang sein. Eine Faser besitzt mehrere 1000 Zellkerne. Wir werden gleich sehen, wofür so viele Kerne gut sind. Diese Zellkerne sind nicht teilungsfähig. Ich will gleich an dieser Stelle fragen [beliebte Prüfungsfrage (;-)] wozu die vielen Zellkerne? OK, morphologisch bedingt, Syncytium etc. Schön und gut, aber soll das bedeuten, dass man an der Anzahl der Zellkerne ablesen kann, wie viele Zellen sich zum Sycytium verschmolzen haben? Die Frage wird sich gleich von selbst beantworten. Aber welchen Vorteil hat die Vielkernigkeit der quergestreiften Skelett-Muskelfaser im Vergleich zur einkernigen glatten Eingeweide-Muskelzelle. Es muss wohl etwas mit der Kraftentwicklung zu tun haben, die z.B. für den Stabhochsprung höher ist als etwa für die Darmperistaltik. Zur Kraftentwicklung in der Skelett-Muskulatur sind Proteinfilamente, die Myofilamente – unter ihnen speziell das Myosin – erforderlich. Und für die Proteinsynthese ist der Zellkern zuständig: also, je mehr Zellkerne, desto mehr Myofilamente können produziert werden, desto stärker legt der Muskel an Dicke zu. Wir werden gleich sehen, wie durch Training die Anzahl der Zellkerne in der Muskelfaser noch weiter erhöht werden kann. Für Eingeweidemuskulatur ist Muskelaufbau wohl entbehrlich.
Tausende von Myofibrillen sind in einer Muskelfaser lokalisiert. Es gibt rel. langsam kontrahierende Muskelfasern mit Typ-I Myosin, rel. schnell kontrahierende mit Typ-II Myosin und mittelschnell kontrahierende Muskelfasertypen. Die beiden Myosin-Typen I und II unterscheiden sich in der Geschwindigkeit der ATP-Spaltung. Dementsprechend eignet sich Myosin-I mehr für Ausdauersport wie Langstreckenlauf (aerober Stoffwechsel) und Myosin-II für Kraftsport wie Sprinten oder Heben (anaerober Stoffwechsel). Je mehr Muskelmasse, desto besser der Sportler? Nein, wir müssen differenzieren, denn es gibt nicht den Sportler. Marathonläufer bestehen im Grunde genommen aus einem Skelett mit wenig Muskelmasse, aber mit viel Anteil an Myosin-I, während Gewichtheber von starker Muskelmasse und viel Anteil an Myosin-II profitieren. Übrigens, unter bestimmten Trainingsbedingungen können die Myosin-Typen ineinander umgewandelt werden.
Wir kommen zum Training. Muskelmasse erhöht sich nicht infolge Vermehrung (Teilung) von Muskelfasern, sondern aufgrund von Proteinsynthese für Myofilamente mit entsprechender Verdickung der Myofibrillen. Durch Training kann sich Muskelmasse verdoppeln bis verdreifachen; durch Ruhe (zwei Wochen Gipsverband) kann sich Muskelmasse um 1/5 reduzieren. Zunächst zur Frage: welches sind die Auslöser für Muskelwachstum?
Mechanische Beanspruchung setzt eine Kaskade von Signalproteinen in Gang, die zur Aktivierung des MGF (mechano-growth-factor) führt, der wiederum über Genaktivierung die Synthese der Proteine Aktin und Myosin auslöst.
Mikroläsionen der Muskelfasern entstehen bei starker Beanspruchung der Muskulatur, z.B. während Krafttraining. Diese Mikroläsionen sind Auslöser dafür, dass sich Satellitenzellen der Muskulatur teilen, um (1.) die Mikrorisse der Muskelfaser zu reparieren und (2.) sodann „als Trostpflaster“ auch noch ihren Zellkern der Muskelfaser spenden. Solche Kernspenden erhöhen die Proteinsynthese für Myofilamente.
Doping kann auf verschiedene Weise die Muskelmasse bzw. den Anteil an Myosin-II erhöhen. Androgene beispielsweise regen die Myofilament-Synthese an. Auf die bekannten schädlichen Nebenwirkungen brauche ich nicht näher einzugehen.
Beleben wir nun die alte Frage: wie kommt es zum Muskelkater? In der Schule haben vermutlich viele unter Ihnen gelernt, dass das mit der Milchsäuregährung der vorangegangenen Trainingseinheit zusammenhängen soll. Muskelkater beruhe demnach auf Übersäuerung. Diese „Laktat-Hypothese“ ist obsolet. Warum?
Fakten zur anaerob-laktaziden Energiebereitstellung: Bevor die Vorräte an ATP verbraucht sind, wird bereits nach einigen Sekunden die nächst schnellere Variante des Energiestoffwechsels genutzt, die anaerob-laktazide Energiebereitstellung durch Abbau von Glukose, und zwar immer dann, wenn nicht genug Sauerstoff zur Energiegewinnung zur Verfügung steht. Diese Energieausbeute ist jedoch gering, da das Zuckermolekül nicht vollständig zerlegt wird. Es entsteht Laktat als Salz der Milchsäure. Je intensiver die anaerobe Muskelarbeit, umso höher die Laktatbildung. Irrtum: Je höher die Laktatbildung, umso heftiger der Muskelkater infolge "Übersäuerung". Haupt-Gegenargument zur Laktat-Hypothese des Muskelkaters: Die Halbwertszeit von Milchsäure beträgt ca. 20 min. Muskelkater tritt aber erst nach 12 bis 48 Stunden auf, d.h. lange nachdem sich der Laktatspiegel im Blut wieder normalisiert hat.
Mikrotraumen-Hypothese. Nach heutigem Stand der Kenntnis bestehen die Ursachen für Muskelkater aus winzigen Mikroläsionen in den Z-Scheiben sowie kleinen Verletzungen von winzigen Blutgefäßen im Muskel. Diese führen zu einem lokalen Entzündungsprozess. Dadurch verspannt sich die Muskulatur, und das führt zu Schmerzen bei der Muskelkontraktion. Wenn man unter Muskelkater trainiert, besteht die Gefahr von Muskelfaserrissen (die nicht mit den oben beschriebenen Mikroläsionen verwechselt werden dürfen). Daher sind zu Beginn jeder Sportart Muskelaufwärme-Phasen wichtig. Auf das Pro und Kontra der neuen Muskelkater-Hypothese einzugehen, würde den Rahmen dieser Vorlesung sprengen.
Wollen wir lieber noch etwas bei den verschiedenen Myosin-Typen verweilen. Wir erinnern uns noch, dass schnell kontrahierendes Myosin-II für Kraftsport zuständig ist, und ich fügte hinzu, dass sich durch Phasen starken und reduzierten Trainings der Anteil an Myosin-II durch Umwandlung der Myosin-Typen verändern kann. Das bedeutet: nach starkem Krafttraining können durch eine anschließende Phase reduzierten Trainings besondere Trainingseffekte erzielt werden. Beispiel: während 3-monatigen Krafttrainings nimmt Myosin-II prozentual ab zu Gunsten des mittelschnellen Myosin-Typs verbunden mit einer Vergrößerung der Muskelmasse. Während einer anschließenden Phase reduzierten Trainings nimmt der Anteil an Myosin-II drastisch zu und erreicht ein Maximum – weit über dem Ausgangswert – nach etwa zwei Monaten. Dann kann der Wettkampf beginnen, denn 1.) hat die Muskelmasse zugenommen und 2.) hat eine prozentuale Steigerung des Anteils an Myosin-II stattgefunden.
Intervall-Training ist also sowohl für sportliche als auch für geistige Betätigung optimal, wenn auch aus verschiedenen Gründen.
Wie sieht es mit der Muskulatur im Alter aus? Muskelschwund beruht auf der Abnahme von Muskelfasern, die bekanntlich nicht nachwachsen, deren Verlust jedoch durch Training-bedingte dickere Myofibrillen kompensiert werden kann. Zudem verschiebt sich das Verhältnis der Myosin-Typen zu Gunsten Myosin-I und des Myosin-Mischtyps. Beispiel: ein 10-jähriger Junge überholt seinen Großvater im 100-m Sprint, jedoch nicht unbedingt im Mittelstreckenlauf.
Wir wollen uns jetzt mit dem Kontraktionsverhalten der quergestreiften Skelett-Muskulatur beschäftigen. Die Folie zeigt schematisch das Rückenmark im Querschnitt und ein Motorneuron, dessen Axon mit Hilfe eines Stimulators elektrisch gereizt wird, das daraufhin mit einem AP antwortet, welches seinerseits eine Einzelzuckung der Muskelfaser auslöst.
Die Grafik zeigt über der Zeitachse den reziproken Wert 1/l der Muskelfaserlänge (l), also den Verlauf der Kontraktion während der Kontraktionszeit (tk). Frage: nach welcher Zeit ab Reizbeginn kann eine Kontraktion erneut ausgelöst werden? Das hängt von der Refraktärzeit (tr) der Muskelfaser ab. Diese ist wesentlich kürzer als die Kontraktionszeit:
tr << tk
d.h. tr ist lange abgeklungen, bevor die maximale Kontraktion erfolgt ist. Wenn nach Ablauf von tr ein weiteres AP im Motoraxon ausgelöst wird, überlagert die zweite Kontraktion die erste. Bei entsprechender Sequenz von APs resultiert eine Superposition der Muskelkontraktionen: man nennt dies tetanische Kontraktion. Das werden wir gleich noch näher beleuchten.
Zunächst wollen wir zum Vergleich das Kontraktionsverhalten des quergestreiften Herzmuskels verfolgen. Der rhythmische Herzschlag beruht auf Schrittmacher-Zentren – Sinus-Knoten, AV-Knoten, Hiss-Bündel – von denen der Sinus-Rhythmus normalerweise dominiert. Dieser Rhythmus kann durch Nerven des vegetativen Nervensystems – Sympathicus und Parasympaticus – beeinflusst werden. Wie sieht es mit der Refraktärzeit des Herzmuskels aus? tr überdauert die gesamte Kontraktionszeit
tr > tk
d.h. das Herz kann und darf sich nicht tetanisch kontrahieren. Der Herzschlag besteht immer aus Einzelkontraktionen.
Noch einmal zurück zum quergestreiften Skelett-Muskel. Die Versuchsanordnung kennen wir bereits: Motoneuron, Motoaxon, Elektrostimulation mit einzelnen Impulsen i, Ableitung der axonalen aAPs, Ableitung der Muskelfaser mAPs, Amplitude der Muskelfaser-Kontraktion mK (reziproker Wert). Es sind ta=Zeitabstand der APs, tk=Muskelkontraktionszeit, tr=Muskelrefraktärzeit. Es gilt
i : aAP : mAP : mK = 1 : 1 : 1 : 1
Der Muskel reagiert mit Einzelkontraktionen, wenn
tr < ta > tk
Der Muskel reagiert mit abgestuften, sich überlagernden Einzelkontraktionen (unvollständiger Tetanus), wenn
tr < ta < tk
Der Muskel reagiert mit vollständigem Tetanus, wenn
tr < ta << tk
Fast alle unsere Bewegungen, z.B. eine gerichtete Armbewegung, beruhen auf tetanischer Muskelkontraktion. Denn so wie die Muskelfaser verhält sich der gesamte Muskel.
Wir wollen uns jetzt die Frage stellen, wie Sinnesrezeptoren (Organe), Neurone (ZNS) und Muskeleffektoren (Muskeln) auf einfachste Weise miteinander verschaltet sein können. Das sind die Reflexbögen. Beim Fremdreflex der Wirbeltiere ist z.B. ein Mechanorezeptor der Körperhaut via Spinalganglion über die Verschaltung mehrerer Interneurone mit einem alpha-Motorneuron synaptisch verbunden, dessen Motoraxon Skelettmuskulatur innerviert. Beispiel: Wischbewegung mit der Hand nach einer auf der Haut landenden Fliege. Kybernetisch betrachtet handelt es sich um Steuerung (Auslösung). Fremdreflexe sind polysynaptische Schutzreflexe und unterliegen bei wiederholter Auslösung der Habituation(=Gewöhnung =nichtassoziatives Lernen).
Eigenreflexe sind monosynaptische Reflexe und zeigen daher keine Habituation. Beweis dafür ist das Verhalten der hier abgebildeten Bewegungsstarre-Künstlerin, deren Kunst darin besteht, sich nicht zu bewegen. Nun, das ist gar nicht so einfach wie man zunächst annehmen möchte. Diese Dame muss nämlich während der Starre ständig darauf achten, dass alle ihre Skelettmuskeln eine bestimmte von ihr gewählte Länge konstant halten. Natürlich kann sie sich wieder bewegen und eine andere Starre-Position einnehmen und die zugeordneten Muskellängen regeln. Kybernetisch betrachtet sind Eigenreflexe Regelkreise, die die Länge der Muskulatur auf konstante Sollwerte regeln bzw. für konstante Spannung im Skelett sorgen. Gäbe es diese Regelung nicht, würde unser Skelett wie eine Marionette in sich zusammenfallen.
Was der Bewegungskünstlerin für Geld recht ist, ist der Stabheuschrecke billig, denn sie benutzt Bewegungsstarre als Schutz vor Feinden. Nähert sich ein Feind, wäre es für die langsame Stabheuschrecke sinnlos weglaufen zu wollen. Also macht sie das Gegenteil; sie verfällt in Starre und imitiert auf diese Weise einen für den Feind uninteressanten Zweig (Zweigmimese).
Betrachten wir – im Vergleich zum Fremdreflex – die Verschaltung zwischen Rezeptor, Neuron und Effektor beim Eigenreflex der Wirbeltiere. Der Dehnungsrezeptor befindet sich in Gestalt des Muskelspindelapparats in der Muskulatur (=extrafusale Muskulatur). Die mechanosensorische Sinnesnervenfaser verläuft via Spinalganglion und ist verschaltet (ohne Interneuron) mit einem alpha-Motorneuron, das über sein Motoraxon die extrafusale Muskulatur innerviert. Die Regelung der Muskellänge auf einen konstanten Sollwert geschieht folgendermaßen: wird der Muskel gedehnt (verlängert) – z.B. durch einen Schlag mit dem Reflexhammer auf die Patellarsehne – dann wird dies durch die Muskelspindel registriert und dem alpha-Motorneuron signalisiert, das daraufhin den Muskel zur Kontraktion (Verkürzung) veranlasst. Unsere Bewegungsstarre-Künstlerin ist demnach alles andere als untätig.
Wie wird für die Muskellänge ein neuer Sollwert eingestellt, also, wenn die Bewegungsstarre-Künstlerin eine neue Starreposition einnehmen will. Jetzt wird es kompliziert. Außer den alpha-Motorneuronen gibt es nämlich noch gamma-Motorneurone, die die intrafusale Muskulatur des Muskelspindelapparates innervieren. Durch Kontraktion dieser Muskulatur wird die Muskelspindel vorgedehnt und kann somit ein anderes Signal an das alpha-Motorneuron senden, das einem neuen Sollwert entspricht. Der Befehl hierzu stammt aus dem Gehirn der Bewegungsstarre-Künstlerin zu ihren gamma-Motorneuronen. Wie diese Sollwertregelungen ablaufen können, habe ich für Sie in einigen Schemata dargestellt. Als Beispiel wählen wir die Regelung der Muskellänge auf den Sollwert L(0) bei Dehnung des Muskels auf L(1). Dem Sollwert entspricht eine AP-Folge [1] mit der das gamma-Motorneuron erregt wird. Auf Dehnung des Muskels erhöht sich die Frequenz der AP-Folge der Muskelspindel [2], damit erhöht sich die Frequenz der AP-Folge im alpha-Motorneuron [3], und der Muskel verkürzt sich auf die Länge L(0). Sollwertverstellungen und Regelungen der Muskellänge auf verstellte Sollwerte sind von diesem Schema leicht ableitbar.
Abschließend ein Vergleich zwischen somatischem Fremdreflexbogen und vegetativem Reflexbogen. Den somatischen kennen wir bereits; der vegetative – der die Eingeweide-Muskulatur aktiviert – verläuft nicht nur über das Rückenmark, sondern ist zudem mit den Grenzstrangganglien des vegetativen Nervensystems verschaltet: Eingeweiderezeptoren verlaufen über das Spinalganglien zu Neuronen des Rückenmarks, die ihrerseits ein Neuron des Grenzstrangganglion aktivieren. Von jenem aus kann dann jeweils die Eingeweidemuskulatur innerviert werden und zwar cholinerg durch den Parasympathicus oder adrenerg durch den Sympathicus.
Die Interaktion zwischen vegetativen und somatischen Reflexbögen lässt sich an einem Beispiel veranschaulichen: unser Kind hat Bauchschmerzen. Bauchschmerzen entstehen durch krampfartige peristaltische Bewegungen der Magen/Darm-Muskulatur. Das Schmerz-Signal von der Darmwand wird an das Gehirn und an alpha-Morneurone des somatischen Reflexbogens geleitet, die die Bauchmuskulatur zur Kontraktion bringen, und dies ist sehr schmerzhaft. Ein altes Hausmittel gegen Bauchschmerzen ist ein feuchtwarmer Umschlag. Die zugeordneten thermosensorischen Signale können über Interneurone des Rückenmarks im vegetativen Reflexbogen adrenerge Neurone der Grenzstrangganglien erregen, deren Axone durch Auschüttung von (Nor)adrenalin die kontrahierte Darm-Muskulatur hemmen und dadurch entkrampfen, so dass die Bauchschmerzen verschwinden.
In der folgenden Tabelle habe ich für Sie die verschiedenen Merkmale der drei Hauptmuskeltypen der Wirbeltiere zusammengestellt.
Ganz zum Schluss gönnen Sie mir bitte noch 5 Minuten, um Ihnen zu zeigen, wie sich das elektrische Organ der Hochspannungsfische von quergestreifter Skelett-Muskulatur ableitet. Betrachten wir zunächst ein Muskelfaser-Bündel: mehere Muskelfasern werden von einem Motoraxon über Axonkollaterale innerviert; man nennt dies „motorische Einheit“. Beim elektrischen Organ werden über Axonkollaterale dementsprechende Elektrozyten (als phylogenetische Abkömmlinge von Muskelfasern) innerviert, die ihre Kontraktionsfähigkeit "verloren haben". Elektrozyten besitzen wie alle neurogene Zellen ein Ruhepotenzial, das wie bei Muskelzellen, mit -84 mV relativ hoch ist. Sobald ein Zitteraal Electrophorus auf Beute trifft, aktiviert er sein elektrisches Organ, das tödliche Stromstöße bis zu 900 Volt aussendet. Wie kommt diese Hochspannung zustande? Betrachten wir zunächst eine Elektrozyte. Im Gegensatz zur Muskulatur wird bei einer Elektrozyte – auch elektrische Platte genannt – eine ganze Membranseite innerviert; nur diese ist elektrisch erregbar, d.h. zur Bildung von APs fähig.
Hinweis: auch bei Muskelzellen, die längere Zeit nicht aktiviert werden, reduzieren und konzentrieren sich die spannungsgesteuerten Na+ Kanäle auf den Innervierungsbereich, d.h. auf den Bereich der Motorischen Endplatte.
Infolgedessen entstehen nur am Innervierungsbereich der elektrischen Platte APs, die diese Membranseite kurzfristig umpolen auf +67 mV im Vergleich zur gegenüberliegenden Membranseite mit – 84mV Ruhepotenzial; das entspricht genau 151 mV pro Platte und für alle Platten in Serie ca. 900 Volt.
Das war’s für Block11, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
______________________________________________
Block12: Verhaltensphysiologie (Neuroethologie)
Neuronenschaltungen, Programmsteuerung (Tritonia); Signal-Erkennung, Auslösemechanismen (Kröte); Motorische Systeme, Parkinsonsche Krankheit (Mensch)
_____________________________________________
vgl. Abbildungen Block 12
Fragen zu Block 12:
• Auslösung einer Verhaltensreaktion: Welche Funktionsmodule sind beteiligt?
• Ansteuerung der Muskulatur durch Impulsmuster-Generatoren: Welche Neuronenschaltungen könnten zugrunde liegen?
• Beispiel 1: Fluchtverhalten der Meeresschnecke Tritonia: Wie wird es ausgelöst und generiert?
• Welche Neuronenschaltung liegt der Fluchtreaktion von Tritonia zugrunde?
• Beispiel 2: Beutefang der Erdkröte Bufo bufo: An welchen Reizmerkmalen wird Beute von Nicht-Beute bzw. Feind unterschieden?
• Mit welchen Verhaltensmustern reagieren Erdkröten auf Feindattrappen?
• Wie wird das Gesichtsfeld im Krötenhirn abgebildet?
• Autoradiografische 14C-2DG-Kartierungen: Welche zentralen Sehzentren sind am Beutefang bzw. Fluchtverhalten beteiligt?
• Welche Korrelationen bestehen zwischen Verhaltensaktivität und visuell neuronaler Entladungsaktivität?
• Wie unterscheiden sich einzelne Neurone histologisch?
• Modellvorstellung: Welche Neuronenschaltungen liegen den Reaktionen auf Beute, Nicht-Beute bzw. Feind zugrunde?
• Wie könnten Schaltpläne (Auslösemechanismen) für Flucht, Beute-Zuwendung bzw. Beute-Schnappen strukturiert sein?
• Wie komplex ist das zentralnervöse Wirkungsgefüge für Beutefang wirklich?
• Beispiel 3: Wie gliedert sich das motorische System des Menschen?
• Ist unser motorischer Cortex auch dann aktiv, wenn wir uns eine eigene Körperbewegung nur vorstellen?
• Krankheiten des motorischen Systems: Worauf beruht Parkinsonismus (Rigor, Akinese, Tremor)?
• Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
· Was versteht man unter Neuroplastizität? Worin besteht ihr medizinisch- therapeutischer Nutzen in Rehabilitationsprozessen? Lassen sich Programme von Neuronenschaltungen, die bestimmten Funktionen gewidmet sind (zum Beispiel Sehen), für andere Funktionen (zum Beispiel Tasten) umprogrammieren?
.
Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie zu Block12, dem letzten Block dieser Vorlesung, und möchte Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse danken. Was die Klausur betrifft, habe ich Erfreuliches mitzuteilen, denn noch nie war ein Klausurergebnis so positiv.
Block12 bildet gewissermaßen die Krönung der Vorlesung. Denn heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie Verhaltensweisen ausgelöst und motorische Muster koordiniert werden. Das ist der Bereich der Verhaltensphysiologie und der von mir mit begründeten Forschungsrichtung Neuroethologie. Mein gleichnamiges, im Springer-Verlag 1976 erschienenes, Buch war das erste auf diesem Gebiet; es ist ins Englische, Japanische und Chinesische übersetzt worden. Im Jahre 1981 organisierte ich zusammen mit meinen amerikanischen Kollegen Robert Capranica und David Ingle an der Gesamthochschule Kassel (so hieß unsere Universität damals noch) das NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE über „Advances in Vertebrate Neuroethology“; auf diesem Kongress wurde die International Society for Neuroethology ISN gegründet. Die Proceedings dieses Kongresses sind unter gleichem Titel bei Plenum Press New York 1983 erschienen.
Zum Menü von Block12: Anhand von drei Beispielen sehr unterschiedlicher Organismen – Meeresschnecke Tritonia, Erdkröte, Mensch – werden wir Neuronenschaltungen kennen lernen, die der Auslösung und Steuerung von Verhaltensweisen zugrunde liegen. Beim Menschen werden wir uns vor allem mit dem komplex gegliederten motorischen System befassen und am Beispiel der Parkinson-Krankheit kennen lernen, wie sich durch Störung der Balance bestimmter Neurotransmitter dramatische Auswirkungen auf die Motorkoordination einstellen und welche Möglichkeiten der Therapie es heute gibt.
Beginnen wir gleich mit der Frage, welche Funktionsmodule für die Auslösung von Verhaltensweisen durch Umweltsignale eine Rolle spielen. Die ersten Verarbeitungsschritte des ZNS bestehen in der Beantwortung „was ist das für ein Signal“ und „wo befindet sich das Signal“; die zugeordneten Funktionsmodule dienen also der Identifikation und der Lokalisation. Voraussetzung dafür, dass dies funktioniert, ist die entsprechende Motivation, denn abhängig von der Motivation (Triebstärke, Stimmung) kann ein und derselbe Umweltreiz durchaus unterschiedlich interpretiert werden. Ein in Paarungsstimmung hoch motiviertes Erdkrötenmännchen klammert im Teich mangels eines greifbaren Erdkrötenweibchens ersatzweise ein Stück morschen Ast, der für das Männchen außerhalb der Laichzeit unbeachtet geblieben wäre. Nicht viel anders geht es dem Menschen: Mephisto versprach dem triebbedrängten Faust „Du siehst, mit diesem Trunk im Leibe, bald Helena in jedem Weibe“(Goethe).
Die von den Motivations-, Identifikations- und Lokalisations-Modulen ausgehenden Einflüsse werden in ein Startersystem eingespeist, welches, entsprechend einem logischen UND-Gatter (AND-Gate), das zugeordnete motorische Koordinationssystem MKS für die adäquate Verhaltensreaktion auf den Signalreiz aktiviert. Das MKS besteht aus Neuronen, die für die Muskelkontraktionen erforderliche Impulsmuster generieren. Wie funktionieren solche Impulsmuster-Generatoren? Welche Neuronenschaltungen liegen ihnen zugrunde?
Wir beginnen mit einer einfachen Kettenschaltung, in der drei Neurone[1], [2] und [3] sequentiell durch erregende Synapsen miteinander verschaltet sind: [1] erhält einen dauerhaften Eingang; [3] vermittelt den entsprechend dauerhaften Ausgang, d.h. [3] ist über die gesamte Zeit des Eingangs aktiv. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Steuerung oder Auslösung.
Von der Kettenschaltung ausgehend, stellen wir uns vor, dass eine Abzweigung von Neuron[2] rückwirkend das Neuron[1] erregt. Dann kommt es in dieser positiven Rückkopplungsschleife zu „kreisenden Erregungen“, die sich eine Zeitlang selbst stimulieren, so dass der Ausgang einen kurzen Eingang überdauern kann. Nach diesem Prinzip kann z.B. ein Verhaltensprogramm den auslösenden Reiz überdauern.
Von der Kettenschaltung ausgehend, stellen wir uns jetzt vor, dass eine Abzweigung von Neuron[2] rückwirkend das Neuron[1] hemmt. Dann wird infolge dieser negativen Rückkopplungsschleife ein relativ lang anhaltender Eingang nur zu einem kurz anhaltenden Ausgang führen.
Jetzt wird es kompliziert. Wir gehen von einer anderen Neuronenschaltung aus: der Eingang möge gleichzeitig zwei Neuronen[1a] und [1b] zugeführt werden. Weiterhin hemmen sich diese beiden Neurone gegenseitig über hemmende Interneurone[2a] und [2b], wobei eine Hemmung – z.B. von [1a] nach [1b] – verzögert sein möge; dies könnte durch eine verzögernde erregende Verbindung zwischen [1a] und [2b] erreicht werden. Dadurch wird sicher gestellt, dass sich beide Neuronen[1a] und [1b] nicht gleichzeitig hemmen. Infolge der sequentiellen reziproken Hemmung zwischen [1a] und [1b] antworten dann [1a] und [1b] alternierend mit kurzen Impulssalven. Solch eine Neuronenschaltung nennt man Oszillatorschaltung. Oszillatoren spielen für motorische Koordinationssysteme eine große Rolle, da sie es ermöglichen, jeweils bestimmte Muskelgruppen sequentiell zu aktivieren. Wir werden einige der besprochenen Neuronenschaltungen in den folgenden drei Verhaltensbeispielen kennen lernen.
Beispiel 1: Fluchtverhalten der Meeresschnecke Tritonia. Diese Nacktschnecke bewohnt die kalifornische Küste und kriecht gewöhnlich langsam ihres Weges. Sobald sie jedoch einem großen Seestern begegnet, wittert sie die von ihm ausgehenden chemischen Stoffe, und das bedeutet offensichtlich Gefahr, denn sie schaltet ihre Lokomotion von Kriechen auf Flucht-Schwimmen um. Hierzu erhält ihr ZNS zwei Befehle:
- ändere die Körpergestalt paddelförmig !
- zieh das Fahrgestell ein: „ready for take off“ ! [im Wasser versteht sich]
Zentrale Mustergeneratoren ZMG, nach dem Prinzip einer Oszillatorschaltung, aktivieren jetzt rhythmisch sequentiell die Rückenmuskulatur bzw. die Bauchmuskulatur, und die Schnecke schwimmt davon. Betrachten wir die Verschaltung der Neuronen im Detail, nach Willows 1973: Das chemische Signal (1) wird von Chemorezeptoren (2) erkannt; Starterneurone (3) aktivieren sodann den ZMG, indem sie Neurone (5) der Oszillatorschaltung erregen (die sich sequentiell reziprok hemmen), und mit ihren Impulsmustern die Motoneurone (7) für die dorsale bzw. ventrale Körpermuskulatur (8) ansteuern. Diese Koordination wird durch Antagonisten-Hemmung (6) gesichert. Zudem werden mittels einer positiven Rückkopplungsschleife (4) Erregungen gespeichert, so dass das motorische Oszillatorprogramm für die Schwimmbewegung sinnvoller weise nach der Reizeinwirkung noch eine Zeitlang abläuft. In dieser Tabelle habe ich für die soeben genannten Komponenten (1) bis (8) die neurophysiologischen und ethologischen Begriffe gegenübergestellt. – Wir kommen jetzt zum nächsten Beispiel.
Beispiel 2: Beutefang- und Fluchverhalten der Erdkröte Bufo bufo. Im Rahmen unserer Forschungstätigkeit haben meine Mitarbeiter und ich die Frage verfolgt, welche neurophysiologischen Grundlagen der Auslösung des Beutefangs zugrunde liegen: an welchen Objektmerkmalen erkennt die Kröte Beute und wie unterscheidet sie Beute von Nichtbeute bzw. Feind? Wie kann man diese Frage methodisch angehen? Die nächste Folie zeigt eine Skizze der inzwischen historischen Versuchsapparatur, die ich 1963-1965 für meine Dissertation entwickelt hatte und die – in technisch modernisierter und Computer-gestützter Form – noch bis vor wenigen Jahren Forschungszwecken in unserer Abteilung diente. In einem zylindrischen Glasgefäß, im Zentrum einer Arena, sitzt eine Kröte, um die herum ein Stück Karton als Beuteattrappe mit konstanter Geschwindigkeit mechanisch bewegt werden kann. Wenn sich die Kröte in Beutestimmung befindet und, wenn das Kartonstück von seiner Form und Größe gewisse Vorraussetzungen einer Beuteattrappe erfüllt, dann folgt die Kröte diesem Objekt mit Beutefangwendereaktionen und bewegt sich dabei im Kreise.
Zu den quantitativen Ergebnissen: einen kleinen Streifen haben wir längs zur Bewegungsrichtung schrittweise verlängert: die Beutefangaktivität (Reaktionen pro min) steigt mit der Verlängerung von lp. Dann haben wir umgekehrt die Streifenachse quer zur Bewegungsrichtung schrittweise verlängert: die Beutefangaktivität sank mit der Verlängerung von lq. Unter Quadratstücken verschiedener Größe wurde eine bestimmte „maulgerechte“ Größe bevorzugt. Wir schließen daraus, dass die Kröte Beute von Nicht-Beute nicht nur an der Größe, sondern an ihrer Gestalt erkennt: denn ein Streifen in Richtung seiner Längsachse bewegt löst Beutefang aus; ist jedoch die Längsachse desselben (!) Streifens quer zur Bewegungsrichtung orientiert, wendet sich die Kröte von ihm ab. Hierzu schauen wir uns einen kurzen Video-Clip an, den das Institut für den Wissenschaftlichen Film Göttingen in unseren Labors aufgenommen hat; er zeigt auch, dass diese figürlichen Zuordnungen von der Richtung der Bewegung unabhängig sind.
Jetzt zur Frage, an welchen Merkmalen Kröten Feinde erkennen. Wir haben experimentell herausgefunden, dass Feindmerkmale bereits dann zustande kommen, wenn man einen beuteähnlichen Schlauch mit einem quer zur Bewegungsrichtung orientierten Schlauchstück kombiniert. Diese Konfiguration scheint für die Kröte unheimlich zu sein. Interessanterweise antwortet die Erdkröte auf eine echte Schlange mit dem gleichen spezifischen Abwehrverhalten wie auf diese Feinattrappe: sie streckt alle vier Extremitäten stelzenförmig und nimmt eine stationäre Pose ein, die es der Schlange schwer macht, sie zu packen. Denn während die Schlange versucht, die Kröte an einem Hinterbein zu packen, bietet ihr die Kröte ihre Breitseite. Die Kröte läuft jedoch nicht weg, denn die Schlange wäre schneller.
Nun wollen wir natürlich wissen,
- welche Hirn-Strukturen auf Beute bzw. Feinde ansprechen
- welche Neurone an der Analyse der Beute- und Feindmerkmale beteiligt sind
- welche Neuronenschaltungen für die Auslösung entsprechender Beutefang- und Fluchtverhaltensweisen verantwortlich sind
Hierzu ist es zunächst wissenswert, dass das Gesichtsfeld der Kröte in ihrem Gehirn repräsentiert wird. Mit anderen Worten, jeder Ort im Gesichtsfeld wird auf einem entsprechenden Ort auf der Retina abgebildet und dieser wird über den Sehnerven als Projektionsbahn jeweils im gegenüberliegenden Mittelhirndach, Tectum opticum, abgebildet. Beispiel: wenn sich eine Fliege im Gesichtsfeld-Ort 12 befindet, dann werden dementsprechend Neurone im Tectum-Ort 12 erregt. Das lässt sich im Experiment mit Hilfe einer Perimeteranordnung leicht nachweisen: man führt eine Ableitelektrode in den Tectum-Ort 12 und sucht dann mit einer kleinen schwarzen bewegten Scheibe (anstelle der Fliege) im Gesichtsfeld jenen Ort auf, von dem aus das Neuron erregt werden kann.
Im Folgenden untersuchen wir mit Hilfe der Ihnen bereits bekannten 14C-2-Desoxiglucose-Technik, welche Bereiche des Krötenhirns durch Beute bzw. Feinde aktiviert werden. Diese Folie zeigt rechts und links zwei Hirnschnittserien durch das vordere, mittlere und hintere Mittelhirn: dorsal das Tectum opticum und zentral-lateral der praetectale Thalamus. Links: das Gehirn einer Kröte, die angesichts eines Beuteobjekts schnappte; rechts: das Gehirn einer anderen Kröte, die angesichts eines Feindobjekts sich duckte. Die hier illustrierte Radioaktivität – als Maß für die neuronale Aktivität – steigt in Richtung warmer Farben an. Angesichts einer Beute weist das Tectum seitliche „hot-spots“ auf; im Übrigen ist der Hirnabschnitt relativ kühl. Angesichts eines Feindes sind alle diese Hirnbereiche relativ „hot“, und zwar besonders der praetectale Thalamus.
Schließlich fragen wir, welche Korrelationen zwischen der Verhaltensaktivität und der neuronalen Aktivität auf unterschiedliche visuelle Bewegungsreize bestehen. Hier ist das Gehirn einer Erdkröte abgebildet; der Bauplan der Amphibiengehirne ist relativ einheitlich: Telencephalon, Diencephalon, Mesencephalon, Cerebellum und Medulla oblongata. Die Retina projiziert kontralateral – über das totale Chiasma opticum – z.B. in den praetectalen Thalamus des Diencephalon und in das gegenüberliegende Tectum opticum des Mesencephalon. Wir leiten jetzt mit Hilfe einer Mikroelektrode die Antworten von Neuronen der Retina, des Praetectum, und des Tectum ab, während ein visuelles Objekt das jeweils zugeordnete rezeptive Feld RF durchquert, so wie es dieses Schema zeigt. Sie erinnern sich noch daran, was man unter einem RF versteht. Die neuronalen Antworten werden auf einem Oszilloskop aufgezeichnet und anschließend mit einem Computer ausgewertet. Wir schauen uns das experimentelle Vorgehen in einem kurzen Video-Clip an und halten abschließend fest
- Tectum-Neurone vom Typ 5.2 antworten auf schmale in Richtung ihrer Längsachse bewegte Objekte stärker als auf schmale quer zu ihrer Längsachse bewegte Objekte
- Praectum-Neurone vom Typ TH3 antworten auf schmale quer zu ihrer Längsachse bewegte Objekte stärker als auf schmale in Richtung ihrer Längsachse bewegte Objekte
Beim Vergleich der Response-Kennlinien des Beutefangs für figürlich unterschiedliche Objekte mit den entsprechenden Response-Kennlinien retinaler (R2, R3) Neurone, praetectal thalamischer (TH3) Neurone und tectaler (T5.1, T5.2) Neurone wird deutlich, dass diese Neuronentypen die verhaltensrelevanten Objektmerkmale unterschiedlich bewerten, wobei T5.2 Neurone mit der Beutefangaktivität die beste Korrelation zeigen.
Wie sehen solche Neurone – beispielsweise T5.1 und T5.2 – eigentlich aus? Das experimentelle Vorgehen von Farb-Injektionstechniken haben wir bereits in Block1 kennen gelernt. Diese Folie zeigt solche angefärbten, histologisch rekonstruierten Neurone; hier ein beuteselektives T5.2 Neuron im Tectum opticum und dort ein am Schnappvorgang beteiligtes Zungenmuskel-Motoneuron in der Medulla oblongata.
Wir kommen jetzt zu einem Modell, das veranschaulicht, wie retinale, praetectale und tectale Neurone im Prinzip miteinander verschaltet sein müssten, um figürliche Merkmale bewegter Objekte voneinander unterscheiden zu können. Diese Hypothese habe ich 1974 in Scientific American vorgestellt und zusammen mit Werner von Seelen in Biological Cybernetics mathematisch gefasst. Sie fand Beachtung, wurde von wissenschaftlichen Konkurrenten heftig attackiert, sie ist jedoch bis heute – rd. 30 Jahre danach – uneingeschränkt gültig.
Die Folie zeigt das Prinzip der Verschaltung bestehend aus paralleler und interaktiver Informationsverarbeitung
- Parallele Verarbeitung: Retinale Ganglienzellen R2, R3, speisen erregende Einflüsse in tectale Neurone T5.1, und R3 und R4 speisen erregende Einflüsse in praetectale Neurone TH3. Ferner: T5.1 erregt T5.2, und TH3 erregt TH4.
- Interaktive Verarbeitung: T5.1 erregt TH4, während T5.2 durch TH3 gehemmt wird.
Diese Folie zeigt weiterhin drei Verarbeitungsbeispiele für Beute, Nicht-Beute und Feind. Das Modell wurde Jahrzehnte lang auf „Herz und Nieren“ – sprich Gültigkeit – getestet. Die Verbindungen zwischen den Neuronen sind experimentell nachgewiesen; Verbindungen mit den motorischen Koordinationssystemen MKS der Medulla oblongata sind bewiesen. Es gibt einen besonders kritischen Test verbunden mit der Frage: was geschieht, wenn die hemmende Verbindung von TH3 nach T5.2 experimentell ausgeschaltet wird? Das Ergebnis zeigt der nächste Video-Clip: die Kröte kann Objekte nicht mehr figürlich unterscheiden; sie schnappt nach allem, was sich bewegt.
Soviel zum neuronalen Kernstück der figuralen Unterscheidung; diese allein erklärt jedoch noch nicht, wie die verschiedenen MKS für Sich-Zuwenden zur Beute, Zuschnappen, Sich-Abwenden vom Feind, Ducken, Springen etc angesteuert werden. Das von uns entwickelte Konzept der sensomotorischen Codes geht von der Hypothese aus, dass verschiedene Merkmale erfassende Neurone in bestimmter Kombination das zugeordnete MKS ansteuern; wir nennen solch ein Modul: Kommando auslösendes System. Es wird von Hirnstrukturen, die für die Motivation verantwortlich sind, überwacht.
Das sieht zunächst alles recht einfach und übersichtlich aus. Wie aber sind solche Neuronenschaltungen und Module im Krötenhirn integriert? Bitte bekommen Sie jetzt keinen Schreck: einen bescheidenen Einblick in diese Komplexität zeigt die nächste Folie, in der wir uns einmal die Mühe gemacht haben, Verbindungen zwischen Funktionsstrukturen einzutragen, die in der wissenschaftlichen Literatur bis zum Jahre 2000 bekannt waren. Wir haben jede Verbindung nummeriert und können sagen, welcher Forscher wann diese entdeckt hat.
Beispiel 3. Das motorische System des Menschen Homo sapiens. Es weist folgende Grobgliederung auf: beginnen wir mit der Muskulatur als ausführendes Organ; diese wird vom Rückenmark innerviert und ist somit in die Rückenmarksreflexe eingebunden. Die Motoneurone des Rückmarks erhalten direkte Eingänge von den Pyramidenzellen des Motocortex, deren Axone in den Pyramidenbahnen verlaufen; sie gehören zum pyramidalen System. Weiterhin erhalten sie Eingänge vom extrapyramidalen System, zu dem das Cerebellum und die Basalganglien gehören. Die Sensorik wird natürlich mit verarbeitet. Insofern bestehen geschlossene sensomotorische Systeme und Rückmeldekreise.
Wie das ganze funktioniert? Als passionierter Autofahrer erkläre ich das immer gern am Autofahrenlernen und beginne mit den ersten Fahrversuchen: beim Anfahren kommt es darauf an, dass das Zusammenspiel zwischen Kupplung, Gaspedal und Bremse stimmt. Dies setzt – vor allem beim Anfahren am Berg – bestimmte Koordinationsmuster während der Fuß- und Handarbeit voraus, die zunächst nicht einfach erscheinen. Denn zu vermeiden sind: Zurückrollen nach hinten, Hechtspung nach vorn, Motor abwürgen; – und steuern muss man das Gefährt ja auch noch. Für geordnete Fußarbeit sind zunächst ein paar Blicke in den Fußraum hilfreich; das kann man auf dem Parkplatz üben, beim Anfahren am Berg muss die Koordination jedoch perfekt sitzen. Anfangs ist das pyramidale System gefragt: so geben die motorisch/praemotorischen Cortices – aufgrund spontaner Eingänge und sensorischer Informationen – entsprechende Befehle an die Rückenmarksmotorik für die erforderliche Fuß- und Handarbeit. Dann tritt das extrapyramidale System in Aktion: erfolgreiche Motorprogramme und deren Koordination werden abgespeichert, und durch Rückmeldungen verfeinert. Für den Feinschliff schneller Motoroutinen ist vor allem das Cerebellum zuständig. Erfolgreiche automatisierte Motorprogramme werden im extrapyramidalen System gespeichert; man muss sie nur noch abrufen, jedoch nicht mehr bewusst durchleben, was angesichts der Auslastung des Cortex für die Verkehrssituationen fatal wäre.
Denn, wie wir wissen, ist der Motocortex auch dann aktiv, wenn wir uns eine Bewegung nur vorstellen. Ich verweise auf die interessanten EEG Untersuchungen hin, die von Frau Dr. Schürg-Pfeiffer in unserer Abteilung an Probanden durchgeführt hat. Hier ist das EEG Aktivitätsmuster einer Versuchsperson; sie sitzt im Dunkeln und versucht, an nichts zu denken; sobald sie ihre Däumchen umeinander dreht, sind Bereiche des Motocortex aktiv; das gleiche Aktivitätsmuster tritt aber auch auf, wenn sie sich ihr Däumchendrehen nur vorstellt.
Abschließend betrachten wir eine wichtige Erkrankung des motorischen Systems: Morbus Parkinson. Diese Krankheit äußert sich in
- Rigor: gesteigerte Grundspannung der Skelettmuskulatur (Tonus)
- Akinese: lokomotorische Bewegungsarmut bis hin zur motorischen Starre
- Tremor: Wackelzittern, vor allem im Bereich der Extremitäten
Worauf beruht diese Erkrankung und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Der Schlüssel liegt in der Substantia nigra pars compacta (=Nucleus niger) des Mesencephalon. Dort befinden sich dopaminerge Nervenzellen, deren Neurotranmitter Dopamin ganz woanders wirkt, nämlich in den Basalganglien des Telencephalon, genau gesagt im Striatum: Dopamin dockt dort an D1-Rezeptoren und aktiviert das Striatum, das seinerseits den Gluobus pallidus Pars interna hemmt, woraufhin die hemmende Wirkung vom Globus zum Thalamus aufgehoben wird, so dass der Thalamus den Motocortex erregen kann. [Das ist der eine Weg; daneben gibt es noch zwei weitere synergistische Wege, die hier zwar dargestellt sind, aber nicht näher beschrieben werden müssen.] Was bedeutet das? Für alle Willkürbewegungen muss der Motocortex aktiviert werden; dies geschieht auf folgende Weise: hemme den Globus pallidus, damit der Thalamus ungehemmt den Motocortex aktivieren kann. Dazu müssen sich die an den Übertragungen beteiligten Neurotransmitter Dopamin, GABA und Glutamat jeweils in einem bestimmten Gleichgewicht befinden. Fällt ein Neurotransmitter aus, resultieren Störungen der Motorik.
________________________________________________________________
Doppelte Hemmung: schwierig zu verstehen? Ich möchte Ihnen eine Hilfe geben. Wir betrachten 4 sequentiell verschaltete Neurone, von denen nur die beiden letzten daueraktiv (O–) sind; ist die Synapse des vorletzten Neurons hemmend (–––/), so wird das letzte Neuron gehemmt; falls das erste Neuron aktiv ist, wird das letzte Neuron stärker gehemmt:
O–––>O–––>O–––/O–––>
Wenn die Synapsen der beiden mittleren Neurone hemmend sind, wird das letzte Neuron wieder gehemmt; falls das erste Neuron aktiv ist, wird das letzte Neuron jedoch enthemmt, d.h. es wird aktiv:
O–––>O–––/O–––/O–––>
Eine sequentielle doppelte neuronale Hemmung führt zur Erregung [etwa wie doppelte Verneinung eine Bejahung bedeutet]. Zahlreiche Prozesse im ZNS werden durch doppelte Hemmungen gestartet; man spricht in diesem Zusammenhang auch von Disinhibition.
Was würde im letzten Beispiel geschehen, wenn die erregende Übertragung des ersten Neurons [Substantia nigra] ausfällt? Dann wäre das letzte Neuron [Thalamus] gehemmt, womit wir bei den Ursachen der Parkinsonschen-Kranheit sind.
________________________________________________________________
Die Parkinson-Krankheit beruht auf degenerativen Prozessen in der Substantia nigra und dem einhergehenden Mangel an Dopamin im Striatum. Folglich ist der Globus pallidus hypererregt und der Thalamus dauerhaft gehemmt, so dass der Motocortex nicht erregt werden kann. Dies führt u.a. zur Akinese.
Welche Therapie-Möglichkeiten gibt es? Die klassische Therapie besteht in der oralen Verabreichung einer Vorstufe von Dopamin, L-Dopa, die – im Gegensatz zu Dopamin – die Blut/Hirn-Schranke durchquert. Zusätzlich werden Dopamin-Agonisten gegeben, die die Blut/Hirnschranke passieren können. Diese Medikation wirkt jedoch systemisch, d.h. sie erfasst das gesamte Gehirn, so dass Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen werden können: Schlaflosigkeit, Halluzinationen usw.
Eine gezielte Behandlung ermöglicht der hirnchirurgische stereotaktische Eingriff am Globus pallidus. Infolge der Verschiebung des Neurotransmitter-Gleichgewichts, mangels Dopamin, ist der Globus pallidus hyperaktiv. Diese Hyperaktivität lässt sich durch partielle Ausschaltung des Globus auf ein verträgliches Maß reduzieren. Diese hirnchirurgische Methode ist natürlich nur in schwersten Fällen in Erwägung zu ziehen, wenn alle anderen Mittel nicht mehr helfen. Den Erfolg sehen wir im folgenden Video-Clip „Fred contra Parkinson“. Dieser Film ist für mich ein mehrfacher Superlativ: er gehört zu den aufregendsten, menschlich ergreifendsten und medizinisch überzeugendsten Dokumentarfilmen der Neurologie.
Zum Abschluss dieser Vorlesungsreihe wollen wir uns mit Neuroplastizität bei Rehabilitationsprozessen näher beschäftigen. Einige Grundlagen haben wir bereits in den Blöcken 3 und 9 kennengelernt.
Wie wir wissen, gibt es in der Großhirnrinde – dem Cortex cerebri -- sensorische Cortex-Areale, die in Form von topografischen Karten für das Sehen (visueller Cortex), Hören (auditorischer Cortex), Tasten (somatosensorischer Cortex) etc verantwortlich sind, und es gibt motorische Areale (Motor-Cortex), die für Bewegungen der Finger, Hände, Arme, Füße, Zehen etc zuständig sind. Topographische Karte heißt, dass zum Beispiel jedem Ort unserer Netzhaut ein bestimmter Ort in der Hirnkarte des visuellen Cortex zugeordnet ist. Entsprechendes gilt anderen Orts im somatosensorischen Cortex für die Körperhaut oder, wiederum anderen Orts, im auditorischen Cortex für die Tonfrequenzen längs der Basilarmembran des Innenohrs. So sind zunächst einmal die Zuständigkeiten im Gehirn zugewiesen. Der Raum erscheint bedarfsorientiert aufgeteilt, denn das Raumangebot richtet sich nach dem funktionellen Aufwand: für die Fovea centralis der Netzhaut, den Bereich des schärfsten Sehens, ist mehr Platz vorgesehen als für die Netzhautperipherie; für die Hand ist mehr Platz vorgesehen als für den Ellenbogen oder das Knie, um ein anderes Beispiel zu nennen.
Früher glaubte man, dass das Gehirn – spätestens das des Erwachsenen – fix und fertig ist und sich im Laufe des Lebens nicht mehr verändert, ja, eher etwas verschlechtert, was zum Beispiel den Verlust von Neuronen, die Verlangsamung der Leitungsgeschwindigkeit und Defizite in der Speicherungs -und Erinnerungsfähigkeit betreffen. Daher auch das Sprichwort: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr“.Heute wissen wir es besser: Das Gehirn ist ein Leben lang lernfähig bis ins hohe Alter, wenn es entsprechend stimuliert wird. Das Gehirn verändert sich ständig in Abhängigkeit dessen, was wir denken oder unternehmen. Auf diesem Forschungsgebiet sind drei Pioniere zu nennen, die Neurologen
Roger W. Sperry Regeneration und Hirn-Lateralisation
Paul Bach-y-Rita Sensorische Substitution und Rehabilitation
Eric Kandel Biochemie der Vernetzung des Gehirns durch Denken und Lernen
.
Welches Ausmaß an Neuroplastizität überhaupt möglich ist, möge an einer Person erläutert werden, bei der aufgrund eines Geburtsfehlers nur die rechte Hirnhälfte ausgebildet ist. Sie werden vielleicht fragen: wo ist das Problem? Dafür haben wir ja zwei Hirnhälften. Beide Hirnhälften sind jedoch nicht gleichwertig; es besteht Aufgabenteilung. Die linke Hälfte dominiert z.B. in wichtigen Funktionen wie Sprache, Sprachverständnis, Schreiben, Lesen, verbales Gedächtnis, rationales Denken etc. Weiterhin werden beide Körperhälften kreuzweise jeweils von der gegenüberliegenden Hirnhälfte sensorisch innerviert und motorisch kontrolliert. Obwohl beide Hirnhälften z.T. unterschiedliche Funktionen haben, zeigt diese Person keine wesentlichen Einschränkungen: sie lacht, weint, spricht und liest normal, sie denkt normal, erinnert sich normal und bewegt sich normal, z.B. tanzt sie leidenschaftlich gern. Wie ist das möglich? Vermutlich müssen Vorläufer der linken Hirnhälfte, bevor jene sich nicht weiterentwickelte, Informationen an die rechte abgegeben haben, um sich dort zusätzlich zu etablieren.
Wir halten fest: sich selbst regenerieren zu können, ist eine wichtige Eigenschaft des Gehirns. Mithin lassen sich Programme von Neuronenschaltungen, die bestimmten Funktionen gewidmet sind – zum Beispiel dem Gesichtssinn – für andere Funktionen – zum Beispiel dem Tastsinn – umprogrammieren. Damit betreten wir das Gebiet der sensorischen Substitution. Darunter versteht man die Fähigkeit, dass Sinnesleistungen nach Ausfall des zugeordneten Sinnesorgans von anderen Sinnen übernommen werden können. Wissenschaftlicher Wegbereiter auf dem Gebiet der Neuroplastizität war in den 70er Jahren der Neurologe Paul Bach-y-Rita, dessen Visionen sich heute bestätigten und in der Medizin Anwendung finden. Ich möchte dies an sieben verschiedenen Beispielen veranschaulichen.
1.) Beispiel. Kann die Netzhaut durch die Körperhaut funktionell ersetzt werden? Können Blinde mit ihrer Körperhaut sehen? Bereits 1969 wurden Ideen für eine Maschine vorgestellt, die die Bilder einer stabtaschenlampenartig gehaltenen Videokamera in Vibrationssignale auf der Rückenhaut eines Blinden übersetzten und dort – wie auf der Netzhaut – abbildeten. Das Gehirn hat diese Tastinformation in Bildinformation umgewandelt und ermöglichte dem Blinden, sich im Raum zu orientieren.
In einer anderen Studie wurde Videoinformation in Tastinformation übersetzt und mit Hilfe eines löffelartigen Geräts auf die Zungenoberfläche appliziert, die sich bekanntlich durch ein besonders hohes taktiles räumliches Auflösungsvermögen auszeichnet. Nach einiger Übung konnte der Proband sich im Raum orientieren und die Konturen von Gegenständen bildlich erfassen.
Demnach lassen sich Hirnmodule, die ursprünglich der Verarbeitung bestimmter Sinnesempfindungen gewidmet sind, dazu bringen, andere Sinnesempfindungen zu verarbeiten. Blinde können gewissermaßen mit ihrem somatosensorischen Cortex sehen. Mithin besteht eine Verbindung zwischen somatosensorischem und visuellem Cortex.
2.) Beispiel. Können Blinde mit ihrem visuellen Cortex tasten und damit die Fähigkeit ihres somatosensorischen Cortex, dessen Fingerregionen dafür vorgesehen sind, steigern? Antwort: ja. Wie aber hat man das herausgefunden? Wie wir bereits kennengelernt haben, gibt es eine non-invasive Methode, mit der sich am Menschen ohne schädliche Nebenwirkungen Neurone einer Cortexregion reversibel erregen oder ausschalten lassen. Es ist die Transkranielle Magnet(feld)-Stimulation, abgekürzt TMS. Diese Technik nutz Starkstromspulen, wie sie in elektrischen Kraftwerken benutzt werden, um durch ein sich veränderndes Magnetfeld im Hirngewebe einen Stromfluss zu induzieren. Soviel zur Methode, nun zu ihrer Anwendung. Zwei Versuchsgruppen:
Gruppe-1 sind Blinde, die Blindenschrift (Brailleschrift) mit Hilfe ihres Tastsinnes perfekt beherrschen. Wird ihr visueller Cortex durch TMS ausgeschaltet, machen sie beim Lesen Fehler. Nach Ausschaltung der Fingerregion im primär verantwortlichen somatosensorischen Cortex – bei intaktem visuellem Cortex – bleibt die Fähigkeit fehlerhaft erhalten.
Gruppe-2 sind Sehende, die Blindenschrift lesen können. Schaltet man bei ihnen den visuellen Cortex aus, bleibt diese Lesefähigkeit völlig unbeeinträchtigt. Nach Ausschaltung der Fingerregion im somatosensorischen Cortex erlischt jedoch die Fähigkeit, Brailleschrift zu lesen.
3.) Beispiel. Nachdem, was wir jetzt wissen, sollte man annehmen, dass besonders intensiv genutzte Tätigkeiten im Cortex ein entsprechend größeres Areal beanspruchen, und zwar zu Lasten weniger genutzter Tätigkeiten, denn die Cortex-Oberfläche wächst ja nicht mehr. Die Cortexregionen stehen also in Konkurrenz zueinander; die aktivste Region beansprucht den größten Raum. Woher wissen wir das?
Kurz zur Wiederholung: Es gibt eine Methode, mit der man einer Versuchsperson, ohne sie zu beeinträchtigen, ins Gehirn schauen kann. Es handelt sich dabei um die Positronen-Emissions-Tomographie, abgekürzt PET. Je aktiver Neuronen sind, desto höher ist ihr Sauerstoffverbrauch und damit auch die Stärke der Blutzirkulation in diesem Bereich. Dies kann in einer PET-Anordnung tomographisch gemessen werden.
Klavierschüler dienten als Versuchspersonen. Zu Beginn des Klaviertrainings war ihr motorischer Cortex in der Hand/Finger-Region normal aktiviert. Im Laufe des Trainings breitete sich der Aktivitätsbereich mehr und mehr aus. Die Schüler machten dann Ferien und pausierten mit dem Klavierspielen längere Zeit. Danach war im PET-Test der entsprechende Aktivitätsbereich ihres motorischen Cortex geschrumpft.
Die Klavierschüler stellten sich jetzt im Geiste ihre Fingerbewegungsfolge vor für ein Klavierstück vor, ohne zu spielen. Die Aktivität im Cortex nahm im Laufe dieser theoretischen Proben wieder zu, ähnlich wie wenn sie das Stück gespielt hätten. Das bedeutet, dass in unserer Erinnerung jene Neurone wieder aktiv werden, die zuvor für die Ausführung der Tätigkeit aktiviert waren.
Das erinnert uns an Sportler, die vor dem Start (z.B. Stabhochsprung oder Weitsprung) noch einmal die Abfolge ihrer Bewegungen geistig nachvollziehen, mental trainieren und einschleifen. Das hat natürlich nur dann Sinn, wenn zuvor praktisches Training absolviert wurde, bei dem der Handlungsablauf den jeweiligen Gegebenheiten entsprechend angepasst worden ist.
In diesem Zusammenhang ist auch das Buch zu nennen, das man sich vor einer Klausur nachts unters Kopfkissen legt. Hierbei geht es natürlich nicht um das Buch, sondern um den kurz vorm Einschlafen gelesenen Stoff, der sich nachts im Unterbewusstsein festigt. Auf diese Weise habe ich während meiner Studienzeit erfolgreich Vorträge geübt. Eines Tages jedoch wollte ich die Methode ändern, indem ich den Vortrag, auf Band gesprochen, mir wiederholt anhörte. Das Ergebnis war katastrophal: ich hielt den schlechtesten Vortrag meines Lebens. Warum? Offensichtlich deswegen, weil ich mich mehr oder weniger passiv akustisch berieseln ließ und nicht aktiv den Inhalt memorierte.
Unser Gehirn ist elastisch, plastisch, aber auch verwundbar. Sich selbst zu verändern, ist eine wichtige intrinsische Eigenschaft des Gehirns. Die Richtung der Veränderung können wir selbst bestimmen.
4.) Beispiel. Es gibt hyperaktive Kinder, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, oder auch Zappelphilipp-Syndrom leiden. Diese Kinder sind unruhig, unaufmerksam und durch Kleinigkeiten abgelenkt. Sie haben Schwierigkeiten, deutlich zu sprechen und können Gesprächen kaum in Echtzeit folgen. Sie haben Probleme mit Grammatik, Syntax und im Erkennen von Kausalzusammenhängen. Meist zeigen sie eine Lese-/Schreibschwäche. Betroffen ist dabei nicht nur die Rechtschreibung, sondern auch die Feinmotorik beim Schreiben, also leserlich schreiben.
Für solche Patienten wurden neuartige Unterrichtskurse entwickelt, die die Neuroplastizität des Gehirns nutzen. Schon beim Betreten des Unterrichtsraums fällt das ruhige Arbeiten auf. Die Schüler beschäftigten sich z.B. intensiv damit, auf Seiten vorgedruckte geometrische Figuren – wie Quadrate, Rechtecke, Kreise, Ellipsen – sorgfältig und akkurat mit Buntstift nachzuzeichnen, was ihnen anfangs sehr schwer fällt. Nachdem durch ständige Übung diese Fertigkeit eingeschliffen war, erfolgte eine Steigerung des Schwierigkeitsgrads, indem ihnen jetzt unbekannte symbolartige Umrisse und Buchstaben zum Nachzeichnen geboten wurden und schließlich Zahlen sowie Buchstaben des Alphabets.
Eigentlich wurde hier das geübt, was die klassische Erziehung seinerzeit nachhaltig förderte, heute in der Schulausbildung jedoch vernachlässigt wird: sich auf feinmotorische Fertigkeiten zu konzentrieren und entsprechende Fähigkeiten zu erwerben, wie Gedichte auswendig lernen, Vorträge halten, Texte vorlesen bzw. Nacherzählen usw. Zu meiner Schulzeit gab es noch das Fach „Schönschrift“. Wie wir heute wissen, erfüllte diese Disziplin – im Sinne des Wortes – durchaus einen übergeordneten Zweck, was natürlich in keinem ursächlichen Zusammenhang mit ADHS gesehen werden darf.
ADHS Patienten leiden möglicherweise an einer Störung des Informationsstroms, der Signale aus dem Okzipitallappen (visueller Cortex), dem Temporallappen (auditorischer Cortex) und dem Parietallappen (somatosensorischer/motorischer Cortex) zusammenführt und aufeinander abstimmt. Bei der Neuroplastizitätsmethode werden diese Areale direkt angegangen und gleichsam gezwungen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, ohne Ersatzhandlungen zuzulassen. Auf diese Weise werden die Cortex-Areale und ihr Zusammenspiel umprogrammiert, um effizienter zu arbeiten.
Zweifellos verspricht die hier angedeutete Neuroplastizitätsmethode – allein – nicht in allen Fällen eine Heilung von ADHS. Die Konzentrationsschwäche beruht vermutlich auf einem Dopamin-Defizit im Belohnungssystem, genauer gesagt auf mangelhafter Bindungsfestigkeit dieses Neurotransmitters an der postsynaptischen Membran von Neuronen des Nucleus accumbens. Sofern jedoch alle verhaltenstherapeutischen Behandlungen fehlgeschlagen sind, könnte daher eine neuropharmakologische Behandlung, z.B. mit Ritalin, in Erwägung zu ziehen sein. Ritalin verzögert die Rückaufnahme von Dopamin und unterstützt dadurch die Wirkung des Neurotransmitters. Auf die damit einhergehende Problematik wurde in Block 6 ausführlich eingegangen.
5.) Beispiel. Bei einem Schlaganfall kommt es infolge eines Thrombus in einem Hirngefäß zum Stillstand der Durchblutung des zu versorgenden Nervengewebes; daraufhin stirbt das betroffene Hirngewebe ab. Falls von dem Schaden der motorische Cortex betroffen ist, z.B. in der Hand-/Fingerregion, so tritt in dem entsprechenden Bereich der Extremität Lähmung auf. Bei der Neuroplastizitäts-Therapie wird die nicht betroffene Hand in einen starren Handschuh gesteckt, der jegliche Manipulationen verhindert. Jetzt wird die gelähmte Hand gezwungen, Tätigkeiten mit steigendem Schwierigkeitsgrad schrittweise auszuführen, z.B. Kinderspielzeug zusammenzustecken wie Lego, Duplo etc. Nach intensiven, wenn auch langwierigen, Übungen stellt sich im Laufe der Zeit die Fingerfertigkeit wieder ein.
Wie ist der Erfolg zu erklären? Zum einen werden neue Neuronen rekrutiert, die die Funktion der abgestorbenen übernehmen. Zum anderen wird Nervengewebe benachbarter Hirnregionen, das eigentlich anderen Funktionen gewidmet ist, für neue Aufgaben umprogrammiert. Das lässt sich mit Hilfe der PET-Technik nachweisen. Bekanntlich regt Lernen, dazu gehört auch motorisches Lernen, Hirnzellen an, neue Verbindungen zu schalten.
6.) Beispiel. Kann sich Neuroplastizität auch nachteilig auswirken? Einem Motorradfahrer musste nach einem schweren Unfall der linke Arm amputiert werden. Der Betroffene hat nun die Illusion, seinen Arm als Phantom zu besitzen. Er sieht ihn nicht, spürt ihn jedoch und hat mangels Bewegungsfähigkeit leidvolle Phantomschmerzen.
Ursache ist Neuroplastizität, die im Cortex zu falschen Verbindungen führt und daher sensorisch falsch zugeordnet werden. Resultat sind Missempfindungen. Die Hautregionen des Gesichts, der Hand und des Arms liegen im Cortex dicht nebeneinander, so dass Nervenfasern, die dem Phantomarm zugeordnet sind, in die corticale Gesichtsregion einwandern. Dort werden einige Signale des Tastsinns dem Schmerzsinn zugeordnet. Berührung der Gesichtshaut führt dann zu Schmerzempfindungen im Phantomarm, wobei eine topographische Zuordnung besteht.
Die Phantomschmerzen entstehen unter anderem durch das für den Betroffenen sichtbare Fehlen der Hand, aber der Illusion, sie zu besitzen und der Gewissheit, sie nicht bewegen zu können. Die Rückmeldeschleifen sind unterbrochen.
Lässt sich in diesem Zusammenhang der Teufel durch Beelzebub vertreiben? Kann der durch Neuroplastizität verursachte Schaden durch gezielte andere Neuroplastizität wieder wett gemacht werden? Ja, aber wie? Das Grundprinzip kennen wir bereits: Hirnkarten lassen sich durch Vorstellungskraft verändern.
Experiment-1: Die betroffene Versuchsperson sitzt vor einem Kasten, der in zwei Hälften getrennt ist. Die linke Trennwand besteht aus einem Spiegel, so dass der Betroffene rechts seine intakte Hand und links deren Spiegelbild wahrnimmt so als wäre es seine linke Hand. Wenn er die rechte Hand bewegt und sich vorstellt, die fehlende Hand zu bewegen, die er im Spiegelbild in Bewegung sieht, so verschwindet der Phantomschmerz.
Experiment-2: Die Spiegelung wird entfernt und anstelle des Spiegelbilds erscheint die linke Hand des Experimentators, die der Betroffene für seine Phantomhand hält. Wenn der Experimentator seine eigene Hand berührt, empfindet die Versuchsperson diese Berührung in ihrer Phantomhand. In der Wahrnehmung besteht offensichtlich zwischen Realität und Illusion kein Unterschied. Mithin entsteht eine Verbindung zwischen Gesichtssinn und Tastsinn, also ein Zusammenspiel zwischen den Informationen unterschiedlicher Hirnareale und deren Rückmeldungen. Die visuellen Signale können an die Areale für den Tastsinn zurückgeleitet werden und die Illusion erzeugen, dass der Arm sich bewegt. So kann der Patient durch längerfristiges visuelles Feedbacktraining von seinem Phantomschmerz dauerhaft befreit werden.
Für die Grundlagen gibt es ein neurophysiologisches Korrelat: es sind die sogenannten Spiegelneurone. Wenn mich eine Person an einer Körperstelle berührt, dann entladen an einem entsprechenden Ort meines somatosensorischen Cortex bestimmte Neurone. Interessanterweise sind dieselben Neurone auch dann aktiv, wenn ich eine Person an der entsprechenden Körperstelle berühre. Gerade Kinder zeigen typische Hirnaktivitätsmuster, die beim Schmerzempfinden auftreten, wenn sie ein schmerzhaftes Ereignis eines anderen Kindes sehen. Wenn sie beispielsweise eine heiße Platte anfassen und selbst Schmerz empfinden, werden bestimmte Neurone ihres Gehirns aktiv. Diese sind auch dann aktiv, wenn das Kind ein anderes Kind diese Platte anfassen sieht.
Spiegelneurone befinden sich an verschiedenen Orten des Gehirns, z.B. im somatosensorischen, praemotorischen, praefrontalen Cortex, aber auch im limbischen Cortex, woraus emotionale Aspekte begründet sind. Spiegelneurone wurden 1995 von Giacomo Rizzolatti und Mitarbeitern an Affen entdeckt.
Diese Erkenntnisse öffnen einen naturwissenschaftlichen Zutritt zur Empathie, also dem Mitgefühl bzw. Mitleid. Ein Lebewesen ist mit einem anderen empathisch, wenn es sich in dieses einfühlt. Es stellt sich vor, es wäre das andere, das bedeutet es fühlt, nimmt wahr, denkt und leidet, als wäre es das andere. Wir betreten hier gewissermaßen die Schnittstelle zwischen Philosophie, Religion und Neurophysiologie.
_______________________________________________________________
Das war’s für Block12
ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen für den Verlauf Ihres
Studiums viel Erfolg, und
– angesichts meines bevorstehenden Ruhestands im Herbst 2006 –
verabschiede ich mich hiermit von der Universität Kassel.
Mein besonderer Dank gilt meiner Arbeitsgruppe.
J.-P.E.
Abschiedsworte der Studierenden: